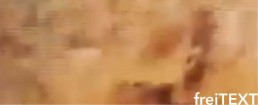freiTEXT | Robin Krick
Das Geständnis
Seit die Dienstvorschriften geändert wurden, dürfen wir die Hauptverdächtigen nicht mehr aufs Revier holen, um ihnen durch Schläge und Anbrüllen das Geständnis zu entringen. Unser Dienstherr ist neuerdings der Ansicht, dass es schädlich sei, die Verdächtigen zu beeinflussen. Der Wahrheit – so drückte er sich aus – müsse Gelegenheit verschafft werden, ganz von selbst durch den Mund des Delinquenten ans Licht zu kommen. Meine Arbeit beschränkt sich jetzt darauf, bloß dazusitzen, abzuwarten und im entscheidenden Moment alles zu notieren. Inzwischen bin ich täglich in der ganzen Stadt zu Hausbesuchen unterwegs, wobei mich das Unterwegssein an sich nicht stört, vor allem, wenn ich an die trübsinnigen Stunden im Büro denke. Dennoch steige ich nur widerwillig in den Dienstwagen. Ich erfahre erst jetzt wieder bei meinem neuesten Fall, wie nutzlos meine Arbeit doch geworden ist: Drei Stunden lang saß ich dem Delinquenten mit dem Notizblock in der Hand auf dem Sofa gegenüber und alles, was er von sich gab, waren schwache Seufzer, ein dumpfes Schluchzen und ein gelegentliches Hochziehen der Nase. Dann hatte er auch noch begonnen, sich mit dieser Orange zu beschäftigen. Wohl eine halbe Stunde lang musste ich mitansehen, wie er sinnlos und selbstvergessen daran herumschabte, ohne auch nur die Schale vom Fleisch zu lösen. Peinlich war es, zu beobachten, wie er sich dabei mit dem Handrücken immer wieder über den offenen Mund fuhr, um den Speichel abzuwischen. Es geschah wohl aus einem kurzen Moment der Schwäche heraus, dass ich mich plötzlich über den Couchtisch beugte und ihm den Dienstausweis drohend vors Gesicht hielt. Es fehlte nicht viel, und ich hätte ihn auch noch beim Kragen gepackt, aber dann dachte ich wieder daran, dass ich mir ja vorgenommen hatte, mich unbedingt und so streng wie nur eben möglich an die neuen Vorschriften zu halten, um so dem Dienstherrn endlich ihren Unsinn zu offenzulegen. Ich ging ans Fenster und streckte den Kopf hinaus in die Dämmerung. Von der Stadt her drang ein dumpfes Trommeln und Wummern durch die Luft. Unten auf dem Gehsteig sah ich einen Mann in Tarnkleidung gehen. Er hatte sich das Gesicht schwarz angemalt und stach mit einem langen Messer auf die Mülltonnen am Straßenrand ein. Potthoff, mein Assistent, drängte sich zu mir ans Fenster und flüsterte mir irgendetwas Unverständliches zu. Zu allem Übel hatten sie mir den nervösen Potthoff an die Seite gestellt. Ich hatte gleich gewusst, dass es ihm niemals möglich wäre, sich auch nur zum Schein an die Vorschriften zu halten, daher hatte ich ihn angewiesen, während des Verhörs bei der Wohnungstür zu warten und meinen Mantel bereitzuhalten. Ausgerechnet in diesem Augenblick musste er die Nerven verlieren. Er wollte gar nicht mehr aufhören, an meinem Ärmel zu zupfen, und als ich ihn beiseite stieß, wagte er es auch noch, sich zu widersetzen. Um ihn nur irgendwie abzulenken, machte ich ihn auf den Mann unten auf der Straße aufmerksam, der womöglich ein Mörder war, aber Potthoff fasste es ganz falsch auf, dass ich mit dem Finger hinaus auf die Straße deutete, und dann geschah es, dass der dumme Potthoff einfach aus dem Fenster sprang. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.
Robin Krick
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Slata Roschal
Ich dachte, dass ich die Stadt verschlingen werde, sie austrinken werde, all ihre Geschäfte, riesige Werbeplakate, endlose, ineinander verwickelte Straßen, das Wirrwarr bunter Gesichter, das Chaos von Babylon, aber sie war es, die Stadt, die mich verschlang. Ich reiste mit einer Tasche an und kehrte mit dreien zurück, ich wollte auf dem Bahnhof Unterwäsche, Pralinendosen, Sushi kaufen, und trug stattdessen sieben antiquarische Bücher und reduzierte Schokolade zweiter Wahl davon. Am ersten Tag nahm ich zwei Kopfschmerztabletten und überlebte bis zum Abend, am zweiten Tag brach ich auf der Straße samt meiner Taschen zusammen und übergab mich. Dann lag ich auf dem Bett eines Bekannten, der mich aufnahm, wälzte mich hin und her und überlegte, was ich falsch gemacht haben könnte, warum mein Körper die Stadt nicht annahm, meine Blutgefäße, meine Schläfen, mein Magen, meine zitternden Hände, sie protestierten gegen die Stadt. Die Stadt war nicht für Menschen wie mich geschaffen, sie war von Menschen gemacht, die kräftige Mägen, starke Hände und breite Schädel hatten, ich war ein Fremder, ein Ausstädter, eine kurzsichtige verwirrte Person vor dem Anzeigentableau der Bahnhofshalle. Ich freute mich zunächst auf die Stadt, wie Rotkäppchen auf ihre Großmutter, ein kleiner Ausflug, eine willkommene Abwechslung, aber der Weg wird lang und immer länger und anstelle der Großmutter liegt ein böser Wolf im Bett und Rotkäppchen läuft wieder zurück nach Hause. Der Wolf ist spannend, eine willkommene Abwechslung, mit ihm könnte man so viel Spannendes machen, sich zu ihm ins Bett legen, den Wein öffnen, seinen Geschichten vom Leben im Wald lauschen, aber Rotkäppchen und der Wolf, das kann nicht gut gehen. So stehe ich auf dem Bürgersteig einer kilometerlangen Straße, stelle mich mit dem Gesicht zur Wand eines Wohnhauses und übergebe mich. Eine phantastische Stadt, die altmodischen Vitrinen, antiquarische Läden, alternative Cafes, vegane Pizzas, türkische Obstläden, vietnamesische Schneidereien, verhüllte Frauen, ich möchte ihnen hinterherrennen und in ihr Gesicht schauen, so schöne Gesichter, so schöne Augen, diese schwarze Ungewissheit über ihren Hüften, sie laufen ihren Männern hinterher, ich laufe ihnen hinterher und verirre mich endgültig, was will ich von ihnen, wo bin ich, wohin will ich. Ich übergebe mich mit dem Gesicht zur Wand, die Stadt wirkt eigentümlich, kaum habe ich sie erfasst, presst sie mich aus und schlägt meinen Kopf gegen die Haustür. Mir ist schlecht, sage ich, mir ist übel, ich kann hier nicht schlafen, ich habe zwei Tage nicht geschlafen, wie soll ich weiterleben, wenn ich nicht schlafen kann, hier möchte ich begraben werden, genau hier, neben dieser Ampel.
Slata Roschal
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Maria Hengge
Geflüstertes Paar
„Treffen wir uns an der Ecke?“ bittet er sie und da stehen sie im Regen unter der Laterne mit Wackelkontakt. Sie leuchten auf und sind wieder im Dunkeln. „Du meine“ flüstert er und wischt sich einen Tropfen von der Nase. Sie nimmt seine Hand: „Lass uns irgendwo reingehen.“ - „Nein, nein!“ Er versteckt seine Hände tief in die Manteltaschen. Im Licht sucht sie seine Augen. Er senkt den Blick. Im Dunkeln umarmt sie ihn. Er löst sich von ihr. Sein Atem schwer. „Was ist denn los?“ - „Nichts, nichts.“ Er raschelt in seinen Manteltaschen. Ihr frieren die Zehen. Sie stehen in einer Pfütze. „Komm, wir gehen ins Trockene.“ Er rührt sich nicht. Eine fremde Stimme murmelt aus ihm: “Wir geben das Haus auf!“ - `Und ich bin schuld` fährt ihr durch den Sinn und setzt sich in ihr Gesicht. Er sucht ihre Wange: “Nein. Das hat mit Dir nichts zu tun.“ Das Licht erlischt. Raschelnd taucht er seine Hände in seine Taschen. „Was hast du da?“ Sein Atem stockt. „Sag mir doch!“ Schwer wiegt er seinen Kopf und seine Augen fliehen „Du meiner!“ flüstert sie und umschlingt ihn zum Kuss. Lange stehen sie so. Aus seinem Mantel zieht sie Briefe heraus. „Sie hat sie gefunden.“ murmelt es aus ihm. Im Dunkeln wird ihr Atem ganz still. „Du musst Geduld haben“ fleht er, doch seine frierende Hand weckt eine Flut in ihr und schwemmt ihn fort. Eine ganze Weile kniet sie in der Pfütze und wäscht Papier. „Hallo“ ruft eine Stimme über ihr. „Hal-lo“ ahmt sie nach und wendet sich müde einem jungen Mann zu. Er reicht ihr die Hand. „Zaza“ stellt er sich vor und seine Geste macht sie lachen. Sie will sich lösen, doch er nennt sie „Sonze“ und zieht sie zu sich heran. `Russisch wie meine Seele` fällt ihr ein. Sie setzen sich auf eine Bank im Park, der längst verlassen ist und blicken auf die schwarzen Bäume. Der Zeit verloren erinnert sie sich an eine Reise. Zazas lange Beine fliegen über den Abgrund. Im Treppenhaus riecht es nach Kirche und er trägt sie hoch bis in ihr Bett. „Du meine“ hört sie ein Echo letzter Nacht. „Komm“ flüstert sie und als Zaza kommt, klingelt ihr Telefon. Nein. Sie ruht an einer anderen Brust. Schwach schlägt sein Herz und ihre Arme knicken um den jungen Mann. Er reißt sie nicht an sich in stürmischer ja flehender Umarmung: „Meine, du meine, verlass mich nie!“ Sein fremder Geruch treibt sie an den Rand ihres Bettes. Morgens birgt Zaza seine Augen hinter einer Sonnenbrille und sucht jemand zu sein, der finster blicken muss. „Peng-peng!“ schießt sie ihn ab. Seine Lippen flüchten über ihre und seine Schritte klatschen im Treppenhaus wie Ohrfeigen. Sie schließt die Tür, das Telefon schweigt und die Buchstaben schwimmen in der Pfütze.
Maria Hengge
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Laurel Eberle
Der Zuckervogel
Eine alte Schaukel hängt an dem Mangobaum draußen vor dem Fenster. Sie erinnert sich, wie sie stundenlang dort saß und das zerschlissene Seil hielt. Der Himmel spannte sich zu einem Dunst aus Lila und Blau. Und aus der Höhe sties ein Zuckervogel auf eine der Früchte, oder er flog zu wild blühenden Allamanden neben dem Haus. Saug den Nektar.
Mädchen spielen in den Vorgärten. Sie kann hören, wie sie klatschen und singen zu "Down Down, Babyâ". Sie kann das Knirschen der Autorreifen auf dem steinigen Asphalt der Uferstraße ausmachen. Sie lauscht dem Zuckervogel.
Down Down Baby, Down by the river side
Sweet Sweet Baby, I'll never let you go...
Vögel fliegen über die singenden Kinder, hienüber zu dem Fenster, wo sie sitzt und wartet. Er kommt zur selben Zeit, tagaus, tagein. Sein Rücken ist schwarz, sein Schnabel gebogen; mit ihm hämmert er wild gegen den Fenstersims. Sie stellt ihm eine Schale Zuckerwasser hin, die er meidet. Viel lieber trinkt er aus ihrer Hand.
Sie schüttet ein wenig Süße in ihre Hand, und das Wasser verrinnt in ihren Lebenslinien. Immer wenn sich ihm zu entziehen beginnt, schreitet der schwarze Vogel mit der gelben Brust ihr frech entgegen.
Er nippt.
Er schluckt.
Schnell verschwindet das Zuckerwasser von ihrer Haut, doch er trinkt weiter. Sie spürt die sich eingrabende Schnabelspitze und versucht ihre Hand wegzuziehen. Heute trägt sie die Bluse, die ihr Tita genäht hat, die mit den Lagenärmeln. Ein davon hat sich verhakt im Fensterrahmen, dessen sonnengetrocknetes Holz leicht brüchig geworden ist. Sie versucht, ihn freizumachen. Plötzlich reißt der Zuckervogel ihre Haut, seinen Schnabel in die Innenseite ihrer Hand bohrend. Schreie. Blut. Es fließt über ihre Hand, rinnt zwischen ihre Finger. Sie bewegt sich nicht mehr. Sie sitzt fest.
Er trinkt.
Er schluckt.
Als er genug hat, fliegt der Zuckervogel davon, sein Magen voll mit Hautfetzen, ihrem Blut; zerschlissen lässt er Hand und Ärmel zurück. Draußen spielen noch immer die Mädchen. Sie wechseln sich ab beim Schaukeln unter dem Mangobaum, aber jetzt singen sie ein neues Lied, eines, dass sie nicht kennt.
Laurel Eberle
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sara Hauser
Der Springer
Ein Mann zog sich einen Spezialanzug an, stieg in einen Heißluftballon und fuhr damit in den Himmel hinauf bis er die Erde nur noch als kleine Kugel sehen konnte.
Dann bekam er Heimweh und sprang aus dem Korb.
Er verfehlte die Erde nur knapp.
Sara Hauser
bereits erschienen in ]trash[pool Nr.6
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Peter Berg
Spieglein, Spieglein
Weshalb ich jenes Foto gelöscht habe, wollte mein Freund Christian wissen, eines der Bilder von unserem letzten Auftritt. Und ich wusste nicht so Recht, was ich darauf antworten sollte. Außer dass, mit zunehmendem Alter, sich der Sinn für Ästhetik weiterentwickelt. Anderenfalls nämlich müsste ich zugeben, dass ich wohl immer hässlicher werde.
Erst neulich habe ich mein Spiegelbild dabei ertappt, wie es näher und näher rückte, so als würde es mich kaum erkennen, als würde es sich wünschen, wir hätten nicht viel gemeinsam. Diese Falten, und diese Augenringe! Und Peter? Wieso hast du eigentlich so eine große Nase? Na weil… Damit ich besser… Nee, keine Ahnung. Ich bin olfaktorisch blind!
„Quatsch,“ sagte mein Freund Christian, „du bist überhaupt nicht hässlich. Jedenfalls nicht direkt. Du bist nur eitel!“
Ich hoffe, er hat Recht. Ich hoffe, ich bin niemand, den nicht mal eine Mutter lieben kann. Der Vorteil der Eitelkeit ist jedoch: Man sucht die Fehler nicht bei anderen.
Deshalb dachte ich vor einiger Zeit, es läge vor allem an meiner Figur. Da mein Sinn für Ästhetik mir jedoch den Kauf einer Jogginghose verbietet, hatte ich stattdessen eine Personenwaage gekauft. Extra große Ziffern und ausgelegt für 180 Kilo. Das sollte genügen, selbst in schweren Zeiten, meint man doch. Allerdings: Die Waage erzielte kaum einen Effekt, ich wurde nicht dünner. Nicht, bis ich die Hauslatschen weg ließ, …nur wenig erniedrigend. Später dann Sweatshirt, Hose, Unterwäsche.
Als ich dann noch zu diskutieren begann, jedes Mal, wenn ich nackt vom Klo kam, vielleicht war es auch schon mehr so eine Art Wimmern: „Komm schon, wenigstens eine Kommastelle!“, habe ich die Waage zurückgegeben.
Man merkt es wahrscheinlich kaum, doch einer der Nachteile der Eitelkeit ist ein leichter Hang zum Selbstmitleid. Ich glaube aber inzwischen auch nicht mehr, dass die Figur eine so große Rolle spielt. Ich meine: Vielleicht ist es ja weniger das Gewicht als das Gesicht. Nur um ganz sicher zu gehen, hatte ich vor einiger Zeit begonnen, mir einen Bart stehen zu lassen. Manche Frauen lieben das, habe ich gehört. Mutter offenbar nicht. Sie erschrak und wollte ihren Sohn nicht einmal umarmen. Wo meine Mutter jedoch nur Faulheit vermutet, fürchtete Vater eine Art Sinneswandel. Ob ich zum Islam konvertiert sei, wollte er wissen. Nun ja, wenigstens die Katze verhielt sich wie immer und fauchte mich an.
Tiere allerdings haben es in dieser Beziehung auch sehr einfach, denn egal ob sie nun pummelig sind oder ein wenig zerzaust: Sie sind eigentlich immer niedlich. Und auch fotogen! Zumindest, wenn es nach meinem Freund Christian geht, dessen Urlaubsbilder stets auch eine kleine Kollektion plattgefahrener Vögel enthalten.
Und ich bin überzeugt, dass Tiere ahnen, wie sie wirken. Vielleicht sind sie nicht unbedingt eitel, sie mögen sich aber selbst, so viel steht fest. Mein fetter Wellensittich etwa, zu albern: Sobald man ihm einen Spiegel vorhielt, begann er zu tänzeln und irgendwelchen Kauderwelsch zu brabbeln.
Beneidenswert, wenn man so unbefangen sein kann, wenn man keinen Sinn für Ästhetik zu haben braucht. Gelegentlich aber hat man selbst auch solche Tage. Das sind jene, an denen man sich zufällig in den Schaufensterscheiben bemerkt, und man sagt zu sich selbst: „He, siehst aber gut aus heute! Die Hose macht doch nicht so fett.“
Dabei wird man vielleicht auch ein wenig übermütig und probiert mal eine neue Gangart aus. Zu albern! Denn hinter einem dieser Schaufenster, an denen man gerade vorbei schlurft, ist ein Café. Gäste hören plötzlich auf, an ihren Getränken zu nippen: War das nicht eben Peter Berg? Sah aus als würde tänzeln und irgendwelchen Kauderwelsch brabbeln.
Wie auch immer. Mein Freund Christian hatte schon am nächsten Tag ein neues Foto hochgeladen. Eines, das mich mit einer pochenden Ader am Hals zeigt, mit Falten auf der Stirn und mit Augenringen. Aber Leute mochten es. Und vielleicht hat er Recht. Vielleicht bin ich ja nur eitel. Damit gleichwohl bin ich nicht allein.
Denn was passierte, als ich die Waage zurück bringen wollte? Zunächst nicht viel: „Umtausch ausgeschlossen!“ Aber die sei kaputt, behauptete ich vor den skeptischen Augen der Verkäuferin.
„Blödsinn.“
„Hier bitte,“ sagte ich, „testen Sie!“
Als dann die extra großen Ziffern zu leuchten und ihre beiden Kolleginnen zu kichern begannen, erhielt ich mein Geld zurück.
„Sie haben völlig Recht, die ist offenbar kaputt!“
Peter Berg
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Roman Wallat
Nancy
Ich tippele auf dem Bürgersteig herum. Allein die Tatsache, von ihr abgeholt zu werden, versetzt mich in Neugierde. Wir wollen zu dritt irgendwohin, mit noch anderen Leuten was machen. Abends `n Bierchen, vielleicht an den See. Ich kenne ihre Freundin.
Sie kommt vorbeigerauscht in diesem roten, alten Volvo. Ich sehe ihr Gesicht, edel, sehr edel, öffne die Autotür und springe hinten in den Wagen hinein. Sie fährt los, und ich weiß nicht, vielleicht haben wir keinen Redestoff, keinen Ansatz, vielleicht ist es aber auch etwas anderes, etwas komplett Entgegengesetztes, wir sind nur ein paar Straßenzüge unterwegs, ein paar vergilbte Häuser, da kommt sie auf die Idee, die Kassette in den Player zurückzudrücken, und ehe ich so richtig schnalle, was hier gerade abgeht, kommt mir von vorn brettlaut Nirvana entgegengedröhnt. Das macht mich nervös. Das elektrisiert mich! Bisher hatte ich diese Dame unter French-Pop abgelegt. Ich meine, ich kenne sie... - vom Sehen!
Ich kurbele das Seitenfenster herunter. Ein Windzug, das Grün der Sommerbäume, Sonne und Schatten im Wechselspiel, ein paar bunt-berockte Mädels auf ihrem Weg ins Kino. Die Luft ist noch warm, es wird wohl keinen Regen mehr geben. Ich blicke nach vorn - und sehe ihre Beine von der Seite. Edel verpackt in eine grüne Lederhose, sehr coole Beine, dazu dieser killende Gesang von Cobain, der sowieso der totale Hammer ist, immer mehr mein Spaß-Bruder...
Ein neuer Song von diesen drei Strand-Typen aus Seattle, diesen natural born Marokkanern, diesen Song-Anarchisten und plötzlich verwischt alles, die Welt vibriert, draußen ist es heiß, brüllend heiß, das ist für sich gut, es gibt auch nichts mehr zu erreichen, alles quasi in cosmischer balance, die junge Dame da vorn ist vielleicht außer Reichweite, aber das ist alles egal, totally equality, ich habe Lust, mir jetzt sofort ein Bierchen zu köpfen oder auf dem Rücksitz herumzuhüpfen wie ein Verrückter - scheiße, ich komme mir vor wie ein willkommener Außenstehender. Und blicke mal wieder nach vorn. Schwarze Haare, blasse, lange Wangen, geschwungener roter Mund. Eine Französin. Und was macht sie? Sie summt mit den Jungs mit. Elegant, dunkel, schön und sexy. Ich werde wieder unruhiger.
Wir kommen an einer Ampel vorbei, sie fragt mich, ob mir die Musik gefällt, ich sage ja, klar. Ihr Haarspray liegt in der Luft. Wir kurven weiter durch den Sommerabend. Dann kommen wir zu der Wohnung unserer Freundin.
Das war's dann erst mal.
Roman Wallat
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jörn Birkholz
Mit den Augen meines Bruders
Seine Wohnung roch wie immer muffelig. Ich ging, oder kämpfte mich durch die Zimmer. Überall lagen Sachen herum, zumeist Bücher, Zeitschriften oder Papier, dazwischen Geschirr mit eingetrockneten Essensresten. Knapp zwanzig Jahre hatte er hier gehaust. In dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im fünften Stock eines Sozialbaus. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr besucht, die Kinder auch nicht. Er hatte seine Nichten bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. So hatte er nicht mal mehr mitbekommen was für verwöhnte, gelangweilte und Smartphone abhängige Teenager sie inzwischen geworden waren. Und trotzdem konnten sie mich jederzeit um den Finger wickeln. Ein Vater kann eben nicht aus seiner Haut. Es war alles Monikas Schuld; irgendjemandem muss man ja schließlich die Schuld geben. Monika wollte nicht mehr, dass er uns besuchte, und ihn besuchen wollte sie schon gar nicht. Sie war nie besonders gut mit meinem Bruder zurechtgekommen, besonders nicht in den letzten Jahren, in denen er sich immer mehr zurückgezogen hatte. Die Grillparty vor sechs Jahren – das letzte Mal, als er bei uns gewesen war – wäre beinahe in einer Katastrophe geendet. Nicht nur, dass er beim Feuermachen beinahe die Terrasse abgefackelt hätte, er hatte die Mädchen später auch noch erfolgreich zum Weintrinken animiert, und dabei waren die beiden damals gerade mal sechs Jahre alt gewesen. Zoé übergab sich die ganze Nacht über, und wir (hauptsächlich Monika!) hatten sogar überlegt, den Notarzt zu rufen.
Dein Bruder betritt unser Haus nie mehr, schrie Monika außer sich. Ich musste es ihr versprechen, was nicht so schwierig war, denn Moritz verlangte es nicht danach wiederzukommen. Er fand meine Töchter gewöhnlich, und Monika hielt er für kalt und begrenzt. Er brauchte es mir nicht mal zu sagen. Ich sah’s an seinem Blick. Der Blick sagte alles, und er verletzte mich. Dieser Blick verletzte mich deshalb so sehr, weil ich wusste, dass Moritz nicht ganz falsch lag. Und leider lag er sehr selten falsch. Außer in seinem eigenen Leben. Für mich war es immer ein Rätsel geblieben, wieso er aus seinem Potential nichts gemacht hatte, außer dieser dämlichen Schreiberei, die ihm in knapp dreißig Jahren wahrscheinlich weniger als tausend Euro eingebracht hatte.
Werd doch Journalist, wenn’s mit deinen Texten nicht so richtig läuft, schlug ich ihm einmal vor.
Er lachte bloß und sah mich mitleidig an, obwohl doch eigentlich ich ihn so hätte anschauen sollen.
Was bringen dir deine vier Buchveröffentlichungen, wenn die Dinger kaum ein Mensch liest, provozierte ich ihn weiter. Wie zum Teufel willst du davon leben?
Wieder lächelte er bloß nachsichtig und entgegnete, und das in keineswegs herablassendem Ton:
Bruder, es würde mich ehrlich freuen, wenn du leben würdest, und wenn’s nur mal einen Tag lang wäre.
Seine Überheblichkeit – die gar keine Überheblichkeit war, was ich aber erst kürzlich begriffen hatte – machte mich rasend.
Dann leb doch wie ein Penner, bellte ich weiter, inmitten all deiner Bücher und Zeitschriften, wenn dich das glücklich macht, bitte, aber lass uns in Frieden.
Um ehrlich zu sein, ließ er uns in Frieden. Nie hätte er uns belästigt, oder um irgendwas gebeten, er kam zurecht, wenn es sein musste, aß er eben mal zwei Tage kaum etwas. Ständig stand er im Konflikt mit dem Jobcenter, das ihm in stumpfer Regelmäßigkeit Maßnahmen wie Pizzakurier, Straßenkehrer oder Zeitungsausträger aufzwingen wollte, worauf mein Bruder seinem Fallmanager jedes Mal ins Gesicht lachte, oder ihn mit Eichmann verglich, was ihm, neben den Sanktionen, auch noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung eingebracht hatte.
Ich musste mir eingestehen, dass ich meinen Bruder gar nicht aus Schuldgefühl besuchte, sondern nur darum, weil es mir damals unangenehm war, einen jüngeren Bruder zu haben (ich war ein Jahr älter als er), der wie ein Aussteiger oder Penner lebte. Schließlich wohnten wir in einer Kleinstadt, jeder kannte jeden. Monika hatte sich mehrfach wütend bei mir beschwert, dass sie beim Einkaufen oder beim Friseur darauf angesprochen worden war, dass mein Bruder mal wieder betrunken singend durch die Einkaufspassage oder über den Marktplatz getorkelt war. Dabei war er kein Alkoholiker, er trank wahrscheinlich sogar deutlich weniger als jedes durchschnittliche Mitglied im Schützenverein. Nur wenn, dann lebte er es aus, und die Menschen, die ihn dabei beobachteten scherten ihn einen Dreck. Gelegentlich musste ich ihn auch bei der Polizei abholen, wenn sie ihn mal wieder irgendwo aufgelesen hatten. Widerstandslos hatte er sich dann immer abführen lassen, und brav die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Monika war jedes Mal vollkommen außer sich gewesen, und verbat mir zukünftig ihn da raus zu holen, was ich natürlich doch wieder tat und was dann meist einen heftigen Streit mit ihr nach sich zog. Aber was sollte ich machen, er war schließlich mein Bruder. Im Stillen bewunderte ich ihn, obwohl ich niemals so hätte leben können. Schon gar nicht ohne Frau, auch wenn ich letztendlich nur so ein schlichtes Exemplar wie Monika ergattert hatte. Er hatte ja immerhin ein paar Jahre seine Sophie gehabt – wenigstens das. Die beiden waren unzertrennlich gewesen und das nicht mal auf unangenehme Weise. Bis sie schließlich einer Hirnhautentzündung erlag - aufgrund eines lächerlichen Zeckenbisses! Danach waren Frauen für ihn kein Thema mehr gewesen. Aber auch Monika hatte ihre guten Seiten; sie mochte Sex, wenn auch heutzutage nicht mehr so stark, wie, bevor die Kinder kamen. Aber Sex ist ja nun einmal das zentrale Bindeglied einer Ehe, da wird mir keiner was anderes erzählen. Und derjenige, der das tut, belügt sich selbst. Mir war schon damals klar geworden, dass ich das, was Moritz und Sophie miteinander verband - diese Art von Intensität - mit Monika niemals würde erreichen können. Aber was soll’s, und was lohnt es sich darüber nachzugrübeln; Sophie war jetzt bereits seit neun oder sogar zehn Jahren unter der Erde, und Monika erfreute sich noch immer bester Gesundheit. Selbiges galt für ihre Hirnhaut, denn Zeckenbisse hatte sie in den letzten Jahren unzählige gehabt. Kein Wunder, so viel wie sie immer in unserem Garten herumwuselte.
Schreibst du eigentlich auch Lyrik hatte ich ihn einmal gefragt.
Bist du wahnsinnig, so tief würd ich niemals sinken, hatte er lachend geantwortet.
Mir war es im Grunde ganz gleich, was er schrieb. Auch Monika hatte sich nie für die schriftstellerischen Ergüsse meines Bruders interessiert. Dazu war ich mir sicher, dass sie sie abgelehnt hätte, obgleich ich zugeben muss, dass auch ich mir nicht sicher war, ob sie mir gefielen. Sie waren mitunter sehr derb, wenn auch teilweise witzig und oft mit feinen Beobachtungen gespickt, aber was versteh ich schon von Literatur.
Zu glauben, Literatur zu verstehen oder eben nicht, ist lächerlich, sagte er einmal. Jeder glaubt sie ohnehin nur aus seiner eigenen begrenzten Glasblase heraus zu begreifen. Müßig sich darüber den Kopf zu zerbrechen, also lass es am besten.
Ich ließ es. Und auf meine Frage wie viele Exemplare er von seinen Romanen verkauft hatte, entgegnete er auch immer nur dasselbe.
Keine Ahnung, frag meinen Verlag.
Das war unser Running Gag, wenn ich ihn besuchte und das fragte. Sein Verlag war vor einigen Jahren in Konkurs gegangen. Sie hatten ihn sogar um die letzten fälligen Tantiemen beschissen, aber Moritz war das vollkommen egal. Geschriebene Bücher gehörten für ihn ohnehin zur Vergangenheit, genau wie das Frühstück, über das sich am Abend auch kein Mensch mehr Gedanken macht. Selbiges galt für den Abverkauf seiner Bücher. Es war ihm Scheißegal. Ich konnte es manchmal selbst kaum glauben. In seiner Wohnung lagen auch dutzende, mitunter total verstaubte Literaturzeitschriften herum - mit so hochtrabenden Namen wie „Perspektive“, „Am Erker“, „Akzente“, „Das gefrorene Meer“, oder „Sinn und Form“ in denen er mal etwas veröffentlicht hatte. Nachdem ich erfahren hatte, dass fast keine davon ihren Autoren auch nur einen Cent bezahlt, und man lediglich ein oder zwei dämliche Freiexemplare bekommt, hätte ich die Teile am liebsten in den Müll geworfen.
Mach doch, wenn du willst, hatte mein Bruder mich immer wieder ermuntert, aber dafür war ich dann doch zu faul.
Es gibt sowieso zu viele Zeitschriften, fügte er noch hinzu, genau, wie es zu viele Autoren, Banker, Anwälte und dämliche Politiker gibt, und die meisten davon sind genauso nutzlos und überflüssig wie ich es bin.
Warum machst du es dann?
Ich wüsste nicht was ich sonst machen sollte, antwortete er trocken, es schirmt mich ab gegen den Schwachsinn und die Borniertheit da draußen.
Gott ist das staubig hier, dachte ich, als ich weiter durch seine Wohnung latschte. Abermals nahm ich mir willkürlich einen seiner Texte zur Hand, die überall in der Wohnung verstreut herumlagen. Einige handschriftlich, einige am Computer geschrieben. Die Handschriftlichen konnte ich kaum entziffern, und die in den Computer gehämmerten erschlossen sich mir nicht immer. Vielleicht waren es unvollendete Entwürfe, aber womöglich war ich jetzt einfach nicht in der Stimmung seine Arbeiten zu lesen.
Mein Bruder fehlte mir, obwohl ich ihn vor dem Unfall seit knapp einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Es hatte mir immer genügt zu wissen, dass er da war. Was mach ich bloß mit seinem ganzen Kram? Seinen Verlag gab es ja nicht mehr, wem sollte ich es dann schicken, einem anderen Verlag, und wenn ja, welchem? Oder es vielleicht doch alles in ein paar Kartons stopfen und erstmal bei uns im Keller lagern - Monika würde sich freuen - oder einfach alles wegschmeißen. Dieser Idiot! Konnte er nicht besser aufpassen, wenn er über die Straße latscht. Heißt es nicht, Betrunkene und Kinder haben einen Schutzengel. Im Grunde war Moritz doch sogar beides, aber wo zum Teufel war sein verdammter Schutzpatron gewesen, der ihn sicher hätte auf die andere Straßenseite bringen müssen. War wohl nix. Man konnte ihn nicht mal mehr identifizieren, nachdem der Laster über ihn gebrettert war. Nur noch ein Haufen Autorenmatsch war übrig. In diesem Zustand konnte er Sophie im Himmel wohl kaum unter die Augen treten. Sie würde sich mächtig erschrecken. Was denke ich hier eigentlich für einen Unsinn? Verdammt mein Bruder fehlt mir.
Ich schlenderte weiter durch die Wohnung. Gott, ist die Luft hier staubig, meine Nasennebenhöhlen drehten schon durch. Ich holte mein Taschentuch raus. Scheiße, heute ist Mittwoch. Zoé muss ja zur Nachhilfe. Morgen ist die Klassenarbeit. Wenn ich sie da zu spät hinbringe, macht Monika mir wieder die Hölle heiß. Was soll’s, sonst findet sie einen anderen Grund, Gründe findet sie ja immer. Ich will noch ein bisschen hierbleiben, auch wenn die stickige Luft hier kaum auszuhalten ist. Vielleicht sollte ich endlich mal ein Fenster aufmachen. Egal, ich muss sowieso gleich los, bin eh schon viel zu spät. Er fehlt mir, der verdammte Mistkerl, und doch hätte ich niemals mit ihm tauschen wollen, oder vielleicht doch - vielleicht wenigstens mal für einen Tag.
Jörn Birkholz
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT Spezial | Elvira Santos
Ostergeschichte
In allen Farben präsentierten sich die Schokoladenostereier in dem winzigen Schaufenster des Ladens von Dona Maria: blau, rosa, rot, weiß, lila, grün, gelb, nur nicht schwarz. Die schönsten waren so riesig, dass das kleine dunkelhäutige Mädchen sie nicht in einer Hand halten konnte. Die kleinen Eier aber waren so groß wie das Hühnerei, das sie morgens noch ganz warm aus dem Stall geholt hatte. Es schmeckte gut, vor allem als Spiegelei mit einem Dotter, der so glänzte wie die Mittagssonne.
Das kleine Mädchen lachte das große in Gelb eingepackte Ei im Schaufenster an, wo sie auf dem Rückweg von der Schule vorbeikam. Morgens um sieben, wenn sie zur Schule ging, waren die Ostereier hinter einem Rollladen versteckt. Wenn der Unterricht beendet war, rannte das Mädchen aus der Schule, damit sie mehr Zeit hatte, ihr Osterei zu betrachten, bevor das Geschäft zur Mittagspause schloss. Die alte Ladenbesitzerin mit dem strengen Gesicht fragte nicht, ob das Mädchen etwas wollte. Von draußen konnte niemand die Eier stehlen, denn sie standen hinter einem Glasfenster, so dass nur Dona Maria sie mit ihrer großen Hand erreichen konnte. Das Mädchen ging weiter. Die Mutter wartete auf sie, um ihr ein Spiegelei zu braten.
„Hast du wieder vor dem Schaufenster gestanden?“ Das Mädchen ließ sich auf den Küchenstuhl fallen und nickte. Die Mutter stellte einen Teller vor sie auf den Tisch. Der Dampf von Reis und schwarzen Bohnen stieg ihr ins Gesicht. Die Pfanne mit dem heißen Fett stand auf dem Herd. Die Mutter nahm ein Ei aus einem Korb der wie ein Huhn geformt war. Da rief das Mädchen: „Nein, Mama! Bitte nicht!“ „Was? Willst du heute kein Spiegelei?“ „Doch, aber ich könnte stattdessen jeden Tag ein Ei verkaufen. Es sind noch drei Wochen bis Ostern.“ „Ja, aber mit dem Geld könntest du gerade einmal ein Ei so groß wie eine Kirsche kaufen.“ Die Mutter hielt das Ei in der Hand. „Wem willst du es denn verkaufen?“ Das Mädchen ließ den Kopf sinken.
Am folgenden Tag holte das Mädchen ein Ei aus dem Stall, wickelte es sorgfältig in Brotpapier und nahm es in ihrem Ranzen mit zur Schule. Als es zur Pause schellte, wartete sie, bis ihre Mittschüler fort waren. Dann ging sie zum Lehrertisch und blieb stehen. Die Lehrerin saß dort und schrieb konzentriert im Klassenbuch. Nachdem sie das Buch geschlossen hatte, berührte das Mädchen die linke Hand der Frau, legte das ausgepackte Ei hinein und blieb wortlos stehen. „Ah! Meine Liebe!“, sagte die Lehrerin und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Eilig lief das Mädchen hinaus. So geschah es jeden Tag in der Pause. Das Mädchen blieb sitzen und wartete, bis alle Mitschüler den Raum verlassen hatten, holte ein Ei aus ihrem Ranzen, ging zum Lehrertisch, blieb stehen und hielt es der Lehrerin wortlos hin.
Am Mittwoch vor Ostern bekam die Lehrerin das letzte Ei. Wie immer bedankte sie sich mit einem Kuss auf die Wange, und das Mädchen verschwand still in die Pause.
Nach der Schule blieb sie wieder am Ostereierfenster stehen. Es standen nur noch ganz wenige Eier dort, aber ihr gelbes Schokoladenei glänzte wie die Sonne.
„Hast du schon das Geld für dein Osterei?“ „Nein, Mama. Meine Lehrerin hat mir noch nichts bezahlt.“ Sanft klopfte ihr die Mutter auf die Brust. Aus dem Teller stieg der Dampf von Reis und schwarzen Bohnen dem Mädchen ins Gesicht. Sie aß schweigend.
Am Ostersonntag Morgen, als das Mädchen die Küche betrat, stand ein großes eiförmiges Gebilde, glänzend wie die Sonne, auf dem Tisch. Die Ananasblätter schauten aus der Verpackung heraus.
Am ersten Schultag nach Ostern, als die Kinder in die Pause gingen, blieb das Mädchen sitzen. Die Lehrerin schrieb etwas ins Klassenbuch. Dann holte sie unter ihrem Tisch eine große Papiertüte hervor, lief zu dem Mädchen und überreichte sie ihr. Das Mädchen musste aufstehen, um das Köpfchen in die Tüte stecken zu können. Sie entnahm ihr ein in Gelb eingepacktes Schokoladenei. Es war so groß wie eine Ananas.
Elvira Santos
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Friedrich Bastian
Tag der Toten
Die Musiker drücken sich aneinander, um eine Gruppe Passanten vorbeizulassen. Der Pfad, auf dem sie stehen, ist schmal, eigentlich zu schmal, aber es gibt keine andere Möglichkeit, keinen anderen Platz, der es ihnen erlaubt ihre Lieder vorzutragen. Sie versuchen sich nicht von der Enge beirren zu lassen, die Passanten geben sich Mühe, nicht gegen sie zu stoßen. Trotzdem ist es schwer auf so kleinem Raum zu spielen. Hin und wieder treffen Ellbogen aufeinander, werden Entschuldigungen gehaucht und verlegene Blicke getauscht. Die Trompeten hätten gern mehr Freiheit, ebenso die dickbäuchige Gitarre mit ihren großzügigen Rundungen. Die Musiker erdulden die Unannehmlichkeiten, indem sie die Augen schließen oder in die Ferne schauen, während sie ihre Instrumente spielen. Sie geben sich Mühe, die Enge nicht zu bemerken, sie nicht zu sehen. Gemeinsam mit der Musik fliegen ihre Blicke Über die Köpfe der Leute, nur ihre Körper lassen sie zurück in der Menge. Auf diese Art ist es leichter, so können sie besser in die Lieder eintauchen und das Gedränge ignorieren. Nur der Sänger hat mehr Platz, an ihn trauen sich die Leute nicht so nah heran. Er muss seine Arme bewegen können, wenn es dramatisch wird, muss einen Schritt vor oder zurück machen können, wenn ihn die Emotionen Übermannen. Darin will ihn niemand stören.
Der Fluss der Passanten nimmt kein Ende, es wimmelt um die Musiker wie in einem Ameisenhaufen, es kommen immer mehr Besucher und niemand scheint zu gehen. Die meisten verbringen den gesamten Nachmittag und Abend hier, bringen ausreichend Verpflegung mit. Manch einer trägt einen ausklappbaren Hocker unter dem Arm.
Die Trompeten erklingen. Mehrere Leute drehen sich nach ihnen um. Sie sind laut und schrill, Übertönen die anderen Instrumente, den Lärm der angrenzenden Straße und das Gerede der Massen.
An diesem Tag sitzen die Vögel weder auf den Mauern noch in den Bäumen. Sie warten auf den kahlen Feldern, bis es ruhiger wird und sie zurückkehren können. Die Bäume stehen starr und dürr dabei, ihre Äste leer. Der Wind mag sie nicht schaukeln oder beugen, er lässt sie ungestört zusehen. Außerdem fürchtet er sich ein bisschen, wagt es nicht, sich in das Durcheinander einzumischen oder die Leute wegzutragen.
Die Menschen liegen sich in den Armen, klopfen sich auf die Schultern, drücken sich aneinander. Gemeinsam erinnern sie sich, graben alte Geschichten hervor, um sie noch einmal zu erleben mit denen, die darin vorkommen. Noch einmal zusammen sein. Noch einmal das Vergangene mit dem traurigen Jetzt vertauschen. Mut sprechen sie einander zu, jemand macht einen Witz, weil mit Spaß alles leichter zu ertragen ist. So mischt sich Lachen in die Trauer. Schön und schaurig ist die Welt auf dem Friedhof.
Der Sänger gibt den Ton an, mit fester Stimme und großer Brust singt er Über die Mühen der Hinterbliebenen. Wie sie ihren Alltag neu besorgen, versuchen das leere Haus zu füllen und beim Essen einen Teller weniger auf den Tisch stellen. Wie sie die Toten nicht vergessen und doch vergessen müssen. Es schmerzt, trotzdem geht es weiter. Seine Stimme gibt Hoffnung, ihre Kraft hält für einen Moment alles zusammen und lässt die Leute aufatmen. Ein alter Mann kann sich im Gedränge nicht auf seinen Gehstock stützen, er verliert das Gleichgewicht und stößt gegen die dickbäuchige Gitarre. Schrille Töne mischen sich unter die Musik, aber sogleich helfen zwei hochgewachsene, junge Burschen dem Alten, ziehen ihn in ihre Mitte, weg von den Musikern und ihren Instrumenten, entschuldigen sich mit einem Grinsen und einem Lob für die Lieder, die bestens zum Tag der Toten passen.
Die Hände meiner Schwägerin greifen mich bei der Häfte, wollen mich zu der Musik bewegen. Sie möchte tanzen oder eine Polonaise anfangen. Das überrascht mich, starr wie ein Stein bleibe ich stehen und schaue sie an. Das habe ich nicht erwartet. Es scheint mir der falsche Ort, die falsche Situation für einen Tanz zu sein. Verwundert blicke ich in ihr hübsches Gesicht. Ihre Augen sind rot, glasig. Sie hat viel geweint, ist erschöpft vom Singen und den vielen Umarmungen, die nicht aufhören wollen und mit jedem Mal schwerer werden. Ihr Blick verrät Müdigkeit, aber sie gibt sich Mühe, zieht den Mund breit und hoch zum Grinsen. Keine Traurigkeit, keine Erschöpfung. Zwischen fröhlich und traurig kann man wählen oder es zumindest versuchen. Sie lacht kurz auf, greift in einen Rucksack, der auf dem Boden steht, und holt eine neue Flasche hervor. Ich lache auch.
Mehr Tequila!, Auf unseren Großvater!, Auf unsere Großmutter!, ruft sie und stößt ein Glas hinunter, dann legt sie einen Arm um mich, dreht ihr Gesicht weg von ihrem Mann, der zu uns hinüberschaut. Ich halte ihr mein Glas vor und sie fällt es mit Tequila auf. Sie hat schon zu viel getrunken, aber heute trinken alle zu viel. Wer nicht trinkt, hat kein Herz. Man kann nur zu wenig, aber nicht zu viel trinken. Auf dem Boden zwischen den Gräbern liegen die leeren Flaschen. Noch einen Schluck! Auch die Toten wollen trinken, auch sie freuen sich, dass wir alle zusammenkommen.
Kräftig ertönen die Stimmen der Mariachi-Musiker. Sie ziehen die Worte bis zur Unkenntlichkeit lang, im nächsten Moment können sie reißen und alle Umstehenden niederbrechen. Das Kreischen eines Hahns ist von jenseits zu hören, von der anderen Seite der Friedhofsmauer. Am Grab neben uns weint, schluchzt eine Großfamilie. Insgesamt vierzehn Personen. Jeder stellt Blumen und Kerzen auf das Grab, damit es schön leuchtet. Der weiße Stein ragt hervor, ruhig und standhaft inmitten der grellen Farben und Töne.
Mein Vater Pedro Páramo trank viel und schlug meine Mutter, flüstert meine Schwägerin in mein Ohr. Ihr Mann schaut noch immer zu uns hinüber, drückt die Augen zusammen und verzieht den Mund. Sie umarmt mich. Ich habe ihn trotzdem geliebt und vermisse ihn schrecklich, sagt sie und legt ihren Kopf auf meine Schulter.
Die Trompeten krachen erneut durch die Luft. Die Mariachis schreien auf, wir fallen ein. Für einen Moment vibriert die Luft in der Lunge zusammen mit der Luft über den Gräbern. Sie ist kalt, schmerzt und belebt. Ein Stechen in der Brust drängt hinaus, die Geige zieht es lang, die Trompeten ziehen es fort. Es werden Blumen in die Luft geworfen, die Blumen der Toten, ihre Blüten brechen in der Luft auseinander, gehen gelb orange auf uns nieder.
Sei nicht so ernst, nimm noch einen Schluck und bring nächstes Mal deine Verwandten mit, wir wollen mit ihnen singen und feiern. Der Tequila brennt in mir, in meinem Mund und Hals, in meinem leeren Magen und leerem Kopf. Warm und matt ist er. Ich schaue mich um, will sehen, wer mir zuredet. Aber niemand beachtet mich, niemand spricht mit mir. Mir ist schwindelig, deshalb atme ich kräftig ein und aus, versuche an nichts zu denken. Mein Magen knurrt. Nimm die Hand von meiner Tochter, sie ist verheiratet, sagt er, oder ich bringe dich um.
Die dickbäuchige Gitarre setzt ein, gesellt sich zu den Trompeten und versucht etwas Ruhe zu verbreiten, versucht die Wogen der Aufregung zu glätten, aber die Stimme des Sängers überschlägt sich im Angesicht der Trauer und macht alle Bemühungen der Gitarre zunichte. Mit ungestümer Hingabe wirft der Sänger die Arme in die Höhe, lässt sie wie Luftschlangen umherfliegen. Seine Augen sind geschlossen, sein Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse. Mit den Armen will er die Welt umarmen oder befreien. Dabei schlägt er einer dicken Frau ins Gesicht, die zu nah bei ihm steht und sich nicht vor ihm in Acht nimmt. Die Dicke ist wütend, will sich beschweren, will den Sänger anschreien und an seinem glänzenden Anzug ziehen, aber niemand beachtet sie und so wird sie im Strom der Menge einfach hinweg getragen.
Feuerwerk mit viel Krawall und Rauch donnert über uns und für einen Moment hört man die Mariachis nicht, man zuckt zusammen und schaut um sich. Die Mütter, Töchter, Witwen heulen wie Verrückte, die Männer jammern und trinken, als müssten sie sich in die Gräber legen und dürften sich nie wieder gehen lassen. Der Wind ist noch stiller als zuvor, erschrocken wie ein kleines Kind.
Friedrich Bastian
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at