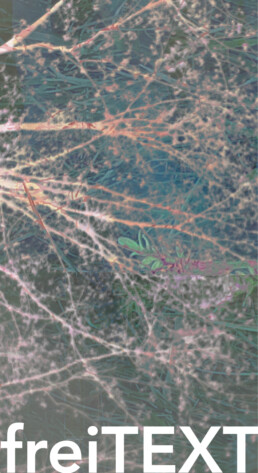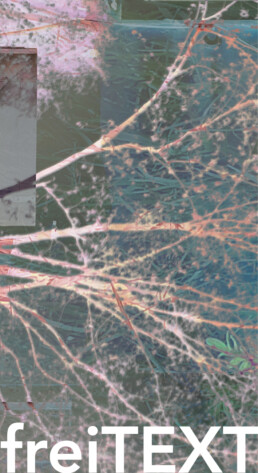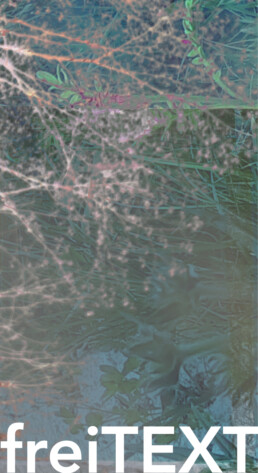freiTEXT | Peter Zemla
Der Schrank
Entschuldigen Sie, dass ich flüstere. Aber sie ist gerade an meiner Schulter eingeschlafen. Sie atmet so gleichmäßig und tief, dass ich sicher auf Ihr Verständnis zählen kann, wenn ich diesen Zustand nicht unnötig gefährde. Zwangsläufig dringt meine Stimme durch die geschlossene Schranktür nur gedämpft nach außen. Wenn ich, was ich zu sagen habe, nun auch noch in reduzierter Lautstärke vorbringe, muss das für Ihre Aufnahmebereitschaft eine besondere Anstrengung bedeuten. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie eine solche Anstrengung auf sich nehmen. Nicht jeder würde für einen in den Schrank Zurückgezogenen solches tun. Es wäre nur allzu verständlich, wenn der draußen Stehende, der sein Ohr gegen die Schranktür presst, abwinkt und dann eben nicht sagt und davongeht. Sie gehören nicht zu diesem Schlag Mensch. Sie haben Verständnis.
Was mich zu dieser Annahme veranlasst, mögen Sie sich fragen. Ich weiß, dass Sie wissen, dass ich das Schlüsselloch in der Schranktür mit einem Papiertaschentuch ausgestopft habe. Ich kann Sie nicht sehen, nicht einmal Fragmente von Ihnen. Wie also soll ich jemanden einschätzen, den ich noch nie gesehen habe? Ich versichere Ihnen, dass es weitaus verlässlichere Beurteilungskriterien gibt als die vom Augensinn gelieferten Daten.
Möglicherweise ist das ein Grund, warum ich mich in den Schrank zurückgezogen habe. Möglicherweise habe ich geahnt, mehr intuitiv gespürt als gewusst jedenfalls, als ich in den Schrank hineingegangen bin, als ich mich dem Schrank anvertraut habe, dass im Schrank andere Voraussetzungen herrschen als außerhalb des Schrankes. Dass, was ich im Schrank vorfinden werde, mir gemäß sein wird. Dass ich gewissermaßen aufleben kann im Schrank, was mir außerhalb des Schrankes nicht möglich gewesen ist.
Und dabei, das möchte ich betonen, habe ich nicht ansatzweise daran gedacht, als ich mich entschlossen habe, in den Schrank zu gehen, im Schrank jemanden vorzufinden. Wenn man sich entscheidet, in den Schrank zu gehen, damit Sie mich richtig verstehen: nicht den Schrank zu öffnen und etwas im Schrank Verwahrtes herauszuholen, sondern sich selbst im Schrank zu verwahren, rechnet man nicht mit dergleichen. Zum einen ist man mit der eigenen Entscheidung, einer weitreichenden, wie Sie sich vorstellen können, vollumfänglich beschäftigt. Zum anderen ist es ja schon abwegig genug, sich selbst in den Schrank zu begeben, wie abwegig erscheint es da erst, dass bereits vor einem jemand diesen Schritt getan haben soll. Das will einem nicht in den Kopf. Und weil es nicht Inhalt des Kopfes gewesen ist, dieser Gedanke ein gänzlich ungedachter gewesen ist, verstehen Sie, hat er zwangsläufig keinerlei Rolle gespielt.
Wichtig ist einzig die Abschätzung gewesen, ob es zu wagen sei, ob ich es mir zutrauen darf, in den Schrank zu gehen. Natürlich habe ich mir gesagt, du kannst es versuchsweise wagen. Du kannst in den Schrank gehen, dort verbleiben und dann den Schrank wieder verlassen. Du kannst, wer sollte dich daran hindern, habe ich mir gesagt, so naiv bin ich gewesen, Urlaub im Schrank machen und, wenn der Urlaub beendet ist, zurückkehren in die Gewöhnlichkeit. Das Risiko ist ein überschaubares, habe ich mir gesagt. Es wäre folglich nur leichtes Gepäck vonnöten, habe ich mir gesagt. Noch andere Dinge habe ich mir gesagt, Beruhigendes, den Puls und den Strudel im Hirn gleichermaßen Bändigendes.
Doch als ich dann hineingegangen bin, als ich die Schranktür hinter mir zugezogen habe, ist mir unverzüglich klar gewesen, dass ich dergleichen nicht gebraucht hätte. Alle Versicherungen und Absicherungen sind unnötig gewesen. Im Schrank, als ich mich an die Rückwand gekauert habe, als ich zwischen den Wintermänteln und unter den Herbst- und Winterjacken mich niedergelassen habe, die Schals und Mützen und Handschuhe beiseite geschoben habe und es mir zwischen all der für die kälteren Jahreszeiten weggeräumten Garderobe bequem gemacht habe, hat Frieden geherrscht. Ruhe hat geherrscht, eine allgemeine, vielleicht von den Mänteln und Jacken und Mützen ausgehende Dämpfung. Eine Ruhe, wie ich sie mir im Vorfeld meines Rückzuges in einer ungefähren und abstrakten Ausformung vorgestellt und ausgemalt und unter Umständen sogar ersehnt, wie ich sie aber tatsächlich vorzufinden nicht zu hoffen gewagt habe.
Die Chance, eine Ruhe, etwas in diese Richtung Tendierendes, im Kellerschrank zu finden, sollte höher sein, habe ich gedacht, als im Schlafzimmerschrank. Ginge ich in den Schlafzimmerschrank, müsste ich damit rechnen, dass meine Frau jederzeit die Tür des Schlafzimmerschrankes aufreißt, nicht um mich zu suchen, aber um etwas aus dem Schlafzimmerschrank zu holen, ein Handtuch, ein T-Shirt, eine Hose, und vorbei wäre es mit der Ruhe, habe ich gedacht. Nein: Ich habe das nicht gedacht, all das habe ich nicht wirklich gedacht. Ich habe nicht so weit gedacht, aber unbewusst habe ich dergleichen wohl erwogen. Weshalb ich mich für den Kellerschrank entschieden habe, als es soweit gewesen ist, in den Schrank zu gehen.
Als ich drin gesessen bin, nach zwei, drei Minuten bereits, habe ich gewusst, dass diese Wahl die richtige gewesen ist. Überhaupt habe ich mit einem Mal gewusst, dass alles das Richtige ist. Obwohl zugegebenermaßen nicht die beste Luft herrscht im Schrank, habe ich aufgeatmet. Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich das getan. Ich habe gewissermaßen die Ruhe eingesaugt in meine Lungen und bin selbst ganz ruhig geworden. Eine Zeitlang habe ich noch an der Schranktür gehorcht. Ich habe geglaubt, entfernt Schritte zu hören, die tapsigen Schritte meiner Frau, die polternden Schritte meiner Tochter. Ganz weit entfernt habe ich geglaubt, jemanden, meine Frau, meine Tochter, eine von beiden, etwas rufen zu hören, was ich aber nicht habe verstehen können. Wahrscheinlich hat es sich um eine Bagatelle gehandelt, um eine Zwecklosigkeit, um ein Rufen, das nur um des Rufens willen gerufen wird. Bald schon habe ich nicht mehr gehorcht. Selbst wenn jemand, meine Frau, meine Tochter, noch gerufen hätte, hätte ich es nicht mehr gehört.
Spätestens nach meinem ersten Tag im Schrank habe ich nichts mehr gehört, was außerhalb des Schrankes vor sich gegangen ist. Irgendwann habe ich mir eingebildet, die Haustür zu hören, den Schlüssel sich drehen zu hören im Haustürschloss, was aber eine akustische Unmöglichkeit ist. Alles, was von außen hereindringen könnte zu mir, wird durch die im Schrank herrschende Leere atomisiert, verströmt in der Leere. Man könnte sagen: Es wird nichtig. Denn so paradox es auch klingen mag: Obwohl der Schrank mit Mänteln und Jacken, mit Mützen und Schals gefüllt ist, herrscht in ihm eine Leere, die ich zuvor nicht für möglich gehalten hätte und die als eine vollkommene bezeichnet zu werden verdient. Nach drei, vier Tagen im Schrank ist mir klar geworden, dass seine vollkommene Leere das Besondere des Schrankes ausmacht. Die vollkommene Leere ist es, die den Schrank wertvoll werden lässt. Wenn ich etwas herauspule aus meiner Nase, meinen Ohren, etwas aus den Winkeln meiner Augen herausschabe, ich weiß nicht was, etwas eben, dann hört es, unmittelbar nachdem ich es aus mir herausgepult habe, auf, etwas zu sein. Alles im Schrank hört auf, etwas zu sein. Wie tröstlich diese Erkenntnis gewesen ist, immer noch ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Umso überraschter bin ich gewesen, einen Moment lang bin ich natürlich zuerst erschrocken gewesen, dann überrascht, als ich eine Hand nach mir greifen gefühlt habe. Dass es sich nicht um eine von meinen gehandelt hat, ist für mich außer Frage gestanden. Aber wer hat sich außer mir noch im Schrank befunden? Ist es überhaupt möglich, habe ich mich gefragt, dass die Leere des Schrankes, jemanden, der nicht ich bin, zulässt? Ich habe dieser Frage nicht auf den Grund gehen können, denn die Hand, eine zarte, eine schmeichelnde Hand, hat mir über die Brauen, durchs Haar gestrichen, ist die Konturen meines Gesichts nachgefahren. Ich hätte Ich muss doch bitten sagen können. Schluss damit hätte ich sagen können. Ich hätte die Hand packen und von mir weisen können als etwas Widriges, dem Inneren des Schrankes Zuwiderlaufendes und Zuwiderhandelndes, aber ich bin dazu nicht in der Lage gewesen. Die Hand hat mir etwas in den Mund gesteckt, einen Drops mit Himbeergeschmack. Vielleicht hat sie ihn in einer der Mantel- oder Jackentaschen gefunden, vielleicht ist er darin vom Besuch des Weihnachtsmarktes übrig geblieben. Wie dem auch sei: Der Drops hat, ich gebe es zu, herrlich geschmeckt.
Natürlich ist die Hand nicht nur Hand allein gewesen. Natürlich hat, was einen Körper darüber hinaus ausmacht, zur Hand gehört, wie ich, im gleichen Maße wie die Hand mich tastend erkundet hat, tastend erkundet habe. Am Ende unserer Erkundungen haben wir uns umschlungen gehalten. Ich hätte fragen können, wie lange sie, es handelt sich, ich muss das nicht weiter erläutern, um eine sie, bereits im Schrank hockt, was sie bewegt hat, in den Schrank zu gehen, ob sie die Bedingungslosigkeit des Schrankes in der gleichen Weise wie ich empfindet. Aber das ist überhaupt nicht nötig gewesen. Alles, was gesagt werden kann, ist hinfällig geworden, verstehen Sie? Alles jemals Gesagte, alles, was zu sagen sich noch aufdrängen könnte, ist im Schrank nicht länger von Belang.
Hallo? Hören Sie mich?
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martin Brandstätter
Tims Rückgrat
Tom und ich waren beste Freunde. Wir hatten einfach so viel gemeinsam. Wir liebten beide Star Wars, The Rolling Stones – vor allem Gimme Shelter – und wir gingen gerne raus ins Freie. Draußen kann man so zwanglos miteinander reden; man kann die Umgebung wahrnehmen und genießen und unsere Schrittgeschwindigkeit war aus irgendeinem Grund immer im Einklang und genau richtig. Es war einfach perfekt. Auf solchen Runden redeten wir allerdings nicht nur über schöne Sachen, sondern auch über traurige.
Tom und ich lernten uns kennen, als wir beide circa 6 Jahre alt waren; er lief aufgebracht aus seinem Haus – das Haus seines Vaters – und da rannte er einfach in mich hinein. Die Wucht, mit der er mich rammte, war so groß, dass ich sie paradoxerweise nicht spürte. Nach einer kleinen Schnupperstunde hatten wir das Gefühl, dass wir uns öfter sehen mussten. Wir verstan-den uns irgendwie auf Anhieb und das lag nicht nur daran, dass wir beide jeweils ein Star Wars T-Shirt anhatten – bei ihm war Han Solo drauf und ich hatte Chewy. Und so schlossen wir einen stillen Vertrag miteinander ab; jedes Mal, wenn es ihm schlecht ging, konnte er zu mir kommen und wir würden entweder spielen, reden, spazieren gehen oder alles auf einmal tun.
Tom wohnte in einem kleinen Städtchen, dessen größte Attraktion eine kleine Brücke über einem Bahngleis war, denn sonst gab es nur Traktoren und Trägheit in dem Ort. Die Brücke war immer unser Spot zum Zurückziehen, wenn er gerade nicht zu Hause bei seinen Eltern sein wollte. Seine Mutter war eine einfache Hausfrau und sein Vater arbeitete hart als Maurer in einer ortsansässigen Baufirma. In den zehn Jahren, die ich Tom jetzt schon kenne, merkte man, wie sich der Rücken seines Vaters verformte und seine Gedanken abstumpften. Umso mehr musste sich seine Mutter bemühen, die Familie auf ihren Schultern zu tragen.
Toms häufigstes Gesprächsthema – neben Star Wars und den Rolling Stones – war sein Vater. Er muss ein sehr strenger Mensch gewesen sein, aber Tom fand immer Entschuldigungen für das Verhalten seines Vaters. »Alles hat irgendwie einen Grund«, sagte er meistens, um eine Rechtfertigung zu geben. Ich versuchte immer ihn davon zu überzeugen, dass das Verhalten seines Vaters nicht in Ordnung sei, aber er antwortete immer darauf: »Du hast ihn noch nie getroffen; du kennst ihn gar nicht!«
Tom hatte recht. Ich kannte ihn wirklich nicht, aber trotzdem machte es die Verhaltensweise des Erwachsenen nicht besser. Es war für mich unverzeihlich. Manchmal wenn wir uns in solche Streitereien hineinsteigerten, standen wir einfach stillschweigend auf der Brücke und beobachteten die Züge, die unter uns hindurch fuhren. Er schaute den Zügen mit einer gewissen Faszination, die ich nicht immer teilen konnte, hinterher, aber ich tat trotzdem so als würde ich die selbe Bewunderung haben wie er, da er ja mein Freund war.
Tom und ich gingen an einem sonnigen Sonntag eine kleine Runde durch die Landschaft. Nach-dem er aus dem Haus seines Vaters gestürmt war, konnte ich nicht nein sagen zu ihm. Irgendwie verhielt er sich aber anders als sonst. Er wollte nicht wirklich reden; er starrte nur zu Boden. Als wir auf der Brücke ankamen, fragte ich, was los sei, aber er schloss nur die Augen und verharrte so eine lange Zeit. Ich war derweil etwas hilflos, da ich ihn noch nie so erlebt hatte und ich nicht wusste, was los war.
Tom entschloss sich irgendwann seine Augen zu öffnen und er zog sein Hemd hoch und drehte sich mit dem Rücken zu mir. Eine große, längliche Wunde zog sich quer über seinen Rücken. Sie war noch ziemlich frisch. Ich war sprachlos und er sagte nur: »Mama hat auch eine.«
Tom und ich hörten den 12Uhr-Zug näher kommen. Tom setzte sich auf die steinerne Brüstung und ich sagte nur: »Pass bloß auf. Du könntest fallen.« Und er antwortete darauf: »Alles hat irgendwie einen Grund.« Als ich diese Worte hörte, packte mich ein seltsames Verlangen. Ich spürte, wie ich jegliche Kontrolle über meinen Körper verlor. Der Zug kam näher. Ich näherte mich Tom. Der Zug kam näher. Ich stand hinter Tom. Der Zug kam näher. Ich fasste Toms Wunde an. Der Zug kam näher. Ich schubste Tom.
Tom wurde vom Zug erfasst. Langsam kehrte mein Wille über meinen Körper wieder zurück, doch ich spürte mein Rückgrat brennen. Und die Sonne schien, als wäre nichts passiert und ich stand da und hörte den Zug nicht mehr. Ich wurde zum Mörder. Ich hatte doch keinerlei Grund ihn zu töten. Ich musste ein Psychopath sein. Ich musste mich stellen; ich darf nicht frei auf der Straße herumlaufen. Einen langen Sprint legte ich hin, um die Polizeistation des Städtchens so schnell wie möglich zu erreichen. Ich musste mich einfach stellen; es gab keinen anderen Aus-weg.
Als ich dort ankam, suchte ich den erstbesten Polizeibeamten um meine Tat zu gestehen. Dieser stand vor einem Getränkeautomaten und ich schrie ihn von der Seite an: »Ich habe meinen Freund ermordet; Sie müssen mich festnehmen; ich hatte keinen Grund das zu tun; vielleicht bin ich krank oder so; helfen Sie mir verdammt nochmal! Ich muss bestraft werden! Hören Sie mir überhaupt zu!?«
Der Beamte schmiss sein Geld in den Automaten, wählte ein Getränk, wartete auf das Getränk, nahm das Getränk, trank etwas von dem Getränk und drehte mir den Rücken zu, ohne mir auch nur eine Sekunde seiner Zeit zu schenken. Mir fiel auf, dass gar keiner mich beachtete, obwohl vier Leute in diesem Gang standen. Ich verstand nicht, was vor sich ging. Dann sah ich einen Polizisten aus einem Zimmer kommen, der an mir vorbeiging und eine Tür direkt neben mir öffnete und sagte: »Walter, wir haben schon wieder einen Springer. Mittlerweile der fünfte in diesem Jahr. Komm, wir müssen rausfahren!«
Die beiden Beamten verließen das Zimmer und gingen an mir vorbei und aus der Polizeistation hinaus. Keiner von beiden hatte mich mit einem Blick gewürdigt, noch hatte mich irgendwer gehört.
Jeder kehrte dieser Stadt den Rücken zu. Und anscheinend taten das alle auch mit mir.
Und erst da realisierte ich, dass ich nicht echt war.
Ich hatte keinen wirklichen Körper.
Ich war nur Toms Freund. Meine Existenz war an seine gebunden, aber trotzdem lebte ich weiter. Und jetzt verstand ich auch, warum wir uns damals getroffen hatten.
Tom ist tot und Tim muss damit leben.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Stephanie Mehnert
Die Klinge zu sein, und auch die Wunde
Ich will einen Kokon aus Spinnenseide.
Diesen Satz schreibe ich auf meinen Block und als ich den Punkt setze, bricht die Bleistiftmine. Mein Blick fällt auf den kleinen Bilderrahmen, den du aufs Regal gestellt hast, als du eingezogen bist.
How you love yourself is how you teach others to love you.
Aus dem Nebenzimmer höre ich dich leise summen, während du packst. Eigentlich ist es mehr ein Zwitschern, als wärst du ein Vogel, der aus dem Käfig entkommen ist. Einer von diesen Wellensittichen, die immer Butschi heißen und in Wassergläsern ertrinken können.
Mein Daumen bearbeitet das Ende des Druckbleistifts, tack, tack, tack, bis sich endlich die Mine aus dem vorderen Ende herausschiebt. Scharf und dunkel kratzt sie Wörter aufs Papier:
Ich bin ein leeres Gefäß. Man kann mich befüllen, dann bin ich glücklich bis zum Überfließen, und das macht mir Angst.
Vielleicht liegt hier das Problem, denke ich, während ich deinem albernen Gezirpe lausche und dem Geraschel deiner Händekrallen. Es mögen auch deine Flügelspitzen sein, die am Schrankholz hängen bleiben. Butschi, denke ich verächtlich.
Es ist seltsam, das Universum hinter meiner Stirn. Manchmal denke ich, da ist gar kein Körper an meinen Schädel angewachsen, bloß eine Art Maschine, die alles am Laufen hält. Und dann bestehe ich wieder nur aus Gefühlen, die mich wie Flutwellen vor sich herschieben. Wie soll man es mit so jemandem aushalten?
In meiner Welt gibt es keine Farben. Alles ist schwarz oder weiß, gut oder schlecht. In mir drinnen wäre Raum für einen ganzen Regenbogen, so viel freie Fläche. Wie eine Leinwand, die mit den Jahren immer staubiger wird, mottenzerfressen und gelb, weil niemand kommt, um sie zu bemalen.
Du klackerst im Badezimmer herum, und ich stelle mir vor, wie es da aussehen wird, wenn du weg bist. Denke an die Kreise im Staub auf der gläsernen Ablage, die mich so lange an dein Fehlen erinnern werden, bis ich mich dazu durchringen kann, sie fortzuwischen. Rasierer, Langhaarschneider, Nasenhaarschere, Männerduschgel, Barthaare im Waschbecken und nie wieder den Klodeckel herunterklappen müssen.
»Soll ich dir von meinem Küchenzeug noch was dalassen?«
Du kommst lächelnd zu mir geschlendert, als hättest du gerade gefragt, was ich zu Abend essen möchte. Wie ein Wellensittich siehst du nicht gerade aus, eher wie ein borstiger, fetter Eber. Du solltest sowieso nicht so viel fressen. Hauptsache du nimmst diesen verfluchten Wecker mit, dessen unermüdliches Ticken einem die Stunden aus dem Fleisch hobelt. Vielleicht hätte ich ihn an deiner Stelle rauswerfen sollen.
»Ne«, sage ich. »Nimm alles mit.«
Spinnenfäden sind das festeste Gewebe der Welt. Bezogen auf ihre Masse sind sie viermal so belastbar wie Stahl. Ich bin überhaupt nicht belastbar, deshalb brauche ich den Kokon, eine antibiotische Wohnhöhle. Vielleicht mische ich der Seide Pheromone zu, um den nächsten Mann anzulocken. Und dann mache ich, dass er mich liebt. Wie oft kann ein Mensch eigentlich verlassen werden, bevor er zerbricht?
Ich betrachte die feinen Narbenlinien auf meinen Unterarmen, sie überlappen sich, Mikadostäbchen im Sturm. In der Küche ziehst du ein Messer aus dem Holzblock, und das Geräusch, das die Klinge beim Darüberstreichen macht, lässt alle Härchen auf meiner Haut strammstehen. Ich spüre, wie der Druck steigt.
Manche Spinnenweibchen fressen ihre Partner, schreibe ich. Man nennt es sexuellen Kannibalismus. Meine Mutter, ich denke, die war so eine. Vielleicht auch eine Gottesanbeterin, so fromm, wie sie immer getan hat.
Ihre Männchen waren allesamt kleiner als sie, nicht körperlich, aber im Geiste.
Der Biss meiner Mutter bestand aus giftigem Spott, den sie präzise und absolut unvorhersehbar injizierte. Sie traf immer genau, den wunden Punkt.
Manche Männer hat das sehr zornig gemacht. Einmal trat einer meinen Puppenwagen durch den Raum, und ich weiß noch, wie er auf meine Hand stieg, als ich den Stoffbären aufheben wollte, der darin gelegen hatte.
Es gab auch andere Exemplare. Einer leckte gern über meine Hände, die Arme hinauf. Wenn er mein Zimmer verließ, nachdem er mich ausgehöhlt und mit seinem Bieratem angehaucht hatte, war mein Gesicht klebrig von seiner Zunge. Er war der Erste, die, die folgten, waren noch schlimmer.
Damals hatte ich mir vorgestellt, dass irgendwo ein Vater nichts davon ahnte, was zwischen den Schenkeln seiner Tochter vor sich ging. Ich stellte mir vor, mein Vater wäre wie Käpt‘n Iglo: Immer auf den Weltmeeren unterwegs, in jedem Hafen eine Frau, und keine Ahnung von meiner Existenz. Manchmal frage ich mich, ob diese Typen sich alles geholt haben, was einmal in mir gelebt haben muss, oder, ob ich schon immer so war.
Eine Spinne balanciert in ihrem Netz wie eine Seiltänzerin. Von Balance verstehe ich nichts, ich schätze, dafür braucht man so etwas wie ein Gespür für die Mitte, aber ich lebe in Extremen. Einmal habe ich ein Bild von Spinnennetzen gesehen, deren Erbauerinnen die NASA unter Drogen gesetzt hatte. Irgendwie hat mich das getröstet, dass die Spinnen auch nichts auf die Reihe bekommen, wenn sie high sind.
Den Bleistift lege ich weg und unterdrücke das drängende Verlangen, mir wehzutun. Ich kneife mir in die Ellenbeuge, so fest ich kann, dann mache ich ein Selfie mit dem Smartphone, wie jeden Tag um diese Zeit. Poste es bei instagram, #egoshooter. Denke an meine Mutter, denke an die Urne, die irgendwo auf dieser Wiese verscharrt liegt und bei der ich niemals Blumen ablegen würde. Frage mich, warum ich dennoch immer wieder hingehe, mit nichts als Fragen im Kopf. Frage mich, wozu ich an diesem Text schreibe, den ich doch nie jemandem zeigen werde. Frage mich, wie ich je so etwas wie eine Beziehung hinbekommen soll, wenn ich diesen Teil von mir unter Verschluss halte, während all das Unaussprechliche langsam vor sich hin fermentiert. Da wächst kein Gras drüber, niemals, das ist schlimmer als Tschernobyl. Aber ich strahle, und das kann ich gut. So gut, dass es jedes Mal ein Schock ist, wenn die Wahrheit hervorbricht und ich erkenne, dass ich doch wie sie geworden bin. Als wäre sie in mich gefahren, nach ihrem Tod, wie ein übermächtiger Dämon, und ich selbst bin der hilflose Exorzist.
»Um halb acht kommt Adam und holt mich ab.«
Du lässt dich neben mir aufs Sofa sinken. Vielleicht ist es doch noch nicht zu spät. Wenn du jetzt deinen Arm um mich legen und mir sagen würdest, dass du ohne mich nicht leben kannst, würde ich dich nicht wegstoßen, diesmal nicht, ich schwöre.
»Okay«, sage ich leise.
»Wirklich alles okay?«
»Ja, klar. Hast du alles?«
»Glaub schon. Ruf an, wenn was ist, ja?«
Du legst eine Hand auf mein Knie, wo sie mir ein Loch in die Haut sengt.
Auf dem Fensterbrett tickt höhnisch der Reisewecker, eine Fliege zieht ihre Kreise, setzt sich auf deiner Hand ab, die auf meinem Bein brennt, erhebt sich erneut, kreist weiter, klatscht gegen die Fensterscheibe, einmal, zweimal.
»Ja«, sage ich.
Du nimmst die Hand weg und starrst auf den Boden. Tick, tick, tick. Der Wecker steht noch immer da, stört mich, dich stört er nicht. Sobald du weg bist, werfe ich das verdammte Ding auf die Straße!
Gestern lag eine tote Amsel unten. Irgendein Raubtier hatte ihr die Schädeldecke aufgebissen, eine Katze vielleicht, oder einfach nur eine Ratte. Ich hockte mich neben sie und zog die Flügel weit auseinander. Wie ordentlich die Federn da gespreizt in Reih und Glied schimmerten, als wäre nichts geschehen. Meine Wunden liegen auch alle innen. Von außen sieht man nichts, mein Gefieder besteht aus klugen Worten und einem niedrigen BMI. Innere Leere geht gut als Tiefe durch, ich liebe schnell und intensiv. Der Schaden ist anfangs unsichtbar.
Es klingelt. Du gehst hin. Adam kommt herein und hebt die Hand zum Gruß in meine Richtung. Er schlägt dir auf die Schulter, dass deine Speckbrust wabbelt, Digger nennt er dich, was ich immer noch absolut passend finde.
Du schulterst die Taschen und schnaufst, als befände sich darin ein ganzes Leben.
»Mach‘s gut«, sagst du leise.
»Ja, mach‘s besser«, sage ich.
Die Tür fällt hinter dir ins Schloss und es ist still.
Das Loch in meinem Brustkorb expandiert, ich bin ein Ballon oder eine Supernova. Ich stürze zum Fenster, greife den verfluchten Wecker, reiße am Fenstergriff und schleudere das tickende Ding in hohem Bogen auf die Straße, wo es auf dem Dach eines parkenden Autos eine Delle hinterlässt, bevor es in seine Einzelteile zerspringt. Und dann schreie ich. Ich schreie allen Schmerz hinaus, allen Stolz und alle Einsamkeit. Ich schreie und schreie, während mir Tränen über die Wangen laufen und sich zu einem See auf dem Fensterbrett sammeln, als flösse das Leben salzig aus mir hinaus. Die Welt ist längst verschwommen, ein einziges Grau in Grau. Für einen Moment sehe ich mich da unten liegen, die Arme weit gespreizt, meine Bluse ein Farbklecks auf dem Asphalt. Ob du wohl die Amsel in mir sähest, frage ich mich. Eine kleine, schwarze Feder schwebt hinein, ein Boot im Tränenmeer.
Aus weiter Ferne höre ich die Wohnungstür ins Schloss fallen, aber ich verstehe nicht. Und dann spüre ich es: Dein warmer Bauch stärkt meinen Rücken und deine Flügelarme sind mein Zelt.
»Ich bin da«, sagst du nur.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Aigner
#7Leben
Im 7. aufgewachsen. Im 7. derzeit befindlich. Im 7. hab ich vor zu sterben.
-
Die letzte ra(s)tlose Hoffnung - mein infantiles Orakel. Befindlich an jener Kreuzung, an der sich Jenny Steiner und Hermann zum ersten Mal unter dem Ahorn, auf dem eine Seidenraupe ein Mittagsschläfchen hielt, geküsst haben. Dort klebt diese bösartig-grimassierte Säuglingstotenmaske unscheinbar an der Hausmauer und starrt mit seinen klitzekleinen, leeren Augen auf mich herab. Leise flüstert es. Immer das, was ich hören will.
-
Ausgelassen „Dracula Rock“ singend - die peinigenden Volksschulstunden überlebt - hüpfen Bettina und ich die Burggasse entlang nach Hause. Fast überfährt uns ein Auto, zu vertieft sind wir in eine hochliterarische Spekulation über das „Phantom der Schule“ von T. Brezina. Der Sokratische Dialog wird pausiert, um uns beim Lollipop mit rosanen Beverly Hills Kaugummis (da sind Sticker drinnen von Donna, Dillan, Brenda, usw.), Kaugummi- und Colaschleckern, sowie einem bunten Gummigetierzoo einzudecken. Im Anschluss folgt eine diskursive Charakter-Gegenüberstellung der weiblichen Mitglieder der Knickerbocker Bande: Also wer ist cooler? Lilo oder Poppi?
-
Angeciderd landen wir in der herzlichen Spelunke Zipp in der Burggasse. Einsame Seelen und AlternativstudentInnen sorgen für mehlige Melancholie und heilige Heimeligkeit. Spärlich beleuchtet von Musik aus meiner Teenagedirtbag-Zeit. Gerade Halt auf den Barhockern gefunden, fallen wir zungentechnisch übereinander her. Un(un)terbrochen von Unterhaltungsepisoden. Zärtlichst beschreibst du deine angedachte sexuelle Vorgehensweise, die uns zu mir nach Hause manövrieren soll. Nein! Ich will dieses nostalgische Rumknutschspektakel auf keinen Fall einem koital-bewusstseinserweiternden-orgiastisch-ekstatischen Intimverkehrsaufkommen opfern. Zu genussvoll erscheint mir das lechzende Warten auf eine geschlechtliche Zusammenführung in den kommenden Tagen. Du bestimmst wann.
-
„Love reign o´er me“ dröhnt es hippie-manisch aus den Junggesellinnen-Lautsprechern in der Neubaugasse. Deine Türnummer merke ich mir einfach nicht. Eine Platte nach der anderen schallt, wir trinken Rotwein, rauchen vegan und
reden, reden, reden über die Musik, die Bands, die Bücher, meine Träume, deine Pläne. Penny und Ruby. Magische Stunden. Zeit um aufzubrechen, ins Konzerthaus. Ein paar Plätze weiter von Pete Townshend werden wir orchestral von „Quadrophenia“ verschlungen.
-
Falafeldürüm oder Hühnerdöhner? Der Berlindöner in der Zieglergasse war genau eine Woche ein Geheimtipp. Danach strömten die Maßen von nah und fern auf Pilgerfahrten zu der heiligen Stätte des Lammfleisches. In der andächtigen Warteschlange bereite ich mich auf den hochkonzentrativen Bestellakt vor: Nächste! Ich muss schnell reagieren, Meinen Mann im Auge behalten, auf seine Fragen blitzschnell und präzise antworten: Mit alles? Scharf? Lieblingsfarbe? Zum Mitnehmen?
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Peham
Quallengarten
I.
Der Geruch von alten Intercity-Zügen, der im Stoff sich sammelt, das Mädchen neben mir, mit einem Buch von Satre; die Täler, in denen wir uns durchgraben; eine Ahnung, dass es dich für mich gibt.
Deine tränenden Augen, der Ausdruck darin, den ich mit Schmerz verwechsle; es ist Gleichgültigkeit auf ganzen Ebenen. Meine Gedanken sind heute ein Kettenkarussell, du bist der einzige Fahrgast. Wir sind andre geworden; jeder Gedanke an dich ist ein kalter Entzug.
Aus deinem Mund wachsen Bäume, ich bin Schmetterling, ich bin Falter. Ich wohne zwischen deinem Geäst, suche Sinn und Blatt gleichermaßen, ich finde nur mich darin, ich denke an die letzten Sommerwinde und begreife den Herbst; ich weiß: die Lebensdauer von Schmetterlingen variiert zwischen einem Tag und einer gewissen Anzahl von Monaten.
Sie schreiben weiter, Liebe ist der Kommunismus im Kapitalismus, wir haben so viel gemeinsam. Mir eine Welt vorstellen, in der wir kein Wirtschaftssystem brauchen, und daran regelmäßig scheitern. Zwischen uns herrscht immer ein bisschen mehr Nachfrage als Angebot, die 800m von der U-Bahnstation und deiner Wohnungstür eingerechnet.
Langsam verfallen wir zu einer Masse und werden zum Grundriss eines Kreuzworträtsels. Deine Finger verknoten sich in meinem Haar; ein Zeichen, dass du bleiben kannst, wenn du möchtest; ich beharre nicht auf Benennungen; deine Unanständigkeiten sind mir lieber. Ich denke uns als Dichtpflanzung, wir können Weinreben sein, wenn du magst, oder Apfelbäume. Ich gebe dir Aussicht, Wein, Mund, Welt, Öl, den kleinen Finger, Übermut, Kissen, die ganze Hand, Vorgärten, Straßenbahnen, Fernbedienungen, Anleitungen, hundertprozentige Schokolade, Jahreszeiten, mich.
.
II.
Dich in einem alten, flachen Shirt sehen und bemerken, dass du gerne rot und blau trägst. Eine Sicherheit gewinnen und dann nach deiner Lieblingsfarbe fragen. Ich habe diesen Herbst eine neue liebste Farbe, die Mischung all der Blautöne rund um deine Pupillen. Meine Gedanken an dich nicht mehr festhalten zu vermögen, seit du mich überall angefasst hast, es genauso die ganze Zeit haben wollen. Du hast deine Denkfalte auch im Schlaf, ich frage deine Träume, worüber sie nachdenken. Wir haben noch nicht angefangen, uns unsere Traumlandschaften zu erzählen, deinen Kopf zwischen meine Hände nehmen und so an das kommen, was sich hinter deine Stirn befindet. Den Wunsch auf meinen Lippen haben, mit dir in einen Quallengarten zu spazieren und uns von dem Meer umspülen lassen, ich will dir mein Meer zeigen, alles davon und doch habe ich so Angst, dass du darin nicht schwimmen magst. An die Quallen denken, die uns hineingelassen haben, an die Schatten, die du hinter mir entdeckst. In deine Arme schwimmen, wir würden warm werden, selbst zwischen den Stürmen, das weiß ich. Wir würden singen und schweigen gleichermaßen, am Grund des Meeresbodens ruhen, mein Herz schwappt über, es erzeugt Wellen, so gewaltig, dass du jede davon spürst.
Auf deinem Schoß sitzen, und dich um Liebe bitten, so als wäre es ein Gegenstand, der sich in Hosentasche ansammelt und herausgegeben werden kann. Mein Abenteuer auf See fortsetzen und zur Piratin werden, dein Schiff entern wollen, deine Besatzung beobachten, deine Munition nicht kennen, ich denke, es wird schwierig an dein Backboard zu kommen, das Ruder zu übernehmen, du bist ein stolzer Kapitän.
Im Regen zum Hafen marschieren, wo meine Schiffe warten, die mich westwärts bringen, meine Hände in deine legen in deiner Jackentasche, ich liebe das, musst du wissen. Du erzählst mir von den letzten Plünderungen und Eroberungen, ich versuche, nicht gekränkt zu sein. Da sind deine Geschichte, eine Offenbarung und deine unausgesprochene Angst, dass ich nie wieder deine Stadt ansteuern werde. Ich bewundere dich für diesen Mut und verstehe deine Zweifel in diesem Moment, ich will nicht mal mehr an Bord, sondern aus meinen Schiffen Kontore bauen und gänzlich bei dir bleiben. Wir werden eine erfreuliche und reiche Insel abgeben, da bin ich mir sicher.
Diesmal kommst du auf meine Insel und du staunst über das große Kraftwerk darauf. Ich erzähle dir von Büchern, die ich gelesen habe, und es scheint dich nie zu langweilen. Wir sind 30 und 33, reden von links und von rechts, von den jungen Linken und warum es so wenig alte gibt. Wir stehen in der Mitte und halten uns aneinander fest, ich klammere, als wir über die Brücke schlendern, ich komme nicht umhin, dich sehr festzuhalten, damit der Wind dich nicht wegtreibt, so lieb hab ich dich just in diesem Moment. Wir fahren in ein Stück westwärts und essen Kuchen und trinken Kaffee und du freust dich so, dass dein Stück auf dem Teller selbst gemacht ist und ich, dass du da bist und mit mir in der Sonne sitzt. Am Abend weihst du mein neues Bett ein, ich denke an Fleabag, I fucked the priest, ein bisschen bist du ihm schon ähnlich.
Deine Stadt ein zweites Mal ansteuern und Angst davor haben, wie sie ohne dich ist. Bei Ankunft überall nach dir suchen, rundherum dunkelgrauen Masken oder rosa-roten entdecken und rote, blaue Shirts und graue Shorts, der Hafen ist menschenvoll und du nicht da. Ans andere Ende der Stadt treiben und Spuren von dir suchen und schmunzeln, weil ich einen Mann mit einem Burrito auf einer Bierbank entdecke. Mich in den Gesprächen der anderen verlieren und dich so sehr vermissen, mein Herz legt mehr Knoten zurück als jedes unserer Schiffe.
Deine Stadt ein drittes Mal ansteuern und Angst davor haben, dass du nein sagst, wenn ich dich um Quartier bitte. Eine Bejahung deinerseits, ein Freudensprung meinerseits, mir fällt ein Stein vom Herzen, als du auf der gegenüberliegenden Seite des Zebrastreifens stehst, du hast mich wie versprochen abgeholt, und ich liebe deine Zuverlässigkeit mit diesem Moment. Du bist ein anziehender Kapitän mit dem weißen Shirt, das von einem Zeitalter berichtet, das es schon lange nicht mehr gibt. Mit dir später die Hügel umkreisen, die sich in deiner Wohngegend befinden. Über der Autobahn stehen und überlegen, ob wir auf ein paar Fahrzeuge spucken sollen. Ich fühle eine Verrücktheit zu zweit, und liebe es jetzt schon, wie albern wir sind. Ich mag so sehr, dass du mich zum Lachen bringst und dass wir zwangsläufig über Ernstes reden, obwohl ich manchmal ins Schweigen rutsche, weil ich staune, mit welchem scharfen Verstand du gesegnet bist. Dich in der Sonne beobachten, wie glücklich du bist, ich habe die Ahnung, wir sind beide selten so unbeschwert.
Am Abend zu einer Verpflichtung müssen und auf dich warten bis dein Schiff anlegt, weil ich einen Text über dich im Gepäck habe. Ich würde ihn nicht nur den anderen, sondern gerne dir vorlesen, und weniger darauf bauen müssen, dass du bald kommst. Meine Arbeit ist getan, ich warte auf dich, die Nervosität steigert sich ins Unermessliche, meine Angst, dass du nicht mehr kommst, ist groß. Ich denke an meinen Rucksack hinter deinen Türen, ein kurzer Gedanke daran, dass ich die Sachen nie wieder sehen werde, ich habe dir noch nicht erzählt, wie häufig ich vor verschlossenen Türen in deiner Stadt gestanden bin. Du kommst und bedauerst deine temporäre Abwesenheit, redest über Chinesisch als Lebenseinstellung, über Bücher und über deinen Lieblingskontinent. Ich bin so stolz, neben dir zu sitzen und dich zu haben für diesen Moment und schäme mich, an deiner Zuverlässigkeit gezweifelt zu haben. In deinem Bett knipse ich Fotos von mir, weil ich keine Erinnerung daran habe, je so ein glückliches Gesicht von mir gesehen zu haben, ich halte mich für diesen Moment fest, während du in einer anderen Sprache Unstimmigkeiten klärst. Der letzte, warme Sommertag ist es für dieses Jahr gewesen, das wissen wir beide noch nicht, als ich frühmorgens im Regen zum Hafen laufe.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Christoph Michels
dem verzicht
der morgen lässt die stadt, bevor er sie, muss der morgen durch die stadt, muss die konturen, bevor er den tag vorweg. der morgen dem tag, lässt sich schritt in schritt den nächsten stein. und dem stein der beton. dem beton das grau. das grau die stadt ins hirn. wo das auge hohl, die stirn zerrissen. die gleise abwechselnd und das bild jeder welt, der abwesenheit.
wo die augen in vorbeigewehtem parfum. das parfum vom dreck, der dreck das gleis, der dreck die treppen tief, der dreck die treppen hoch, das holz, das grün der bank. der dreck das warten zerfressen. das warten den kopf voll, das warten den kopf schwer, gesicht in gesicht verstummt. dem atem vorgeschoben, um es hinter sich. aus dem weg, geh mir aus dem weg, den hohlen augen zusammengesetzt mit jedem wort weiter: dass es liebe, diese nazis, diese beiden nazis, die sich da in ihrer liebe, gottgegebener liebe, von jesus gegeben, jesus christus der ihnen seine liebe, die liebe dieser finsteren nazis, diesen sex-nazis, diesen sex-menschen, die überall, überall diese sex-maschinen, in diesem sex-staat, in der sex-ddr, dass die erziehung zum sozialistischen menschen lüge, dass der mensch keine gefühle, dass der mensch bloß ficken, diese sex-menschen, diese sozialistischen sex-maschinen, die sich alle gegenseitig ficken müssen - - die stille des verhallens, des wartens, der augen die den boden. die stille des näherkommens, eine flasche zwischen den zähnen, der suff ihr ins auge, der suff ihr ins bein. ihre augen ins papier, die finger die flasche aus den zähnen, die finger das papier von der säule: drei bis vier zimmer, studentin - eine studentin vier zimmer - vier zimmer, was ist denn das für eine scheiße, eine studentin, vier zimmer - ich brauche eins, ein zimmer, ein verficktes zimmer, diese verfickten studenten, diese sex-studenten, diese sex-nazis, die finger die flasche in die zähne, die finger das papier in die gleise, die hand die flasche in den boden, in den bahnsteig gebrüllt: WAS FÜR EIN VERFICKTER DRECK DAS – IST DAS ALLES? OB DAS ALLES IST?
dem beton das dunkel, das dunkel dem hell, das hell dem morgen.
die häuser schnell, das blau darüber.
den fingern der dreck, sich wohin – sich – hinter sich - -
einem schmierigen die augen voll. den augen die fäule, das gelb seiner zähne.
einer jungen blond der ansatz schwer, blond die blässe den brüsten das kleid. ihr kleid im hell, ihre augen die leere dem fenster dahinter.
wo der schweiß die haare in die stirn, der schweiß die hose ans bein, der schweiß das hemd gefleckt, wo hände kreuzend schwielig hart.
die dächer flirrend, die stadt beendend.
die junge ihr blond zusammen.
der schmierige die augen überall.
der jungen die augen ins nichts.
dem schmierigen die spucke im hals.
der jungen die arme verschränkt.
dem schmierigen die zunge schnell.
der jungen die brüste verdeckt.
dem schmierigen die augen geheftet.
dem schmierigen dann die nächste station.
der jungen sich finger aus finger entspannend.
dem schmierigen die tür ins gesicht.
der jungen die augen zurück.
das blau des waggons still. das dunkelblau des teppichbodens, das meerblau der wände, das königsblau der sitze, das himmelblau der kopfpolster. das blau des waggons lässt das nachmittagsblau blass.
die büsche flimmernd, die vorstadt flach.
das schweigen der gesichter aus der stadt heraus.
was sich im dahinter, hüllen sich wohin - -
die sonne einen der bahnsteige in flecken. das licht die leere zerbrochen, der leere eine frau die arme weit die augen geschlossen ins licht. auge haar gesicht.
die bäume schneller, die stadt vorbei.
die sonne den schweiß in den waggon. der schweiß die finger aneinander, der schweiß die blicke schwer, der schweiß das hemd geöffnet, die gänge eng und keinem ende bei.
wo die felder weit, die stadt ins klein.
ins gefasel dem gang sich zwischen die polster gehängt:
dass man selbstverständlich alles mit allem, aber ob das dann auch so zusammengehe -
dass der sohn ein rotzlöffel, ein schnösel der die eigene mutter übervorteilt -
dass die tochter ein stück möbel sondergleichen -
dass man immer schon sonntags zum pilzesammeln nach eberswalde.
und die wiesen weiter, die stadt entfernt.
wo der atem dem blau die weite. der weite, dem weitesten feld, jeder feldweg entgegen. und die felder die wiesen die hecken die angehäuften steine als schon da. irgendeiner ruhe sich. und der wind die wiesen zum mühlenrad. der wind teilnahmslos wie die nacht, über jeden baum jeden strauch jeden stein. schiebt der wind die beine weiter. und der feuerstein lässt die hände und der feldweg die schritte.
bis den feldern die gärten, den wiesen die häuser. ihre vollen gärten grün und grün und gelb. jedem grün.
und die weite die fabrikschornsteine dem kirchturm gleich. die schornsteine stillgelegt, den kirchturm blass ins blau. wo dem kirchturm das dorf verlassen.
und dem asphalt die sonne, dem asphalt jeder riss und sie an der bushaltestelle. ihrem braun die augen noch fern, ihren armen das nichts. aus diesem moment in den nächsten, und es immer nur dieser eine, wenn der eines anderen zum eigenen und umgekehrt und dann vergangen und nicht mehr nachzuvollziehen. der kürze des moments verhangen. als ihr dann die augen weit, dass es dieser sommer und: willkommen in der provinz, dahingelacht die arme die luft, die haare den wind.
der wind ihre schritte schnell und ich im hinterher, kein blick kein wort, die wiesen der weg das dorf sich hinter uns. bis das dorf klein, lässt es noch die schornsteine und das blass des kirchturms. und erst jetzt ihren atem, schritt um schritt. und ihr arm dem wasser:
wo dem weiß der segel das blau, den segeln fest der wind, zur schau gestellt. dem wind im dicken schilf.
dem horizont das wasser, wie dem kirchturm der backstein.
und das wasser matt, die stadt gelöst.
und ihr der blick abhanden: dass der wind ein fisch in aufgelhobenen linien, in wasserfarbenen konturen, in ungeahnten umrissen. dass nur der wind ohne gesicht.
und der wind die pappeln ins flimmern. der wind die pappeln höher. und ihr summen dem rauschen: dass man ein lied ein bild den silberpappeln im wind. das bewegen der pappeln, und der wind ihre arme ihr haar dazu. wo die ruhe ihrer augen. wo der weg im sand vom wasser weg und die pappeln hinter sich.wo der weg vom feldweg zum waldweg. die fichten dürr und in reihe gestellt. die fichten tief, die stadt entblößt.
aber ihr die stimme dumpf: dass alles feld, jeder baum, alles einer berechtigung - -
und die finger den waldboden tief.
und die finger einen zapfen.
und die nase den harz.
und sie sich herunter, die augen im gegenüber, die augen nah und die härchen ihrer arme. und in ihrem näher, auszuweichen dem erstaunen dann vibrieren lässt auch mich das braun ihrer augen haare zu einem punkt ihrer stirn der das wasser den wind das haar in sich und mich und eine träne dann der haut wie einer verbindung bei. von minuten und stunden und tagen. vom morgen zum abend. angehalten. bis ihr langsames zurück ihren augen das lächeln ihren armen die härchen sich, unterschieden, wie von einem neuen an - -
und der wald den bäumen die wurzeln blank. wo ihr die füße nackt, die augen. ihren händen die wiesen der wald. hände arm verzicht. und der wald sich aus seiner verlassenheit, dem weit eines weihers. dem weiher die sonne, dem weiher der morast. der morast die füße, das wasser die brust, die sonne die köpfe, die hände das wasser flach. wo jemand am ufer, dem geschrei der vögel und wir den geräuschen kommend gehend jedes einzelne – wie es durch die sonne den weiher die fichten. dem wasser unberührt. dem wasser nur die haut, auge dem auge, dem atem die nähe. dem atem vertraut. die nähe haut in haut, dem atem schnell, dem zittern der haut, jedem geruch. aber der haut schon der abend, der haut schon ein anderes und das wichtigste nicht zu erinnern.
und ihren augen dann: die weite dem verzicht, in jeder einzelheit, dem aufgelösten tag. und sich nichts verstellt. der sicherheit hierher und ihre augen dann entfernt - sich wer wohin gehüllt – lässt mich der stadt zurück - -
und ihre stimme dann schon dünn, dass der sommer einem manchmal unendlich, aber dass er ein faden, dessen ende ganz sicher - - und ihr schatten dann von den scheunen im stein. wo den schwalben der abend. den schwalben die scheunendächer die bögen enger. und der bahnhof vernagelt, vom fahrscheinautomaten ersetzt. wo das abendgelb dem morgen recht, dem abgelaufenen tag ins bild. wo das abendgelb die häuser tief, jedes gartentor jeden zaunpfahl dem eigenen ende vor. dem beton dem stahl dem dreck. lässt das abendgelb sie noch kurz erreichbar scheinen. bis das dämmern dem tag. und das dunkel schnell, die stadt von vorn. damit die nacht in ihrer teilnahmslosigkeit darüber hinweg - - -
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Suse Schröder
Aufschnitt und Stulle
Die Aspikscheiben glitzern im Neonröhrenlicht wie noch vor Wochen die Augen der Wurstfachverkäuferin Helga Keun. Müde erfüllt sie Mengenangabenwünsche. Müde nimmt sie den Mettspachtel, keilt ihn in die rosa Masse, wirft exakt 250 Gramm aufs Glanzpapier, schlägt auf die Koteletts ein, notiert Ausstände auf der Bestellliste. Den Besteckkasten entleert sie mit geschlossenen Augen. Müde gleiten ihre Schweinsäuglein über die Auslagen. Frau Keun zieht die Schulterblätter zusammen. Neulich nach Feierabend hatte sie sich im Spiegel betrachtet, im Großen. Der Deckenfluter zeigte den Verfall ihres Fleisches. Wie Gänseflügel hatte Frau Keun gedacht, mit ausgestrecktem Hals beim Schulterblick. Seit Herberts Berentung vor fünf Wochen hatten sich ihre Proportionen verschoben. Ob das an Herberts Schnittchen lag?
Von unten krabbelt eine Hand über die abgerundete Tresenfront herauf, hinterlässt Schlieren, die bis zum Feierabend warten müssen. Frau Keun drückt eine Wiener in eine Kinderhand. Vor den Feiertagen schwärmt die Kundschaft herein wie zum Schlussverkauf. Herberts Schnitten werden zu Hasenbroten: Käse - Schmelz-, Frisch-, Ofen-, Kochkäse, körniger Käse, Quark selten. Zeitgleich mit der Rente wurde Herbert zum Vegetarier, schob Helga immer häufiger von sich: „Du riechst nach Blutwurst!“, wenn sie sich mit gespitzten Lippen und Streicheleinheiten näherte.
Helga Keun verschwindet in der Schlauchküche, setzt sich ab, stützt die Arme auf das kühle Sprelacart. Sie fängt die Spitzengardine, zieht sie zur Seite. Die Meyers küssten schon wieder wie wild. Helga wischt mit den Zeigefingern über ihre Augenringe, bettet die Stirn auf ihre Arme, schleckt unterm Tisch den Belag von ihren Schnitten. Ihre Zungenspitze spürt den Käselöchern nach. Sie kaut genüsslich, schiebt die glitschigen Reste aus ihren Hauern, ehe sie einen neuen Happen nimmt. Als Herbert in die Küche schlurft, schnarcht Helga bereits. Er streicht ihr sanft über den Rücken: „Ach, mein Gürkchen“, säuselt er in ihr Seufzen hinein.
Am nächsten Morgen liegen neue Stullen bereit: ausgestanzte Käseherzenschnitten mit Senfkleeblättern. Heute wagt sie es, klopft beim Filialleiter: „Herr Jungspund, Sie erinnern sich? Helga Keun?“
„Wurst, ne?“
„Ja, nein, also… Mein Mann, Sie wissen ja.“
„Nee, was? Kommen Sie zum Punkt.“
„Also, mein Mann,…“
„Frau Keun, sagen Sie es frei von der Leber weg“, bei den Worten springt Jungspunds rechter Mundwinkel zur Seite. „Das ist gut, das notier ich mir – Fleischfachverkäuferin mit Fleischvokabeln ansprechen. Also? Frei heraus!“
„Also, …“
„Frau Keun!“
„Ich möchte zur Käsetheke wechseln! So!“
„Frau Keun, Sie vertreten Wurst. Schauen selber aus wie eine, das passt! Aspik, Mett, Hühnerkeulen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, es gefällt mir, was ich sehe! Da nehm ich doch gern noch 100 Gramm mehr von der Gesichtswurst. Und noch was: Sie berechnen zu knapp. Legen Sie gern ab und an einen Finger dazu, fällt gar nicht auf, dann klappt das auch mit dem Umsatz!“ Frau Keun weint. Von der Pfandannahme zum Milchspeiseeis zur Fleischtheke. Ein Neuanfang kam nicht in Frage, so kurz vor der Rente. Sie wischt sich über die Augen, richtet sich auf, spürt die Wulst, die sich zwischen ihren Schulterblättern formt. Der Filialleiter flitzt um den Schreibtisch herum, packt sie genau dort: „Mhm, Bratwürste! Legen Sie mir bitte welche zurück. Ich schau dann später mal vorbei.“ Wie eine Grillzange packt seine Hand die Wulst. Herr Jungspund entlässt sie mit einem Klaps oberhalb der Hüfte: „Und von der Schwarte noch ein Kilo, danke.“
Frau Keun tapst zur Theke, ihre Schultern hüpfen, sie kippt zu Boden. Maggi, die neue Kassiererin eilt zu Hilfe. Helga jault als hätte ihr jemand ein Stück Fleisch herausgeschnitten. Wie ein halber Hammel sackt sie in Maggis Arme. Gemeinsam straucheln sie im schmalen Thekengang als würden sie eine flotte Sohle über die Fliesen schieben.
Aus dem Büro des Chefs schallt Gelächter. Herr Jungspund tritt auf, betupft mit den Zeigefingerknöcheln seine Augenwinkel, das Gesicht puterrot. „Alles in Ordnung? Ich hätte dann gern zwei Würste.“ Frau Keun presst ihre Wutfaust auf die Waage. „Das macht dann 12,50 Euro.“
„Für zwei Würste?“
„Ja, zum Wohle der Filiale, um Fleischeswillen, ja!“
Frau Keun wirft sich den Mantel über. Mit steifen Knien und einem Ziehen in den Hüften stakst sie zum Bus, zieht sich die Stufen zu ihrer Wohnung hinauf. „Herbert, ich bin‘s“. Herbert kommt, seine Nasenflügel flattern: „Bratwurst“, sagt er und zieht sich zurück. Helga legt die Käsebrotherzen auf seinen Platz. „Für morgen und das Kommende“, schreibt sie mit Tomatenmark auf die Tischplatte. Als Herbert an diesem Abend in die Küche schleicht, füllen sich seine Augen mit Tränen. Als er den Aufschnitt riecht, würgt er. Er beugt sich vor, schaut Helga in den offenen Mund. Ein Wurstzipfel liegt still in ihrer Wange. Käsereste strampeln sich Herberts Speiseröhre hinauf, klumpige Spucke sammelt sich, sprudelt heraus auf Helgas Pantoffeln. Er geht zu Bett.
Kurz vor Arbeitsbeginn schreckt Helga aus dem Schlaf, findet die breitgeschobene Brockenmasse auf und unter ihren Pantoffeln. Der Geruch hängt in den Gardinen, über dem Gewürzregal. Aus dem Spiegel grinsen sie Wurstfetzen an, der breiigen Masse am Fußboden nicht unähnlich. Auf Sockensohlen schleicht sie aus der Wohnung.
Hinter der Wursttheke wirft sich Frau Keun genau abgemessene Leberkässtücke in den Rachen, schiebt Wiener nach, aber die Fleischlust fordert mehr. Jeden Tag bringt sie jetzt Nachschub, den sie anderen in Rechnung stellt, versteckt ihn in der Tiefkühltruhe im Keller, legt ihn daumesdick auf Herberts Stullen.
Herbert schweigt, Helga hat ihren Aufschnitt. Die Monate bis zur Rente formt sie Mettigel und Wurstpralinen in Aspik, Spieße und Schnecken, nimmt sich hier und da einen Zipfel, nie das ganze Steak. Ihren wurstfreien Ruhestand feiert sie ausufernd. Sektkorken knallen, Käseröllchen und Spieße zirkulieren durch die Regalreihen.
Freudig schwingt Helga die Wohnungstür auf: „Geschafft! Ich bin wurstfrei!“ Herbert sitzt am Küchentisch. Eine angebissene Käsesemmel liegt auf seinem Teller, nahe seines Haaransatzes. Kein strahlender Empfang, kein Wort, keine Atmung. Helga tickt mit ihrem Zeigefinger an seine Schulter, kippt gegen die Wand. Tot! Helga grinst semmelbreit, bevor es sie trifft, zu Boden wirft, sie geschüttelt wird von Erinnerungen an Auf- und Käseherzenverschnitt.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Laura Kind
Radschlag.
Die Frau kramt fahrig in ihrer Handtasche. Luca hält ihr ein Ticket hin: „Das macht dann fünf Euro, bitte.“ Ihre Tochter, vielleicht zehn Jahre alt, zerrt an dem handtaschenfreien Arm. Die Mutter sagt „Moment, bitte“, mehr zu dem Kind als zu ihm. Luca wartet geduldig, ungeduldig zerrt dabei das Kind am Kleid der Mutter. Sie lässt einen Schlüsselbund und ein benutztes Taschentuch fallen und entschuldigt sich. „Passend haben Sie es nicht?“ „Nein“ und entschuldigt sich erneut. Luca nimmt den Zehneuroschein, die Kasse klickt, das Kind rennt schon vor. Luca gibt der Frau das Restgeld und wirft einen Euro in die Trinkgeldkasse. Er schaut kurz rüber zur Schwester, die das Rad bedienen soll, doch Giulias Augen kleben auf dem Bildschirm ihres Handys. Luca drückt einen Knopf, „Alle einsteigen bitte!“ Die Stimme eines anderen gibt die Worte wieder, die er ins Mikrofon spricht und die Lautsprecher fordern die Gäste auf, sich festzuhalten. „Spaß, Spaß, Spaß! Jetzt geht’s los!“ Die Musik von Vaters CD übertönt das Schreien des Kindes, ob vor Freude oder kurzfristig auftretender Höhenangst ist ungewiss, die Mutter winkt dem Kind mit der einen Hand und kramt mit der anderen immer noch in der Handtasche. Nach drei Umdrehungen fällt das Kind der Mutter um den Hals, ruft „noch einmal!“, doch die Mutter schüttelt den Kopf, verspricht Eis und denkt an Ruhe. Das Mädchen nickt, Luca ist überrascht von der schnellen Einsicht. Die letzten Gäste des Abends lassen das Riesenrad und die Lichter hinter sich. Selbst bei Marco ist nichts mehr los. Später kommt der Vater vorbei und fragt, wie das Geschäft denn so läuft. Giulia schaut weiter auf ihr Handy, Luca zuckt mit den Achseln. Der Vater öffnet die Kasse und nickt zufrieden. Er sieht nicht die Leere des Parks, nicht die fünfzehn Euro und die drei Gäste, die sich hinter dem mitgebrachten Wechselgeld verbergen. „Na, ein Stündchen lohnt es sich bestimmt noch!“ Luca nickt. Vielleicht würden später noch ein paar betrunkene Jugendliche vorbeikommen, ein Liebespaar oder sonnenbeschwipste Urlauber, die darauf hoffen, dass der See im Dunkeln der Nacht doch noch zu einer Sehenswürdigkeit wird, zumindest aber zur Kulisse für Romantik und große Gesten. Einmal, vor ein paar Jahren, gab es einen Heiratsantrag. Luca hat zwanzig Euro Trinkgeld bekommen und das Rad zehn Minuten angehalten. Er hat die CD des nervösen Gastes eingelegt und denselben Song dreimal hintereinander abgespielt. Die anderen Gäste hatten sich beschwert. Doch die Lautsprecher sprachen lauter als die anderen Gäste sich beschweren konnten. Dann hat es an dem Abend für die Bürger ein Feuerwerk und Kondensstreifen in grün-weiß-rot am Himmel und für Luca viel Trinkgeld und mehr Gäste als sonst gegeben. Am Wochenende hat er seine damalige Freundin zum Essen auf der Piazza eingeladen und ihr gesagt, dass er sie liebt. Sie liebte ihn nicht, das fand er jedoch erst drei Monate später heraus.
Das Riesenrad ist 51 Meter hoch, doch was die Menschen immer wieder anlockt ist nicht die Aussicht, die mit der Höhe, sondern das Hochgefühl, das mit der Erinnerung an Kindheit kommt. Die letzte Saison war denkbar schlecht, kaum Touristen, kaum Umsatz. Und selbst als man durfte: Riesenradfahren war etwas für gute Zeiten, für vergangene Zeiten, oder die, die noch in der Zukunft lagen und für die man gerade nicht die Fantasie besaß. Das Unglück lag nicht nur in den Ereignissen, sondern vor allem dazwischen: In den Momenten zwischen den Männern in den Imkerkostümen und den vereinzelten Nachrichten aus der Klinik. Das Dazwischen war der Vater vor dem Herd, nichtwissend wohin mit den Armen und der Angst, das waren die Anrufe, die nicht durchgestellt werden konnten und das allmähliche Erblinden der Fenster und Weiterscrollen im Newsfeed, der immer dieselben Bilder zeigte. Als Luca die Lichter des Riesenrads löschen wollte, hat der Vater ihn angefahren: „Sie kann das spüren. Die Lichter müssen leuchten und das Rad muss sich drehen!“ Als die Mutter wieder nach Hause dufte, ist der Vater mit ihr zum See gefahren. Luca hat der Mutter beim Einsteigen geholfen und dann das Rad zur Hälfte gedreht. Er hat Gianna gespielt, weil die Mutter einmal auf einem Konzert gewesen war. Sie hatte ein Plakat gekauft und es im Wohnzimmer aufgehängt, wo es durch Vaters Zigaretten vergilbte. Nun saßen sie oben, ganz klein in ihrer Kabine, bis der Vater ihm zuwinkte und er das Rad wieder nach unten drehte. Die Mutter sei nun müde und müsse sich hinlegen. Im Schein der Lichter sah das Gesicht der Mutter noch fahler aus. Am Stand nebenan hat Luca sich weiße Zuckerwatte gekauft und mit Marco vom Zuckerwattestand ein Bier getrunken. Eine ganze Weile lang haben sie schweigend dagesessen und aufs Wasser geschaut. Luca nahm einen Schluck von seinem Bier. Es war lauwarm. „Das geht nicht mehr lange gut.“ Marco nickte. „Wem sagst du das.“ Mit dem Morgengrauen ist er dann heimgekehrt, hat die Fensterläden aufgerissen, um Licht und Luft hineinzulassen und Kaffee aufgesetzt. „Wir könnten das Rad verkaufen.“ Er stellte Satz und Kaffee auf die Plastiktischdecke, beides klebte noch daran, als er die Hand nach der Tasse ausstreckte und einen Schluck trank. „Die Leute sind schon davor immer weniger gekommen.“ „Es hat immer mal schlechtere und mal bessere Zeiten gegeben.“ „Und seit ich denken kann gibt es nur noch schlechte.“ Der Vater schaute besorgt die Mutter an, die gerade etwas Kaffee verschüttet hatte. Luca nahm einen Spüllappen und wischte den Kaffee und die Wörter, die er noch sagen wollte, weg. Die Bedenken blieben. „Nein Luca, die Leute werden schon wieder kommen. Es ist einfach schwierig im Moment. Für alle ist es schwierig.“ Luca zuckte mit den Achseln. „Ich dachte nur. Wir könnten auch einen Bootsverleih oder sowas machen. Für reiche Leute, die sich einen schönen Tag auf dem See machen wollen.“ Die Mutter hustete und verschüttete noch mehr Kaffee. Der vorwurfsvolle Blick des Vaters drängte ihn nach draußen, er hörte noch den Vater sagen „Komm, Tesoro, leg dich noch etwas hin und ruh dich aus.“. Wie schnell die Stimme kippen konnte, wie schnell sie brüchig wurde, wie schnell Brüche entstanden, dachte Luca noch. Das war heut früh.
Jetzt sitzt Luca am Steg, einer, der noch niemandem gehört und damit jedem, also auch Luca. Er hat gerade das Fahrgeschäft zugemacht. Giulia ist schon seit Stunden weg. Sie hat seit ein paar Monaten eine Setkarte in einer Agentur und nun ihren ersten Job für eine Modekette. Einmal würde sie nach Mailand gehen. Jetzt läuft sie aber noch mit den Tüten der Modekette über die Seepromenade. Sie trägt dabei hohe Schuhe und eine aufwändige Frisur und den Kopf erhoben. Manchmal trifft Luca sie auch in der Fußgängerzone, wenn er sie fragen will, ob sie mit ihm abends die Kasse macht. Aber sie wird zu ihrem Freund gehen und Luca wird allein die Kasse machen und den Eltern nichts sagen, nicht, dass Giulia nur noch einmal die Woche die Kasse macht, nicht, dass ihr Bild in einer Kartei ist, nicht, dass die Gäste ausbleiben und auch nicht, dass sie bald eh schließen müssen, wenn sie nicht verkaufen. Die Lichter flirren wie tagsüber die Hitze über dem Asphalt. Wenn es richtig heiß ist, kleben die Schuhsohlen am Boden fest, das fühlt sich dann an als sei man in Kaugummi getreten. Luca beobachtet ein paar Touristen, wie sie von der letzten Fähre schwappen, wie ihr Strom auf die Piazza fließt, wo sie essen, trinken, bett- und weinschwer in ihre Hotelzimmer gehen, sich auf den Betten mit den ihnen unverständlichen Decken fallenlassen, so wie sie ihren Müll überall fallen- und liegenlassen. Sie waren schnell wiedergekommen. Die Zeit hatte nur kurz angehalten, dann hatte sie sich weitergedreht. Luca kauft sich eine Focaccia und ein Bier. Er geht auf die Piazza und trifft ein paar Freunde, die er lang nicht mehr gesehen hat. Seine Ex-Freundin ist auch da. Er spricht kurz mit ihr. Morgen wird er Giulia nach Mailand für ein Casting fahren und sich bei einer Werkstatt um eine Ausbildung bewerben. Er wird erst spät abends zurück sein. Das Riesenrad wird stillstehen und niemand wird an der Kasse sitzen, um das Geld eines Fahrgastes entgegenzunehmen. Der Vater wird mit der Mutter einen Bootsausflug machen und erst vom See aus bemerken, dass das Riesenrad im Dunkeln liegt. Die Gischt wird das Wasser marmorieren und die Mutter wird schwere Beine und leichte Gedanken haben. Sie wird sagen, dass sie Bootsfahren liebt und die Haare und ihr Lachen dem Wind überlassen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Maik Gerecke
Alles auf Null
Ich musste einfach raus. Raus aus dem Alltag, raus aus Berlin. Ich liebe die Stadt, keine Frage, aber welche Beziehung hat bitte jemals zu viel Nähe vertragen?
Deswegen kam der Auftrag gerade richtig. Es ging um ein »Schloss«, wie die Eigentümerin es nannte, für das sie leider bis nächste Woche schon ein Gutachten bräuchte. Geld spiele keine Rolle. Mein Kollege Frank hatte die Nase gerümpft und »Dit is ja fast in Polen« geseufzt, aber ich sah darin sofort die Gelegenheit. Deshalb übernahm ich das für ihn opferte der Firma heldenhaft mein Wochenende. Gleich gegenüber vom Objekt liegt ein alter Getreidespeicher oder so was, den man zu einer Art Herberge umfunktioniert hat. Mit Kneipe unten drin, perfekt also. Ich nahm mir ein Zimmer und verließ am Freitagmorgen die Stadt, nichts ahnend, dass dieser Zufall nicht so glücklich ausfallen sollte, wie es den Anschein erweckte.
Das Schloss ist in miserabler Verfassung. Mauerwerk und Fundament sind gerade noch zu retten, aber der Wald nagt schon daran. Insgesamt ist der Bau so marode, dass die Sanierung mehr kosten würde als der Neubaus. Zudem hat es sich eine beachtliche Population brauner Langohrfledermäuse unter dem Dach gemütlich gemacht.
Am Abend nach der Begehung sitze ich gegenüber auf der Terrasse und beobachte, wie eine rot-braun getigerte Katze zielsicher um die Schlossfassade schleicht. Von hier aus ordne ich eher in die Kategorie Altes Gutshaus, wofür auch die Bauinschrift an der Front spricht.
»Willste noch eens?« reißt mich der Kneipier aus den Gedanken und zeigt auf mein leeres Bier. Ich nicke, reiche ihm das Glas und frage bei der Gelegenheit, was er mir über das Gebäude erzählen kann. Er lächelt müde.
»Dit Ding hat mehr Regime jesehen wie icke«, schmunzelt er. »Ende 17. Jahrhundert gebaut, um 1900 rum komplett-erneurt, dann: Kaiserreich, Weimarer Republik, Nazis, Osten, Kapitalismus. Und den Klimawandel überlebt’s auch noch. Wett ik drauf.«
Ich stelle gern solche Fragen unter Ansässigen, will Entscheidungen über ihren Lebensraum nicht allein der Willkür von Hausbesitzern überlassen; und es ist auch vorgekommen, dass ich ein Objekt der Denkmalschutzbehörde gemeldet habe. Oder dem Naturschutz.
Ich bedanke mich für die Auskunft und der Kneipier zieht ab. Zu meiner Überraschung sind die Tische gut besetzt und ich fühle mich fast etwas einsam so allein an meinem. Alles lacht und erzählt und als mein Blick über all die fremden Gesichter hinweggleitet – sehe ich sie plötzlich. Eine Familie mit zwei Kindern betritt gerade die Terrasse und setzt sich an ihren Tisch. Herzliche Umarmungen, Wangenküsschen, Gelächter. Die Szene zieht nur kurz meine Aufmerksamkeit auf sich, aber mehr braucht es nicht, um sie zu erkennen. Ihr Anblick lässt mich schockgefrieren. Wie kann das sein! Sie? Hier? In diesem Kontext?
Sie sieht anders aus als damals, trägt Make-up, hat sogar eine richtige Frisur. Trotzdem genügt ein Blick in ihre Augen und all die bitteren Gefühle, die ich über Jahre so mühselig in irgendeine finstere Ecke meines Unterbewusstseins verfrachtet habe, sind binnen Sekunden wieder da. Als wären sie nie weg gewesen.
Sie heißt Marla und sie ist der erste Mensch, dem ich im Leben wirklich begegnet bin. So beschreibe ich es bis heute, wenn ich von der »guten alten Zeit« erzähle. Kennen gelernt haben wir uns in der Welt der linken Hausbesetzer, auf einem Konzert, das jemand in seinem Wohnzimmer veranstaltete. In der Brunnenstraße 183 war das. Marla wohnte damals in der Liebig13, ich in der Köpi, und wie alle unsere Freunde, glaubten wir fest, dass Anarchie und Kommunismus eine Zukunft hätten.
Wir entdeckten schon nach drei, vier Sätzen unsere gemeinsame Leidenschaft für alte Häuser. Es dauerte keine Stunde und wir waren ein Team. Nicht mal eine Woche verging, bis wir ohne große Worte klar kommunizieren konnten: Marla zeigte mir ein Foto, zum Beispiel vom Stadtbad Lichtenberg, ich sagte: »Sonntag?«, überlegte, ob ich nochmal meinen Dealer – aber sie sah meinen Ausdruck und sagte: »Hab noch genug« und ich sagte: »Na gut, dann kauf ich den Wein.«
Wir bereisten eine Berliner Ruine nach der anderen, verbrachten ganze Nächte darin, studierten ihre Geschichten, erzählten sie weiter bis ins 23. Jahrhundert. Wir fühlten uns wohl, so seitab der Welt und in den Überresten vergangener Zeiten spukend, hatten keine Angst, wenn es dunkel wurde. Wir waren die Gespenster, die dort ihr Unwesen trieben.
Ein Abenteuer, an das ich mich bis heute gerne erinnere, ist das Haus der Statistik am Alexanderplatz. Unser mit Abstand größter Coup. Es war an Silvester und wir hatten über hundert Euro im Baumarkt gelassen – ein Seil, ein Brecheisen, Schutzhandschuhe – hatten der Kassiererin dieses offensichtliche Jungeinbrecher-Starterkit aufs Band gelegt und die hatte uns mit erhobener rechter Augenbraue angestarrt, bevor sie schweigend die Preise in die Kasse tackerte.
Als wir uns später seitlich an den Flachbau heranpirschten, war es längst dunkel und in der Ferne explodierten Böller und Raketen, während wir im Schutz der Büsche ein Fenster aufhebelten. Es dauerte ewig, bis wir drinnen waren, aber sobald unsere Füße auf dem alten Büroteppich standen, tanzten und kicherten wir wie zwei Grundschulkinder. Unser Ziel war das Dach des zweiten Turms von wo aus man direkt auf den Fernsehturm schaut. Der Weg dahin führte uns durch dunkele Kellergewölbe, über Möbelberge, wir kletterten aufs Zwischendach, drüben wieder rein. Ständig trafen wir auf Hindernisse, mussten umkehren, einen anderen Weg suchen. Aber wir gaben nicht auf. Wir gaben nie auf, wenn wir zusammen waren.
Nach über einer Stunde endlich im zehnten Stock des zweiten Turms angekommen, verzweifelten wir beinahe an der Suche nach dem Dachaufgang. Wir irrten durch verwüstete Flure, Klos und Büros und vor den Fenstern explodierten Raketen im Sekundentakt, tränkten die Dunkelheit in jede Farbe des Regenbogens. Bilder wie aus einem Traum. Und als wir endlich das Dach betraten, war das ein Gefühl für das ich bis heute keine passenden Worte finde. Unter uns die Stadt, die Menschen klein wie Insekten, gegenüber der majestätische Fernsehturm und um Null Uhr ein Feuerwerk – buchstäblich aus der ersten Reihe – zu dem wir Sekt aus Plastikbechern tranken. Dort oben war man jenseits der Dinge. Sah der Realität nur zu. Du warst, was du bist, ohne Angst vorm Gestern oder Morgen. Nicht mal nach Drogen verlangte es uns, wir vergaßen sie einfach. Stattdessen teilten wir jedes letzte Geheimnis, von dem man wirklich nie gedacht hätte, es jemals irgendwem zu erzählen. Alle Grenzen waren offen und wir so high von dieser Nacht, dass wir beschlossen im neuen Jahr alles auf Null zu setzen. Es besser zu machen als jemals zuvor. Was immer das bedeuten mochte.
Etwa zwei Jahre nachdem Marla verschwunden war, krempelte ich mein Leben komplett um. Ich machte unsere Leidenschaft zu meinem Beruf und wurde – Baugutachter. Genug gekämpft, dachte ich, genug geopfert und gescheitert. Das Kapital spekulierte weiter die Welt zugrunde, schluckte unaufhaltsam ein Hausprojekt nach dem anderen, renovierte und kernsanierte ihre Frei- und Vergangenheiten davon und ich – zog in eine Schöneberger Altbau-Wohnung. Zwei Zimmer, Küche, Bad, 65m², Dielenboden und Stuck an der Decke.
Und jetzt – jetzt sitzt sie einfach da, Marla, und ich kann nicht anders, als zu starren. Irgendwann bemerkt sie meinen Blick und erkennt mich sofort so wie ich sie vorhin, was ihren Gesichtsausdruck in sich zusammenfallen lässt. Das Tischgespräch zupft von rechts und links an ihr und sie bemüht sich zu tun, als wäre nichts. Dabei schaut sie ständig heimlich zu mir rüber. Ähnlich wie damals in der Brunnenstraße.
Nach 15 Minuten Augenpingpong steht sie auf. Sie verlässt ihren Tisch und läuft Richtung Tresen, aber kurz bevor sie im alten Getreidespeicher verschwindet, wirft sie mir diesen kurzen Blick zu, den ich sehr gut kenne. Und ich stehe auf, um ihr nachzulaufen.
Im Jahr nach dem Dach wurde dann die Liebig13 geräumt und ab da ging’s steil bergab. Marla zog zu mir in die Köpi und ich verlor kurz darauf meinen alten Job. Wir verschmolzen in diesem Jahr, waren ohneeinander nicht mehr vorstellbar. Manchmal waren wir tagelang unterwegs, tranken und koksten uns durch Bars und Clubs, zerstreuten uns danach und wussten Tage-, mitunter Wochenlang nicht, wo der andere war. 2014 starb Marlas Großmutter und hinterließ ihr eine Geld. Viel Geld! Marla ergriff die Gelegenheit und lud mich ein mit ihr auf Reisen zu gehen. Sie wolle raus, meinte sie. Raus aus allem. Erstmal Europa, dann mal sehen. Es wurden unsere beste Zeit seit Langem. Jeden Tag eine neue Stadt, ein neues Land oder Lost Place irgendwo in Europa.
In Portugal dann, mitten in Lissabon, verschwand Marla. Kein Abschiedsbrief, kein Warum, nichts. Typisch Marla. Nur ein paar Hundert Euro auf dem Nachtisch. Ich respektierte ihren Wunsch, fuhr ein paar Tage später nach Deutschland zurück und sah sie nie wieder.
Als ich an der Theke vorbei zu den Toiletten gehe, steht Marla schon da und wartet. Sie sieht mich an, schüttelt den Kopf, zieht die Schultern hoch und ich antworte indem ich mit dem Arm in Richtung Schloss zeige. Marlas Augenbrauen sagen: War klar, dass wir uns so oder so ähnlich wiedersehen. Und ich nicke: Allerdings. Sie seufzt und ihre Augen sagen: Tut mir leid, du kennst mich ja, manchmal bin ich einfach weg; und meine Mundwinkel antworten: Weiß ich doch, und meine Handgeste sagt: Schon OK. Dass sie nicht mit mir rüber ins Schloss gehen wird, habe ich schon verstanden und auch, dass sie noch eine Weile hier bleiben will, deswegen frage ich jetzt laut: »Neu bauen oder Denkmalschutz?« und zeige Richtung Schloss.
Ihre Augen halten an mir fest, wie damals immer, und ich weiß genau, was sie jetzt denkt und fühlt und warum und was sie gleich sagen wird.
»Denkmalschutz«, sagt sie.
Ich nicke und lächele.
Dann gehe ich hoch und packe meine Sachen.
.
Der Text entstand in einem Literaturworkshop im Rahmen des Projekts ‚Und seitab liegt die Stadt‘ des LCB Berlin. Er wird in Kürze zusammen mit anderen in der Anthologie ‚Ich muss hinaus. Die Stadt ist eine Gruft‘, herausgegeben vom Ökospeicher e.V. Wulkow, erscheinen. >> Nähere Infos <<
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sophie Schagerl
Friseurbesuch, abgeschnittene Enden
Draußen schwimmen die Fische ums Aquarium, lese ich. Draußen schwimmen die Fische ums Aquarium. Bei jeder Rückkehr schrumpft die Stadt zu einem Kloß unter dem Küchentisch zusammen, so weit habe ich mich gefühlt. Da ist etwas, das ich nicht weiß, um das ich nie Bescheid wissen werde, es ist die Gemütlichkeitslage, wo versteckt sie sich unter all den Übermalungen an der Wand?
Ich trete aus der Tür. Hier bin ich, bin ich, bin ich, mich sehen all diese Menschen, die ich sehe, wie sie ihre Leben in Girlanden verwirbeln ein Zirkuszelt aufstellen mitten auf der Einkaufsstraße, die über meinem Kopf Loopings schlägt, während ich gehe und an meine überanstrengten Beine denke. Ich fühle meine Oberschenkel, immerhin hier ist mein Körper er wird gesehen wird begutachtet und für anders befunden. All die Girlandenmenschen sehen mich und denken, diese Beine sind nicht meine nicht ihre nicht eure sie sind dort, wo die Girlanden entwirrt werden, nichts davon gehört zu meinem eigenen Wirrwarr.
Eine Tür fällt hinter mir zu, ich lasse meine Haare anfassen, jemand schneidet mir über meinem Gehirn etwas ab und ich schaue leicht nebelig von all diesen Girlanden all dieser Zirkusmusik in den Spiegel und sehe das gemächlichste Haarfegen hinter mir geschehen, das gemächlichste aller — das ich je gesehen habe. Da schreitet dieser Mensch und fegt und fegt und hat einen Wirbel am Kopf, wo mir eben alles abgeschnitten wurde, all die Fische und all die halben Jahre, die ganze halbe Zeit, da wippt der Schopf mit dem Fegen im Takt, wiesegleich wippt sie durch den Raum, diese fremde Girlande und schaut mich an mit ihrem Ichhabdichgesehenblick, das bringt mich aus der Umgebung. Das treibt mich davon aus dem Spektakel hinein in die Tagträumerei, was ist das jetzt wirklich mit den Abständen, die gibt’s, das habe ich gelernt, die Abstände, die gibt’s.
Die Schluchten habe ich erst gesehen, vom Randstein fällt die Welt steil bergab schneidet sich ein Flüsschen einen Graben, eine Träne: ein Graben, der für ordentliches Klettergeschick nicht bürgt und sich ins Fäustchen lacht bei all den Wanderungen Irrungen als ob da jemand an die Quelle gelangen könnte, die ist völlig überwuchert.
In meiner Abwesenheit sehe ich sie schon hantieren mit der Gartenschere, mähe mir meinen Rasen, möchte ich ihr zurufen, mähe mir den Rasen, zupfe an den Stauden und den Flechten, lass sie rieseln, möchte ich ihr zurufen, oder entkommt es mir, halte mir kurz die Hand vors Gesicht und greife nach der Brille, vor mir abgelegt, um sehen zu können, durch den Spiegel, ob sich denn im Blick der Schneidenden ablesen lässt, dass ich mich hörbar gemacht habe. Ob ich wirklich in den Garten gerufen habe? Ich sehe, ja, sie fängt den bebrillten Blick und hält inne beim Grasen kurz, sagt aber nichts, irgendwann ein Abwenden, ich setze die Brille auch wieder ab und falle zurück in die Ausgangsposition, die ohne jede Klarheit ohne Haltung auskommt, in ausreichender Sprachlosigkeit.
Alle Worte einfällig, nicht aufgeschlagen nicht ausgedrückt, sie fallen in mich ein und wenden sich ab zur Gänsehaut. Ich reibe an meinen Armen, gerade die Oberschenkel verloren, spür ich nicht mehr, jetzt wende ich mich den Armen zu und hole aus zur Aufmerksamkeit, die noch übrig geblieben ist vom Blickkontakt. In mir purzelt die Grammatik, vor allem die Suffixe schlagen übereinander, da lässt sich kein Abschluss finden beim Einfallen, das geht weiter und weiter und weiter, das Silbengestotter nimmt kein Ende und das Schneiden dauert auch so lange. Draußen schwimmen die Fische ums Aquarium, denke ich, wo wachsen die Pflanzen, wo verstecken sich die Fische, während sich die abgeschnittenen Enden in mir verstecken?
Zurück zuhause liege ich im Bett, das ich ins Zentrum des Raums gestellt habe. Ich betrachte die Möbelstücke, die ich im Laufe des letzten Jahres angetragen habe, um ihn gänzlich ausgefüllt erscheinen zu lassen. Ich habe diesen Schrank gekauft, damit er Raum einnimmt und diese Vorhänge, damit sie abschließen. Ich habe diesen Schrank gekauft, damit du ihn siehst und diese Vorhänge, damit du eintrittst in den Raum und dich freust über das Abgeschlossene, inmitten dessen du dich befindest. Die Möbel erfüllen alle einen Zweck, den Zweck, von dir gesehen zu werden. Sie stehen da und stauben an und werden bloß von mir betrachtet, liegend frage ich mich, ob sie zerfallen werden, wenn ich aufhöre, an dich zu denken.
Ich liege hier und versuche mich auszubreiten, breitbeinig liege ich hier, die Zehenspitzen an den Bettecken ausgerichtet und an mich klammere ich die schwerste der Decken. Als ich hier eingezogen bin, erinnere ich mich, hast du aus dem Fenster gespuckt und mich gefragt, wo ich bin. Schau mich an, wir tanzen, hast du gesagt. Da gab es noch keine Vorhänge und dementsprechend keine Abgeschlossenheit und so weht alles aus dem Fenster, alles, das du sagtest, auch das Tanzen ist nicht geblieben. Dann kamen die Möbel.
Ich strecke mich, hebe das Kinn. Ich betrachte mir die Kästen und Vorhänge und Stühle und Stuhlbeine, die alle bloß deinetwegen hier sind. Die Farben habe ich meinetwegen ausgewählt, aber die Formen, die Füllung, die ist für dich. Ich habe schwere Möbel mit schlanken Beinen ausgewählt, die punktuell aufs Parkett drücken, vielleicht Auszugsmale hinterlassen, wenn ich die Augen schließe und sie dann verschwinden wie du. Seitdem du verschwunden bist, sehe ich all diese Zirkusgirlanden an den Straßenrändern, die Stadt feiert Feste, trompetet und fegt Haarschnitte über die Randsteine, seitdem du verschwunden bist. Ich dagegen sammle Möbelstücke, die den ganzen Raum ausfüllen sollen.
Einmal in der Woche gehe ich treppab an einem herbstlich schwach beleuchteten Lampenladen vorbei und frage mich, welcher Schirm zu welchem deiner Hüte passen könnte und sehe dich rückwärts aus der Tür treten und sagen: „Wo bist du? Lass uns tanzen.“ Ich drehe Pirouetten in Gedanken, senke das Kinn, versuchend, den Blick abzuwenden von den üppigen Oberflächen, die mich an vergangene Entscheidungen erinnern. Es gelingt nicht, da stehst du fast im Raum und sagst: „Ich glaube, du brauchst eine Typveränderung, draußen verändern sich die Farben.“ Du öffnest den Schrank, den rechts im Blickfeld, die Tür macht leise Schwinglaute. Du ziehst das schwarz-weiße Hemd heraus, das ich von der letzten Reise mitgebracht habe, und hast recht, es war eine Herbstreise. Hältst es dir überzeugt vor die Brust, „Was meinst du, passt das zum Wind draußen?“ Ich nicke unentschlossen, liege hier im Zentrum des Raums und es ist mir gänzlich egal, was ich mir für die Außenwelt anlege. Ich verstehe sie nicht, im Moment.
Erhebe mich und lasse das Nachbild von dir im überfüllten Raum zurück, ich denke, es ist Zeit für einen Spaziergang, das Dämmerlicht zieht mich aus der maulwurfsblauen Decke, an den Zehenspitzen zuerst und kippt mich, die Füße kalt, Schuhe sind auszuwählen. Ich habe alle Schnürsenkel abgerissen, fällt mir auf, also trage ich Sandalen und klappere ins Freie, das mich sogleich überfällt. Die Feierlichkeiten dauern noch an, die Girlanden sind noch nicht in die Nacht verschluckt, haben noch keine Bars und Getränke ausgewählt, sie schwingen noch über die Zebrastreifen und sind laut dabei.
Es pfeift förmlich, mir pfeifen die Überreste der Feierlichkeiten, ich mag mir die Ohren zuhalten, aber ich halte nur aus und hole dann aus zum Klapperschritt, flappe um die Ecke, aus Gewohnheit sehe ich mir den Asphalt dort etwas genauer an, er fleckt und irgendwo hier hast du hingespuckt, als du mich gefragt hast, wo ich bin. Was feiern sie alle, schreit es mir aus den Korridoren, ich verdutze mich, schnell weiter eingliedern in die Routine, es hallt aus den Gewinden, ich verliere langsam die innerliche Liegehaltung und hasche nach den Girlanden auf der Straße, nicht mit den Händen, Girlanden sind keine Möbelstücke zum Festhalten, nur Luftschlangen, bunte.
Die ganze Stadt riecht nach Schokolade ich pruste laut schnupfe die Süßigkeiten regnen überall aus den Fenstern qualmt die Radiomusik des letzten Jahrhunderts, ich hüpfe schneller, fühle wieder meine Beine spannen, spanne mit meinen Schritten weit ausholend über die Fugen Risse in die Straßen, die Schatten der Rauchfänge möchte ich nicht einfangen mit meinen Schritten nur schnell weg von dieser Musik.
Wieder während dem Liegen stelle ich mir fast vergessenes Gefühl vor. Ich stelle mir vor, im Eckzimmer des Mutterhauses auf den Schlaf zu warten, der nicht kommen mag, den ich mit Willenskraft vertreibe, weil draußen noch Schritte zu hören sind, die in die Küche und zurück, die aus der Küche ein Glas Himbeersaft holen und jemandem vorsetzen, der nicht zu Besuch ist. Ich könnte Himbeersaftgeräusch verpassen, sollte ich jetzt einschlafen.
Ich höre die schlechten Dielen klappern unter den bloßen Sohlen oder unter den Holzschlapfen, die gab es einmal, als ich nicht auf den Schlaf warten wollte, das Glasgeräusch schwingt kurz, und durch den Türspalt ein Schimmer wie ein Schimmer Leben, der schüttelt die Decken auf und setzt auf beide Augen einen Kuss Ruhe, ruhige Schlaflosigkeit durch den Türspalt. Ich hebe das Kinn, vor allen Spalten steht jetzt ein Kasten, Massivholz, auf dessen Hochglanzoberfläche sich der Vorhang spiegelt. Verkaufe ich diese Vorhänge, frage ich mich.
Irgendwann ist es Zeit, die Möbel allesamt zu verkaufen, denkst du. Du denkst den Satz zu Ende und fühlst ein unregelmäßiges Pochen, irgendein Organ hält inne und möchte nicht ausräumen, irgendein Organ hat einen bittersüßen Anfall, nur ganz kurz, kaum merklich. Immerhin hast du bereits so oft begonnen, diesen Satz zu denken, so oft hast du gedacht, vielleicht sollte ich die Möbel allesamt — dann abgebrochen.
Dir fällt überhaupt auf, dass — dir fällt auf, die Zeit im Zeichen verschiedener Anfänge zu verbringen, aber nichts — nichts und wieder — zu Ende zu — Nichts hast du vollendet, verkauft. Nichts bist du losgeworden, nichts hat dich ausgezeichnet, bis auf all die leuchtenden Anfänge. All das Sektglasanstoßen, auf ein Neues — ein neues Jahr zuerst, dann auf neue abgeschnittene Enden. Winterlich hattest du noch an leuchtende Enden geglaubt, welch eigentümliche Verwirrung, wir waren keine Himmelskörper.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at