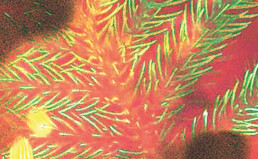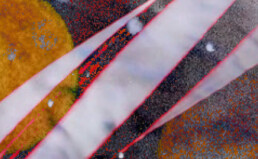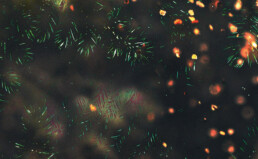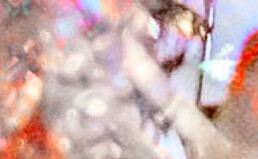14 | Lea Menges
tektonik
i.
beschreibe einen aufbruch
es zieht die watte im magen zusammen
braut dumpf
raufasertapete und hirnrinde und verbinde augen mit
welche furchen im sehfeld
wie man nachfahren soll
ii.
die angst verlassen zu werden
ein windhund mit silberaugen
striemt mir wie styropor über die haut
steckt mir morgens in den knochen
wie mohn
iii.
bedecke abweichendes innenleben
knie aufschlagen statt adern
von der kamera geschluckte mondstrukturen
auf meine knie abgepaust
was es heißt, ebenen zu verschieben
schleckt luft über die pupille
rauschen taubenfedern ins zimmer
aus körpern gelöst
aus haut gepickt vor dem spiegel
quetsche ich talg und trauma aus meinen poren
betrachte meine eltern beim schlafen
in der wangentasche ein gefühl dabei
man kann kein ultraschallbild der lage machen
man kann nichts durch die bauchdecke wenden
den kreisläufen trotzen wie moos auf schnee
iv.
eine liste eingetretener veränderungen
die dinge auf lunge tun
ins atmende brennen
eine möglichkeit aus dem eigenen fleisch schnitzen
in der zukunft liegt
der feine ascheschleier
der mich nachts
mit den zähnen knirschen ließe
trüge ich keine spange
v.
meine stirn patrouillieren lassen es eitert
aus der achsel als ob es provisorisch wäre
zu schorf werden eine andere form von bleiben
ein erschrecken vor dem eigenen abheilen
das zu sichtbar ist das ich von meinem rücken kratze
knochigknotig unter fingerkuppen
öffne rippen wie hände die perlen ab
knackende wirbel säure tritt aus
der versuch reibungsfläche zu minimieren
scheitert der schmerz liegt längst im anatomischen grab
und da war nie fläche die mich deckte nur eine hand
der himmel kann sich selbst nicht gleichen
darunter ein körper es krampft ihn noch
zwischen beiden bald spanne
bald stand
.
Lea Menges
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
13 | Mario Schemmerl
Alles Frisch
Vor wenigen Wochen hast du dabei geholfen die Wände der Wohnung deines Vaters für Nachmieter zu weißeln. In einem der Zimmer hast du ein paar Jahre gewohnt. Eine Spanne wie ein Strich, abgehakt kurz. Während der Ausmalarbeiten hast du ein zwei Sätze darüber gesagt und gleich bemerkt, dass dein Vater keine Erinnerung daran besitzt wie schwer er dir damals dein Leben gemacht hat. Vor einiger Zeit hast du einmal damit angefangen, einfach losgeredet, weil du dir sicher warst, dass es für euch beide wichtig ist. Er sah auf selbstschuldige Weise betroffen aus, sagte nichts und wechselte bald das Thema. Du warst immer nachsichtig mit ihm. Immerhin hat er ein Kind verloren, deinen Zwillingsbruder. Und du wusstest ja auch nicht wie das geht, ohne Zwillingsbruder zu leben. Mit einem Vater in dessen Versteck, in dessen Höhle zu vegetieren, dass weißt du, das hast du gelernt. Mit deinem Auszug stand dein Zimmer für ein paar Jahre beinah ungenützt leer. Seine einzige Funktion war es als eine Art Wäschekammer zu dienen. Von den meisten Dingen hatte er zu wenig, aber zwei aufgeklappte Wäscheständer hatte er. Immer waren sie aufgestellt und immer hängte was auf ihnen. Beim Ausmalen machte ein dunkler Abdruck auf der Wand Probleme. Der Fleck stammt aus dir. Er ist das Werk deiner Einsamkeit. Dein Abdruck liegt wie einer der Schatten von Pompeji im Zimmer. Dort bist du gewesen. An dieser Wand gelehnt, nicht in Pompeji. Dort warst du nie. Das ganze Zeugs was tief in deiner Brust existierte, pulsierte und raus wollte, schlief immer wieder ein, wachte immer wieder auf und endete dann dort an der Wand. Nach dem Auszug hast du lange gelitten ohne zu wissen wie es anders geht als sich dabei wegzusperren. Vater wollte mit der Pension eine Veränderung. Fand sie mit einer neuen, kleineren Wohnung. An seiner Art des Verbergens hat sich nichts geändert. Es ist wie damals, nur ohne diesem Zimmer an dem dein Abdruck klebt.
Gestern. Eine Freundin befindet sich zurzeit in einer Rehabilitationsklinik für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Es war dir und deiner Freundin wichtig sie zu sehen, mit ihr zu sprechen, ihr zu zeigen, dass sie ein paar Stunden Fahrt wert ist. Am Hinweg, auf der Autobahn, wart ihr plötzlich in den Totenwinkel eines anderen Autos gerutscht um gleich wieder daraus zu entgleiten. Deine Freundin wachte aufgrund des kleinen Lenkmanövers auf. Du hast nur gesagt: ‚Kein Problem. Ich sah das Kommen.‘ Und ‚Ich werde sehr alt werden. Ich weiß nicht warum, aber das spüre ich schon lange.‘
Du wohnst mit dieser Frau zusammen. Zuhause musst du sie immer wieder darauf hinweisen, sie solle die Kerzen auspusten wenn sie den Raum verlässt. Sie vergisst das oft. Was die beiden Katzen betrifft glaubst du, dass sie euch ansehen als würdet ihr ihnen was bedeuten. Dabei habt ihr sie von ihren Müttern getrennt. Eiskalt sind wir.
Was wird dich begleiten, was wird man vergessen, was macht dich glücklich?
Du weißt gar nicht was du heute tun sollst. Einfach weiter machen, denkst du. Niemand weiß wie das geht. Bis sich die Sache mit dem Glücklich-Sein wieder einstellt. Für einen Moment. Das reicht.
Mit aller Frische denkst du dann, ja so war es.
Abends. Fast in der Badewanne ausgerutscht.
Dein Herz schlägt wie wild.
.
Mario Schemmerl
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
12 | Dorothee Krämer
aus zwei rudern
ich bin aus zwei rudern geboren sie fuhren
mit mir übern see
am morgen war das wasser eisblau und klar
am abend ein sumpfiges grün
die ruder steckten im moorigen grund
wir schlugen leck
ich kletterte an land
hinter meinem rücken hörte ich das
krachen der hölzernen ruder
sie rissen eine wunde in den see
übers land verteilten eidechsen
ihre bewegungslosigkeiten
in meinem rücken waren holzsplitter
jetzt trug ich einen eidechsenrücken
.
Dorothee Krämer
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
11 | Leonie Höckbert
Der letzte Gang
Zu Weihnachten gab es in ihrer Familie traditionell sehr viel Essen und noch mehr Bemerkungen darüber, wie schlecht so viel Essen ist. Mit etwas Glück gab es für Louisa auch den ein oder anderen ganz persönlichen Kommentar über ihr diesjähriges Weihnachtsgewicht. Wie bei der Gans, nur andersrum. Man wartete offenbar auf die mageren Jahre.
Ihre Kindheit war glücklich gewesen, glaubte sie, aber durch die letzten Jahre des ersten Erwachsenenalters fraß sich die wachsende Vermutung, dass sie bei damaligen Familienfeiern nur durchs Kindsein geschützt worden war vor den verstecken Spitzen und offenen Attacken der Verwandten. Sie saß zwischen den Beinen des Couchtischs und den Beinen der Großeltern auf dem Boden und was gesprochen wurde, ging buchstäblich über ihren Kopf hinweg. An die Weihnachtsfeste dieser Jahre dachte sie mit einem kerzenwachsweichen Gefühl zurück. Der Geruch der Tanne und des Parfüms ihrer Mutter und der von Holz, das im Kamin verbrannte, das alles gehörte so sehr zum Damals, dass Louisa es jetzt unpassend fand, an diesem Weihnachten, wo der Kamin genauso brannte und ihre Mutter dasselbe Parfüm benutzte und Tannen so rochen, wie sie es immer tun würden.
Louisa war in diesem Jahr aus Weihnachten rausgewachsen. Wie für jede Jahr buchte sie ein Zugticket nach Hause, wo ihr Vater sie mit jährlich müderem Gesicht abholen würde. Vor dem Kleiderschrank hatte sie ängstlich überlegt, welche Bemerkungen ihre Kleiderwahl provozieren könnte, und hatte dann direkt unterm Brustbein eine kleine Wut über diese Sorge entdeckt. Ein kleiner bitterer Zorn, den sie später in Ruhe genauer betrachten wollte. Sie spürte die Last der Vorweihnachtszeit, die man von Kindern fernhält. Die vielen Stunden auf der Suche nach passenden Geschenken, die sie sich leisten konnte, erschöpften sie und vom Plätzchenbacken bekam sie Rückenschmerzen. Niemand hatte sie nach ihrer Wunschliste gefragt. Weihnachten zehrte ihren Dezember auf und Louisa betrank sich zum Ausgleich mehrfach am Glühweinstand. Während sie schwallweise Glühwein erbrach, dachte sie daran, wie grotesk es war, nach inneren Blutungen auszusehen, aber nach den Gewürzen des Dr. Oetker Aktions-Aufstellers zu riechen.
Erst im Zug zu ihrer Familie fiel ihr die kleine Wut wieder ein. Sie war noch da. Louisa schaute durch ihr Spiegelbild im Zugfenster hindurch und wunderte sich. Sie freute sich nur auf ihren kleinen Neffen. Dem könnte sie im passenden Moment beiläufig die Ohren zuhalten, wenn sich die Erwachsenen als Komplimente getarnte Beleidigungen ins Gesicht sagten.
Abgesehen von ihren Eltern gab es für sie eigentlich kaum einen Grund, jedes Jahr wieder mit wachsenden Heiligabendbefürchtungen in den Zug zu steigen, dachte sie. Der Gedanke zog zusammen mit den Lichtern der Vorstadt an ihr vorbei. In ihrem Koffer fielen die Plätzchen mit den Streuseln im Zuckerguss durcheinander und brachen den Zimtsternen die Ecken ab. Ihr Ankommen wurde etwas leichter, als ihr Vater sie schon im Festtagshemd am Bahnsteig umarmte und nach demselben Rasierwasser roch wie vor zwanzig Jahren. Er sah nicht bedeutend müder aus als bei ihrem letzten Besuch. Weihnachten hatte keine Vorboten gesandt.
Der erste Gang bestand aus Salat und noch vergleichbar frischer Wiedersehensfreude. Selbst enge Verwandte haben sich alle paar Monate nochmal für eine Stunde etwas zu erzählen. Der Salat war sehr gut. Ihre Cousins waren sehr witzig und erzählten viele Geschichten aus ihrer neu gegründeten Firma. Als sie erzählten, dass sie und die meisten Mitarbeiter oft von zu Hause arbeiteten, sagte ein Onkel, zu seiner Zeit hätte man noch richtig gearbeitet. Ein Salatlöffel wurde vielleicht strategisch laut zurück in eine Schüssel fallen gelassen. Louisa leerte ihr vom Anstoßen übriges Glas Sekt, ihre Mutter war ihr schon eins voraus.
Im Anschluss gab es Tomatensuppe. „Ich liebe Tomatensuppe“, sagte Louisa, und setzte ihrer Suppe eine Schlagsahnehaube auf. Ihre Tante lachte und sagte, so würde sie Suppe auch lieben. Sie hatte keine Sahne genommen. Louisas Mutter, die Köchin, schwieg auf ihren Teller. Ihr Vater sagte, „du hast als Kind Tomatensuppe schon geliebt, weißt du noch? In der Schublade unterm Herd war immer eine Dose Tomatensuppenpulver“. Sie wusste es natürlich noch ganz genau. Manchmal hatte sie heimlich das Pulver pur genascht. „Suppe aus Pulver?“, fragte ihre Oma. „So Instantzeug ist aber nicht so gut für das Kind“. Ein Cousin sagte, „naja, das waren die Neunziger“. Das Gespräch wand sich dem Mauerfall zu. Über Ossi-Witze konnten noch immer alle gemeinsam lachen.
Zwischen zwei Gängen wurden die Gläser wieder aufgefüllt und der kleine Neffe herumgereicht. Seine Mutter beantwortete Fragen dazu wie er schlief, wie er aß, für welche Kita er vorgemerkt werden sollte. Louisa ging ins Bad und wünschte sich, jemand würde sie etwas fragen. Sie war erst vor weniger als zwei Jahren zu Hause ausgezogen. Es war ihr erstes Weihnachten ohne ihren Exfreund, den ihre Familie gut gekannt hatte. Als sie sich die Hände wusch, sah ihr Spiegelbild über dem Waschbecken etwas selbstgerecht aus. Sie übte ein Lächeln für den Rückweg zum Tisch. Da stand schon der Hauptgang bereit. „Und“, sagte ihre Oma zu ihr, als sie sich wieder setzte, „wann bringst du auch noch jemanden mit“, und nickte in Richtung des Babys auf dem Schoß seiner Mutter. „Na vorerst wohl dann erstmal nicht“, sagte Louisas Opa, ehe sie selbst antworten konnte. Louisa sah auf und ihm ins Gesicht, ihr Opa sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an, als würde er um seine Augen herum Platz machen wollen für das daraus sprechende Urteil über Louisas Beziehungsscheitern. Die Mutter ihres Neffen fragte, ob man ihr die Kartoffeln reichen könnte und ordnete sie dann neben dem Gemüse an, das sonst ihren Teller füllte.
„Isst sie noch immer kein Fleisch?“, fragte Louisas Opa ihren Bruder. „Nein, ich esse noch immer kein Fleisch“, antwortete seine Frau selbst. „Ich esse selbst kaum mehr welches“, sagte Louisas Bruder, auf dessen Teller drei Stücke Braten von Soße unförmig gebadet wurden. Ihr Onkel machte einen Vegetarierwitz, den er im Internet gelesen hatte. Die Frau ihres Bruders lachte nicht mit und Louisa versuchte ihren Blick zu fangen, aber sie schien Verschwörung nicht nötig zu haben. „Mir liegen Tiere eben zu sehr am Herzen“, sagte sie fast unbeeindruckt. Man war sich einig, dass das ja jeder halten könne, wie er wolle, so lange sie nicht versuchten, den Kleinen zum Vegetarier zu erziehen.
Glücklicherweise sagte in diesem Moment Louisas Tante zu ihrer Mutter, „wie machst du das nur, dass das Fleisch so zart wird, das zerfällt ja richtig“. Ihre Mutter lächelte aufrichtig und sagte, „freut mich, dass es dir schmeckt, das ist gar nicht schwer, sondern nur eine Frage davon, wie lange man den Braten im Ofen lässt“. „Ah ja“, sagte ihre Tante, „deine Zeit zum Kochen immer hätte ich ja mal gerne“. Für eine Weile sagte niemand mehr etwas und Louisas Mutter leerte das Glas und ließ daneben ihren Teller halbvoll.
Als sich kleinere Gespräche zwischen Sitznachbarn entspannen und auch Louisa sich etwas entspannte und in ihr Weinglas starrte, fragte ihr Cousin neben ihr, wie zu jeder Familienfeier seit fast zwei Jahren, „was studierst du nochmal?“ Und sie hatte nicht übel Lust, zu lügen. „Kulturanthropologie“, sagte sie trotzdem. „Ach das“, sagte ihr Cousin. „Warum studierst du mit deinem super Abi nicht eigentlich was Richtiges?“, mischte sich ihr anderer Cousin ein. Sein Bruder sagte, „ach komm, sie ist doch schön genug, um mal jemanden zu heiraten, der Geld verdient“. „Danke“, sagte Louisa tonlos in ihr Weinglas und stand abrupt auf, um ihrer Mutter beim Abräumen zu helfen. In der Küche sortierte sie Bestecke in die Besteckschublade der Spülmaschine, eine Arbeit, die ihrem Bedürfnis, etwas irgendwo rein- oder draufzuknallen, nicht gerecht wurde. Ihre Mutter nahm derweil viele Glasschälchen aus dem Kühlschrank, von denen sie die Frischhaltefolie zog. An der Folie hatten sich Kondenswassertropfen gebildet und Louisa musste hörbar Schlucken. Ihre Mutter strich ihr mit etwas ungezielten Bewegungen liebevoll über den Nacken. Als Louisa von der Spülmaschine aufsah, noch immer nicht ganz weggeblinzelte zornige Tränen im Augenwinkel, lächelte ihre Mutter sie für einen Augenblick ganz sanft und gerührt an. „Louisa“, sagte sie dann, „kannst du noch Getränke aus dem Keller holen? Nüchtern erträgt man das hier ja alles nicht“. Sie wies auf einen Sechser-Getränketräger aus Plastik neben der Tür.
Im Keller war es angenehm kühl nach der Hitze von Essen, Alkohol, Gesprächen und Kerzen, aber wie immer dämmrig. Die Glühbirnen hier unten hielten vermutlich schon seit den Achtzigern durch und schafften es nicht bis in die letzten Winkel des kleinen, dunkel gestrichenen Raums unter der Treppe, in dem die Getränke gelagert wurden. Sie füllte den Plastik-Träger nicht sofort mit Wein aus den Regalen und Sekt aus dem kleinen Kühlschrank, sondern lehnte sich einen Moment lang mit dem Kopf gegen die kalte Wand. Der Rauputz bohrte sich in ihre Stirn. Hier im Getränkekeller roch es schon immer viel mehr nach Keller als in den Räumen daneben. Der Geruch selbst war kalt, nicht direkt modrig, aber auch nicht frisch, als würden dort viele ungewaschene Äpfel lagern, die bei Minusgraden durch den Winter gebracht werden sollten. So lange Louisa sich erinnern konnte, hatte ihre Familie nie Äpfel im Keller gelagert. Sie lehnte an der Wand und drückte den Kopf dagegen, bis ihre Stirn brannte, und lauschte dem Gluckern der Wasserrohre. Als Kind war sie nie tief in den Raum hineingegangen und auf der Flucht vor unklaren Bedrohungen immer die Treppe so schnell es ging wieder hinaufgerannt. Sie dachte an das gemeinsame Auspacken im Wohnzimmer gleich und versuchte sich vorzustellen, wie sich zum Beispiel ihr Bruder über ihr Geschenk freute.
Aber an das in ihr vergrabene Weihnachtsgefühl kam sie nicht mehr dran und sie hatte die wachsende Wut der letzten Wochen nicht vergessen. Sie sagte sich, dass auch da noch das Kind in ihr lebte, der trotzige Anteil eines egoistischen Mädchens, das gerne beachtet werden wollte. Die geraubten Kindheitsgefühle würden weder der Weihnachtsbaum noch das Kaminfeuer im Wohnzimmer zurückbringen. Die vielen kleinen Verletzungen des Abends würden nicht zurückgenommen werden und sich zu denen der letzten Jahre gesellen. Geschenke auspacken konnte man aber ja trotzdem. Sie nahm den Kopf vom Putz und rückte ihren Gesichtsausdruck zurecht. Mit sechs vollen Flaschen im Träger machte sie sich wieder auf den Weg die Treppe hoch. Oben warteten sie schon mit dem letzten Gang. Auf dem Heimweg würde die Keksdose leer unnötig viel Platz in ihrem Koffer wegnehmen, zu Hause würde sie die letzten verlassenen Zimtsternecken rausschütteln und die Dose ganz oben auf einen Küchenschrank schieben und nicht an sie denken, bis wieder Dezember wäre.
.
Leonie Höckbert
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
10 | Manon Hopf
Wir sind drei oder vier. Am Meer fällt kein Schnee, wir pusten ihn aus den Feldern, wechseln unsere Verortung. Wir sind ein Wald, in unserem Blick wohnt ein Kreis. Dort fällt eine Flocke, landet. Auf der Zunge ist sie nichts. Auf der Haut, im Fell bleibt sie als Zuneigung. Als Menschen stehen wir ungerade, haben einen Hang zur Erde. Als Tiere sind wir gleichauf, wie überliefert, weithergebracht. Sind eine Erzählung, ihre Worte lecken wir uns ins Fell. Da überwintern sie.
Wenn eine ausfällt trauern wir. Dann ist wir eine weniger. Dann suchen wir uns etwas aus. Es gibt ein Spiel, das heißt, uns einen Schatten holen. Der Schatten wächst. Wenn er größer wird als wir, dann müssen wir ihn abhängen. Das heißt, wir rennen davon. Teilen ihn auf. Wir teilen uns nie, aber der Schatten wird kleiner, wenn er zerrissen ist. Bleibt hängen im Gestrüpp. Von dort zieht er in Fetzen in die Erde.
Einmal im Jahr kommt der Schnee. Wenn er nicht kommt, werden wir nicht älter. Älter werden heißt, Schatten im Boden vergraben. Dann legt sich der Schnee darauf und man vergisst. Wir vergessen nicht. Wir haben gelernt, dem Schnee zu danken. Danken heißt, etwas zurückzugeben. Einmal im Jahr bleibt eine liegen. Einmal im Jahr kommt der Schnee. Wenn er nicht kommt, liegt eine umsonst.
Umsonst ist immer zu wenig. Zu wenig heißt, dass man sich etwas nehmen muss. Wir nehmen uns etwas vom Mann. Es geht immer sehr schnell. Etwas Lebendes bleibt in den Händen, wenn man es hat. Dann schieben wir es uns in den Bauch, setzen uns fest. Wunden lecken heißt auch, die große Narbe trösten, wenn sie weint. Dann kommen wir aus uns selbst.
Wie es ist, sich selbst im Arm zu haben. An den Brüsten. Wir jaulen, wenn wir Hunger haben. Wer Hunger hat der isst. Was essen, wenn es nichts gibt als uns selbst. Am Waldrand stehen Augen. Ein andres Spiel heißt, wer sie schneller schließen kann. Liderlecken, unter den Lefzen Träume. Der Schlaf kommt immer aus dem Bauch.
Sich nur den halben Schlaf holen. Ein Auge immer halbauf. Das hat der Mond uns ins Gesicht gemalt. Wir lecken ihm ein Loch in die Stirn. An irgendwas muss er sich aufhängen können. Wie wir, wir hängen in den Bäumen. Die am längsten hängt, verliert. Es kracht wenn man sich an die Beine hängt, wie Äste. Ein Baum hat mehr als ein Genick.
Wie schwer der Schnee im Rücken liegt, das weiß der Frühling. Wie wenn man aus der Erde kommt, nur blau. Mit blauen Lippen kann man besser singen, sagen wir. Wir schütteln unsere Wörter ab wie Schnee. Mit vollen Händen trinken wir sie wieder auf. Stecken uns Zapfen rein. Was kalt auf der Zunge liegt, stillt einen Durst. Ob er gelöscht wird liegt an unseren Worten.
Was sprechen, wenn der Durst nicht sterben will beim Trinken. Wie nennt man eine Angst die nicht vergeht, wie ein Verlangen. Wir sagen nichts, wir gehen durch die Zeit. Kann süß sein, das kann Nacken brechen. Die Zeit findet in uns dann einen Ort, sie findet statt. Wir wissen zu vergehen. Vor Hunger, Kälte, vor Wald. Wir wissen auch, wie man sich weitergeben kann, verwandeln. Einmal im Jahr kommt der Schnee. Wenn er nicht kommt, werden wir kälter.
.
Manon Hopf
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
9 | Katharina Forstner
Ich zähle die Wände um meine Stunden
Eine Wand hat ein Fenster hinunter zur Straße
Ich würde hinausgehen hätte ich einen Grund
Eine Wand ist löchrig von meinen Fäusten
Ich würde sprechen wüsste ich zu wem
Eine Wand mahnt wir alle hätten zu tragen
Die Zimmerdecke oder den Zusammenhalt
Eine Wand schmiegt sich an meine Schulterblätter
Sie zeigt mir wie man versteinert
.
Katharina Forstner
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
8 | Martina Berscheid
Deadline
Arnes Bett knarrt leise, als er sich aufsetzt. Er schlüpft in seine Hausschuhe, sie quietschen auf den Fliesen. Ich zähle die Schritte, die sich vom Bett entfernen. Acht.
Als Arne die Tür schließt, atme ich auf. Drehe mich auf den Rücken. Starre an die Decke, als stünde dort geschrieben, was ich tun soll.
Endlich rapple ich mich auf. Ich muss es hinter mich bringen, bevor er das Haus verlässt.
Ich ziehe mich hastig an, gehe die Treppe runter, den Geräuschen aus der Küche entgegen. Arnes Summen zur Radiomusik. Dem Pfeifen des Kessels. Dem Schmatzen der Kühlschranktür.
Arne lächelt mir entgegen, als ich die Küche betrete. „Bist ja schon wach. Hab ich dich geweckt?“
Er kommt auf mich zu, streicht mir eine Haarsträhne aus der Stirn. Nach zehn Jahren bringt er mir noch immer eine Zärtlichkeit entgegen, als wären wir erst kurz zusammen.
Das macht es noch schwerer.
Er sieht frisch aus, dafür, dass er erst um zwei Uhr ins Bett gekommen ist. Sein Gesicht spiegelt Zufriedenheit.
Ein Kälteschauer huscht mir über den Rücken.
Ich schüttele den Kopf. Wortlos fällt mir das Lügen leichter.
Er dreht sich um, holt eine Tasse aus dem Schrank, die er mir zum Nikolaustag geschenkt hat. Lieblingsmensch steht darauf.
Er gießt Kaffee ein und reicht mir die Tasse. Ich achte darauf, dass sich unsere Finger nicht berühren. Damit er nicht merkt, wie kalt meine Hände sind.
Ich zucke zusammen, als zwei Brotscheiben aus dem Toaster springen. Arne nimmt sie heraus, legt sie auf einen Teller. Er hat wie immer für mich mit gedeckt. Obst geschnitten, das ich morgens gerne esse. Zwei Kerzen auf dem Adventskranz angezündet.
Er ist ein guter Mann.
Der schlechte Dinge tut.
Ich schlucke schwer an der Wahrheit. Trinke Kaffee, als könnte ich sie in den Magen spülen, wo sie sich zersetzt, in besser verdauliche Bestandteile.
Arne dreht sich um. Sein Lächeln verrutscht. Er sieht mir an, wenn etwas nicht stimmt.
„Mach dir keine Sorgen. Du kriegst das hin!“
Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich verstehe, dass er die Deadline eines Artikels meint, den ich heute abgeben muss. Ich nicke und trinke einen weiteren Schluck.
„Setz dich doch.“ Er deutet auf den Stuhl ihm gegenüber. Sein Lächeln verströmt Wärme.
Sie verfliegt auf dem Weg zu mir.
Ich nehme Platz. Sehe ihm zu, wie er Margarine auf eine Toastscheibe schmiert, einen Klecks Orangenmarmelade darauf verteilt.
„Du wirst sehen, dein Chef wird begeistert sein.“
Er redet immer noch von dem Artikel.
Ich schaue zur Küchenuhr. In zwanzig Minuten muss er los. Wenn ich es jetzt nicht anspreche, muss ich warten, bis er nach seiner Arbeit nach Hause kommt.
Aber ich höre mich sagen: „Wann bist du heute Abend da?“
Er zögert. Was ihn verrät, ist sein Blinzeln.
„Kann spät werden. Ich wollte noch Buchhaltung machen.“
Bist du sicher?, will ich ihn fragen. Oder willst du wieder mit einer Fackel in der Hand vor den Häusern unbescholtener Menschen Parolen skandieren? Brüllen, dass sie nicht in dieses Land gehören?
Seit wann denkst du so?, will ich ihn fragen. Wieso habe ich das nicht gemerkt, wer hat dir das eingeflüstert, einer deiner schwarz gekleideten Kumpanen? Woher kennst du die?
Hast du geglaubt, ich werde nicht misstrauisch, wenn du plötzlich ständig länger arbeiten musst, obwohl im Geschäft so wenig los ist? Bist du nie auf die Idee gekommen, ich könnte dir nachgehen, und sehen, mit welchen Leuten du dich triffst? Hören, welche Worte ihr brüllt, die an eurem Hass keinen Zweifel lassen?
Ich öffne den Mund, aber keins der Worte schafft es nach draußen. Sie prallen gegen eine unsichtbare Wand, wo sie sich auftürmen, und ich schlucke und schlucke, bis mir der Kaffee hochkommt.
Ich springe auf, stürze aus der Küche ins Gäste-WC und spucke braune Brühe ins Waschbecken.
„Isabelle? Alles in Ordnung?“
Arne steht im Flur. Ich spüre seine Anwesenheit durch den Spalt der Tür. Muss erneut würgen.
„Hey.“
Er kommt herein. Der Raum ist zu klein für uns beide. Vielleicht nur dieser, vielleicht auch unser Beziehungsraum.
Er fasst mich an der Schulter, dreht den Wasserhahn auf. Mit einem Waschlappen fährt er mir über die Stirn, über den Mund. Dann drückt er mich an sich.
Er riecht gut, wir er immer gerochen hat, nach einer frisch geheizten Backstube, das habe ich tatsächlich mal gedacht.
Er ist derselbe Mensch.
Er ist mir vertraut.
Er ist mir fremd.
„Du hast immer brillante Texte abgeliefert. Auch der wird brillant sein. Ich fahre jetzt, und du kannst in Ruhe arbeiten und die Deadline einhalten. Okay?“
Ich sehe ihn an, sehe an ihm vorbei. Sehe dem Zeitpunkt nach, dem richtigen, wie er verstreicht, sich in meiner Sprachlosigkeit auflöst.
Arne führt mich in die Küche, kocht Tee, die Tasse ist schlicht, weiß, unbeschriftet.
„Bis heute Abend.“ Er lächelt, er küsst mich.
Wie jeden Tag.
„Bis heute Abend“, antworte ich und stelle die Tasse auf den Tisch.
.
Martina Berscheid
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
7 | Anna-Katharina Kürschner
ice
Ich sitze im Zug auf dem Weg nach Hause und mein einziges Gepäckstück ist ein mittelgroßer Rucksack, in den meine Querflöte, der Laptop und Klamotten für drei Tage passen. Der ICE ist leer, es war die günstigste Fahrt an einem Montagvormittag, ich war flexibel: Querflötenunterricht erst um 14 Uhr. Ankunft in Frankfurt 12:54 Uhr. Es bleibt genug Zeit, selbst bei Verspätung. Die Landschaft draußen ist eis-hell und gleichförmig und lullt mich ein.
Ich sitze unbequem. Meine Füße sind trotz der schweren Winterboots kalt und so zieh ich sie aus, winkle die Beine an und stecke meine Zehen unter den neben mir stehenden Rucksack. Ich lehne mit dem Rücken am Fenster und knülle mir meine Jacke zum Kissen an den Sitz. Ich habe einen Tischplatz gewählt, mein Laptop bleibt trotzdem im Rucksack. Der Zug ruckelt und ich bin müde. Ich schlafe ein.
Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, aber mein Mund muss leicht offen gestanden haben, denn meine Zunge fühlt sich taub und trocken an. Ich schlucke. Im Schlaf hat sich mein rechtes Bein aus der angewinkelten Position gelöst und ist gegen die Tischplatte geklappt, ich spüre den Abdruck der Kante an meinem Oberschenkel. Ich reibe über mein Gesicht, versuche zu lokalisieren, wo wir inzwischen sind. Ich will aus dem Fenster des Vierers gegenüber schauen. Während ich den Blick hebe, sehe ich einen Penis. Ich schaue weg, und bin mir sicher, mich geirrt zu haben. Ich muss blinzeln. Ich schaue wieder hin. Der Penis ist fleischrot und auf mich gerichtet, schräg vor mir, unter dem gegenüberliegenden Vierertisch. Eine gelbliche Hand, nicht weniger fleischig, reibt unbeirrt auf und ab.
Mein Blick schnellt hoch, in sein Gesicht, bevor ich es verhindern kann. Da ist kein Handy, keine Zeitung. Der Mann schaut mich an, direkt, ein leichtes Lächeln auf den schmalen Lippen. Ich denke, dass das gerade nicht wirklich passiert. Ich weiß nicht wohin. Ich senke den Kopf. Ich weiß nicht, ob Zeit vergeht. Ich bewege mich nicht. Ich starre auf sein Ding. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle nichts.
Mir direkt gegenüber sitzt ein Anzugträger und klappert auf seinem Laptop. Er hat noch nicht einmal aufgeschaut, seit wir gemeinsam eingestiegen sind. Ich hätte ihm Bescheid sagen können, das Zugpersonal rufen. Ich hätte aufstehen und gehen können. Ich hätte, ich hätte und ich hätte.
Ich will ein Foto mit dem Handy machen. Heimlich. Unauffällig. Ich prüfe vorher mehrfach, dass ich mich nicht mit einem Blitzlicht oder dem Fotoklickgeräusch verrate. Das Geräusch imitiert die Verschlussblende einer Analogkamera aus einem vorherigen Jahrtausend, ist völlig unnötig, und nur zu hören, wenn das Telefon laut gestellt ist. Meines ist stumm. Der Blitz deaktiviert. Ich mache ein Foto, ich verwackle es leicht. Ich will ein zweites machen, aber meine Arme heben sich nicht mehr.
Die Fahrkarten wurden bereits kontrolliert, aber ein Kaffeemann kommt, ein Bahnangestellter sammelt den Müll aus unseren Tischabfalleimern, alle haben es eilig. Ich bin stumm. Ich könnte gehen, jemanden suchen. Aber ich habe kaum einen Beweis, nur einen vier Pixel großen, fleischroten Penis. Ich will nicht mit diesem Mann konfrontiert werden. Wenn ich ihn beschuldige, muss ich mit ihm reden. Er wird sagen, dass es nicht stimmt und dann stehe ich da.
In die Winterboots bin ich längst wieder eingestiegen. Die Dreiviertelstunde bis der Zug in Frankfurt hält, sitze ich starr und kerzengerade auf meinem Platz. Mein Blick in meinem Handy. Ich überlege, jemandem zu schreiben, aber ich kann nicht. Ich muss still sein, hören, wie Stoff an Hand an Haut reibt. Ich zwinge meinen Blick nach unten. Ich will nichts hören, nicht seinen Atem, nicht das Kramen in seiner Jacke, nicht das Aufreißen der Taschentuchpackung. Aber noch immer sagt der Zugchef nichts von unserem nächsten Halt. Ich stehe sieben Minuten zu früh auf. Ich laufe durch den ganzen Zug nach vorne. Ich drehe mich nicht mehr um, dann renne ich zur U-Bahn.
Im Querflötenunterricht denke ich plötzlich: Es ist ja auch eine enganliegende Jeans. Ich habe im Schlaf die Beine auseinander klappen lassen. Ich habe mich beinahe angeboten. Das ist lächerlich. Habe ich mich etwa angeboten? Ich möchte duschen, aber ich möchte nicht nackt sein. Ich war still. Ich war feige. So ein Schwein. Ich schweige. Ich spiele schlecht. Meine Professorin sagt: „Sie haben ja noch ein paar Wochen.“ Was kann ich tun?
Mir passiert so etwas nicht. Ich bin so nicht. So stumm. Ich habe keine Angst, im Dunkeln nicht und auch nicht davor, nachts mit der U-Bahn nach Hause zu fahren. Ich mache keine Umwege für belebtere Rückwege.
Nach der Stunde setze ich mich mit meinem Rucksack auf dem Schoß auf die Treppe. Ich google. Ich finde widersprüchliche Informationen. Für das Wort Exhibitionismus brauche ich die Autokorrektur. Ich werde wütend. Ich google: Nächste Polizeiwache. Ich presse meine Oberschenkel fest zusammen.
Ich mache das, damit sich vielleicht irgendwann richtig anfühlt. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich wurde nicht ja verletzt und es hat mich ja auch keiner angefasst.
Ich stehe mitten auf der Zeil. Aus dem Backshop links von mir riecht es nach Treibmittel und warmen Brötchen. Aus der Eisdiele rechts von mir dudelt italienische Popmusik. Die Tür vor mir ist eine Front. Die ganze Hausfassade ist eine verspiegelte Front, so hoch, dass ich ihr Ende nur mit in den Nacken gelegten Kopf erahne. Ich lege den Kopf in den Himmel, damit ich im verspiegelten Metall meine verzerrte Silhouette nicht sehen muss. Ich atme mehrmals. Ich will nicht. Ich will nach Hause. In mein Bett, in mein Kissen. Mir ist nichts passiert.
Es geht mir gut. – Mir geht es nicht gut. Ich gebe mir einen Ruck. Mein oberstes Zeigefingergelenk drückt sich durch, als ich auf den Messingklingelknopf drücke. Wenn mir das beim Querflöte spielen passiert, beschwert sich meine Professorin sofort. Meine Fingergelenke müssen stark und beweglich sein, aber bei diesem Klingeln schnappt das Gelenk und biegt sich durch.
Erst passiert nichts, ich denke, ich gehe wieder, ich habe es ja versucht, ich kann gehen.
„Polizei?“
Die Stimme aus dem Lautsprecher neben der Klingel knistert männlich und angespannt. Ich schweige.
„Hallo? Hier ist die Polizei. Was gibt es?“
„Ich“, es klingt viel brüchiger als meine eigene Stimme, „möchte Anzeige erstatten.“
Italienische Popmusik. Jemand hätte gern eine Kugel Stracciatella-Minze. Die verspiegelte Hausfront sagt:
„Um was geht es dabei?“
Ich denke: Das ist nicht sein Ernst. Ich stehe doch noch auf der Straße. Ich denke: Wie schwer kann man es jemandem machen. Mitten auf der Zeil. Jemand will drei Kugeln im Becher. Ich muss etwas sagen, jetzt zu gehen, geht nicht mehr. Wer weiß, sonst kommen die mir noch nach? Ich kratze einen Klumpen Mut zusammen:
„Könnte ich das vielleicht in einem etwas –", ich stocke, „intimeren Rahmen –" Meine Stimme bricht weg und lässt Tränen vorbei. Jetzt? Tränen, die ich nicht will, die ich nicht fühle, die völlig deplatziert sind.
Die Tür summt, ich trete ein. Ich sehe nur orangene Plastikschalstühle, die direkt mit der Wand verschraubt sind, ich sehe durch eine Plexiglasscheibe Männerbeine in Uniformhosen und Sicherheitsschuhen. Waschbeton auf den Böden, Waschbeton an den Wänden. Sie stehen beieinander und reden. Ich will ihnen nichts erzählen. Die Hässlichkeit der Umgebung ist bedrohlich. Ich habe nichts falsch gemacht, oder? Ich friere, dränge meine Tränen zurück. Ich zwinge mich, meinen Kopf so weit zu heben, dass ich an einen Schalter mit einem spinnennetzförmig gebohrten Lochmuster im Plexiglas treten kann und dem Beamten, der davor sitzt, ins Gesicht sehe. Ich kann nicht sprechen. Endlich sagt er: „Möchten Sie das vielleicht mit einer Kollegin besprechen?“ Etwas in mir schmilzt, möchte als Tränen herauskommen, ich stoppe es und nicke hektisch. Er ruft in einen Raum hinter sich, den ich nicht einsehen kann, ich senke meinen Blick wieder und schlucke hart.
Bewegung unter den Sicherheitsschuhen. Eine doppeltgesicherte Tür, die von außen keine Klinke hat, wird geöffnet und ich werde eingelassen. Dann steht vor mir eine Frau mit hellblond wippendem Pferdeschwanz und teichgrünen Augen. Als hinter uns die Tür zufällt und wir allein in einem Büro sind, laufen meine Augen über. Ich komme mir lächerlich vor. Ich will nicht weinen. Mir ist doch gar nichts passiert, sie muss denken… Unter Schluchzen sage ich zuerst:
„So schlimm ist es eigentlich gar nicht.“ Und dann: „Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt so weine.“
Die Polizistin nickt. Dann erzähle ich ihr, was passiert ist. Sie muss nachschauen, um welchen Tatbestand es sich handelt: Solange er mich nicht berührt hat, ist es nur Erregung öffentlichen Ärgernisses. Exhibitionismus, habe ich selbst schon gegoogelt. Das erzähle ich ihr auch. Ich zeige ihr auch das Foto. Ich soll es ihr per Mail schicken. Sie schreibt einen Bericht. Ich fülle ein Formular mit meinen Personalien aus. Die grauen Kästchen, immer nur groß genug für einen Buchstaben, beruhigen mich. Sie liest mir noch einmal vor, wie ich ihr die Ereignisse geschildert habe. Ich unterschreibe.
Während sie weiter mit ihren Teichaugen den Bildschirm bearbeitet, versuche ich mich damit abzulenken, meine Personalausweisnummer auswendig zu lernen. Meine Nase ist verstopft. Ich suche in meinem Rucksack umständlich nach einem Taschentuch. Sie fügt das Foto der Akte als Anhang hinzu. Sie meint: Ihn darüber zu schnappen ist nahezu unmöglich, aber wenn der sowas noch einmal macht, kriegt man ihn vielleicht. Ich fühle mich trotzdem leichter, als ich mit ihr und trockenroten Augen durch den Waschbetoneingang wieder nach draußen gelassen werde.
.
Anna-Katharina Kürschner
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
6 | blumenleere
in memoriam auf repeat
jahr fuer jahr ruecken wir ihm ferner
jenem griswald-weihnachts-slapstick-
horror den wir einst ja als blaupause
unserer eigenen festtage betrachteten
unsere winterbaeuche zum erbrechen
mit plaetzchen gefuellt quasi auf hold
sozusagen abruf erwarteten wir dann
die action den trubel eines aufgeregt
irren familienfestes voller ereignisse
bis in die knochen rein tragikomisch
genug irritationen um uns nachhaltig
stoff fuer gespraeche & alptraeume
zu bescheren nun ein sehr sonderbar
anmutendes relikt aus einer fremden
aera weil wenn wir jetzt vernetzter
feiern konzentrieren wir uns gleich
von anfang an aufs kommunizieren
eines sorgsam aufgearbeiteten plots
mit snapshots & comments garniert
unsre faden existenzen meliorierend
statt uns hilflos & ziemlich isoliert
kategorischer auf uns allein gestellt
dem monstrum perfider traditionen
ausgeliefert zu sehen & es dennoch
letzten endes heldenhaft zu besiegen
da uns was andres nicht uebrig blieb
.
blumenleere
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
5 | Dana Schällert
Die Frau mit den Locken
Ich hab die Frau oft zufällig gesehen. Kannte sie nicht, kenne sie nicht. Wiedererkannt hab ich sie stets an ihrer altmodischen Lockenfrisur, die mich an die Achtziger erinnert. Wer trägt heute denn noch sone Frisur? – hab ich gedacht. Wer kann die einem heutzutage überhaupt noch machen? Einfach aus der Zeit gefallen, jedes Mal hab ich das gedacht, aber es gibt so Leute, die bleiben halt irgendwann modisch stehen, vielleicht bleiben sie auch insgesamt stehen – und das hat mir bisher immer irgendwie leidgetan. Stehengeblieben in jener Zeit, die für sie irgendwie besonders … glorreich war. „Glorreich“, denke ich und muss selbstironisch grinsen, bin wohl auch aus der Zeit gefallen. Wer gebraucht denn heute noch das Wort „glorreich“. Wobei ich schon weiß, wie ich gerade jetzt auf diesen Begriff komme … Egal, ich meine jedenfalls, eine Zeit, in der man irgendwie für sich das Gefühl hatte, dass man in ihr besonders richtig war. Auf seinem Zenit stand. Wo die Welt besonders in Ordnung war. Vielleicht war das bei der Frau in den Achtzigern. Nee, kann eigentlich nicht sein, dann müsste sie ja schon um einiges älter sein als ich. Ist das möglich? Ich denk das zwar jetzt gerade, aber ich glaube, das ist irgendwie eine Gedankenschleife, in der ich schon öfter festhing, jetzt halt auch, wo ich die Frau sehe. Unerwartet. Aber irgendwie nicht … unverlangt.
Verfange mich immer wieder und ständig in ihren Locken, in denen ich mich in endlosen Loops drehe. Diese Frau jedenfalls, die arbeitet in einem Supermarkt, da habe ich sie an der Kasse gesehen, oft schon, und auch gelegentlich, wenn sie nicht im Dienst war, in irgendwelchen anderen Läden. Als wär sie vor einem anderen Hintergrund als dem eines Ladens nicht denkbar. Das Gesicht kenn ich eigentlich kaum (vielleicht auch daher die übertriebene Fixierung auf ihre Frisur), kannte ich eigentlich kaum, weil sie mir bisher immer nur mit Mundschutz begegnet ist. Auch neulich eben, also, vor einem Monat oder so, beim Friseur – ist ja auch ein bisschen was wie ein Laden. Das war schon witzig, als ich da reingegangen bin, wollte mir ne Balayage färben lassen, und da saß sie mir auf einmal schräg gegenüber, die Frau mit der komischen Achtzigerfrisur, saß da, ganz vertieft, unter soner Trockenhaube, wo ich dachte, die gibt es auch gar nicht mehr, schaute in irgendsone Zeitschrift, mit ganz wichtiger Miene, die massiven Augenbrauen extrem hochgezogen, und ich starrte sie zwischen den Spiegeln hindurch an und fühlte mich, als wäre ich dabei, ein Rätsel zu lösen. Und auch als man anfing, mir Farbe in die Haare zu pinseln, da guckte ich rüber, glotzte, als wäre die Haube ne Zeitmaschine wie in „Zurück in die Zukunft“, deren Geheimnis ich ergründen wollte. Als die Haube weg war und die Friseurin dann an den merkwürdigen Lockenwicklern rumfummelte, da dachte ich, dass dieses Geheimnis irgendwas mit der Vergangenheit und mir selbst zu tun hatte, aber so recht kam ich nicht drauf. Ich sah meine Mutter genussvoll im Bad stehen, Stunden vor dem Elternabend im Kindergarten, auf den sie gehen würde, als sei es sowas wie ein Mütterball und sie wolle Ballkönigin werden oder den Prinz heiraten. Sie drehte sich die merkwürdigen silbernen und grauen Rollen verschiedener Größen raus, die ich gern heimlich befühlte, weil sie so lustige Borsten und Zacken hatten, oder wo ich meine Finger durchsteckte, dass meine Hände ganz lustig aussahen. Und als ich nun sah, wie die Friseurin jetzt in den Haaren der Frau wühlte, da war richtig so etwas wie ein schmerzhaftes Ziehen in meiner Brustgegend, aber vielleicht war das auch nur, weil ich die ganze Zeit schon so schräg saß, um am Spiegel vorbeizuspinxen, auf die Lockenfrau, deren Blick noch immer mit dem Ausdruck, sich gerade über äußerst wichtige Dinge zu informieren, in die Illustrierte gerichtet war. Meine Friseurin hatte mich schon an die zehn Male wieder in eine einigermaßen aufrechte Position geschoben, die ich dann doch immer wieder, unwillkürlich, verließ.
Die ganze Zeit schon übrigens hatte sich meine Friseurin mit der anderen, der von der Frau, unterhalten. Um Autos war es gegangen, wie schwer es gerade war, an einen neuen Wagen zu kommen wegen der Lieferengpässe und der deswegen auch angespannten Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Meine Friseurin hatte irgendwas mit den Zündkerzen gehabt und musste jetzt schon längere Zeit Radfahren. Es war inzwischen aber November geworden, bald würde es zu kalt sein. Danach waren die Heizkosten drangewesen. Die explodierten Preise. In naher Zukunft würde man sicher auch im Salon sparen müssen, momentan ließ man die Heizungen zu Hause noch aus und behalf sich mit Wärmflaschen, hatte meine gesagt. Sie würde dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten, hatte die andere berichtet. Und ich erinnere mich noch genau – in diesem Moment kam Leben in die Frau mit der Lockenfrisur, die bis dahin ausgesehen hatte wie irgendsone Schaufensterpuppe innem Museum übers letzte Jahrhundert. Sie sog stark Luft ein, ihre Maske zog sich intensiv zusammen, als wollte die gesamte Frau implodieren, und dann sprach sie mit einer tiefen Stimme, die ich ihr nicht zugetraut hätte: Alles mach ich mit, seit Jahren nun schon, trag diese Dinger im Gesicht, die meinen Lippenstift jedes Mal verwischen, mach mich arm, wenn ich einkaufen geh wegen dem russischen Gas und was, ess für den Klimawandel und wegen Antibiotika und Tierhaltung und alles weniger Fleisch, aber das … nein, das: Meine Weihnachtsbeleuchtung, die kriegt keiner, dann trag ich lieber fünf Pullover übereinander! Die mach ich an! So! Die leuchtet wie jedes Jahr. Vielleicht ein, zwei Stunden weniger, mit nem Timer. Aber die läuft! Die wird leuchten! Immer wird die leuchten, wenn es draußen dunkel wird! Und sie hat das gesagt mit einem Nachdruck, so als wärs ne politische Ansprache oder so, da waren die beiden Schnattertanten plötzlich ganz ruhig, bis dann die eine sagte: So ist richtig. Irgendwann ist auch gut.
Und als sie das gesagt hat, die Frau mit den Achtzigerjahrehaaren, da hab ich wieder daran gedacht, wie es damals gewesen ist und wie es auch sonst war: mit den Lichtern in den Fenstern (auch wenn wir nie ne große Festbeleuchtung nach amerikanischem Vorbild hatten) und drumrum oder wie es aussah, wenn wir am zweiten Weihnachtstag am späten Abend von meiner Oma über Land nach Hause fuhren und die Fenster und Häuser und Bäume haben in allen Orten geblinkt und geglüht, da hab ich sowas wie Ruhe und Frieden gespürt und so eine richtig tiefe Freude daran, am Leben zu sein. Und wie ich jetzt hier stehe und daran denke, dass die Frau das gesagt hat, bei dem Friseur vor nem Monat, ich hatte das ganz vergessen, da fällt mir das alles wieder ein, dieses Gefühl aus meiner Kindheit, und ich merke, dass es auch jetzt wieder da ist, wo ich dieses Haus sehe, weswegen ich überhaupt erst wieder an die Angelegenheit denke.
Es ist heute der fünfte Dezember und ich habe ein paar Süßigkeiten für die Nikolausstiefel der Kinder gekauft, bin durch deutlich dunklere Straßen gegangen als sonst um diese Zeit, hab mich ein bisschen traurig gefühlt deswegen, ein bisschen bitter, und hab gedacht, dass das Jahr zu Ende geht, wie es aufgehört hat, mit vielem, was schwerer geworden ist, mit viel Hoffnung, die getrübt wurde, mit viel Glauben, der zusehends verblasste, und dieser Gang aus dem Supermarkt zurück nach Hause, wo wir nur noch alle zwei Tage das Wasser erhitzen, heute war der Tag zum Haarewaschen, der hat sich dieses Jahr so stumpf und hohl und schematisch angefühlt. Ich habe da ein Häuschen gesehen, auf einmal, nicht weit weg, es hat so hell geleuchtet, dass es mich erinnerte an das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten, obgleich ich schon ahnte, dass es kein Räuberhaus wäre, in dem ein Braten auf mich warten würde, nachdem ich nur die Räuber vertrieben hätte, und ich bin hingegangen zu dem Häuschen, das zwischen seinen nur spärlich mit Lichterbögen versehenen Nachbarn leuchtete wie eine Offenbarung, mit zwei flimmernden Tannen davor, das Sims mit funkelnden Eiszapfenketten geschmückt, ein Weihnachtsmann mit Rentieren in der Mitte. All die Jahre hatte ich die Augen verdreht über diesen übertriebenen Beleuchtungshype, all den Kitsch, aber nun hat es mich dorthingezogen, nur einen kleinen Moment schauen, so tun, als sei es wie früher, ein kleines bisschen Helligkeit, ein kleines bisschen Leichtsinn, ein kleines bisschen irriger Glauben, ich könnte mich an den LEDs wärmen, als wäre die Welt in der Vergangenheit stehengeblieben irgendwie. Und nun, wo ich dort steh, vor dem Haus, da seh ich nämlich in all der leuchtenden Pracht, hinter einem der Fenster, sie sitzen, die Frau mit der blonden Achtzigerfrisur, seh sie da sitzen wie einen Weihnachtsengel, wie sie verträumt nach draußen schaut, und dann sieht sie auch mich und strahlt, in all dem Plunder, mit einem verklärten Gesicht wie ein Kind, das den ersten Blick ins Weihnachtszimmer wirft oder wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das im Flammenschein für Momente Hoffnung und Wärme spürt. Und ich lächle zurück, denn ich fühle das auch, und ich denke: Naja, die Achtziger sind ja auch so langsam wieder im Trend. Alles kommt, alle Jahre, wieder.
.
Dana Schällert
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: