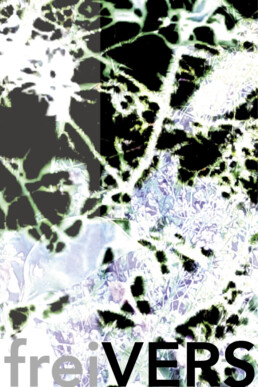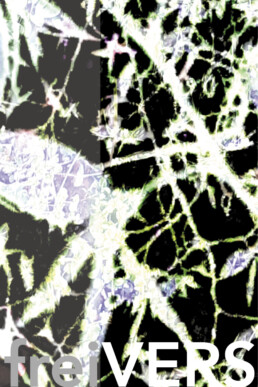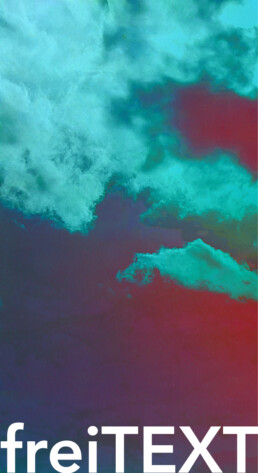freiVERS | Jakob Leiner
mittelgroßes vøglbuch
1
kennt ihr schon
den kleiber das
ist ein vogel
der aussieht wie
ein mini dachs
in der luft.
.
2
am leistenband verfängt
sich eine überzeugung
kleiner wandervogel
stechende trillerschar.
.
3
und
im
fluchtpunkt
der
vedute
meißelt
trommelt
etwas
buntes
ohne
kopfweh
zu
erwecken.
.
4
alle suchten
auch jenen zinnoberroten vogel
der aufflog um in der sonne zu singen.
.
5
eine schwalbe stürzt sich panisch
in den efeu der stadtmauer
la tour des esprits
zurück in die luft
und lässt eine feder tropfen.
.
6
wir
sind das stratum basale
eulenwetter
lauerjäger unter einer decke
aus spukhafter anmut
bleibt weiß und ziegelrot der schräge blick sieh
flügelschlag
ein sprung
im glas im tann.
.
7
weil sie schön ist sind 2 schubidus
verrückt in die verliebte welt.
.
8
grasmücke
das ist kein grund
paranoid
aufzutreten
erde tut gut
und man wage
tausendmal neu
mit einem zwitschern
im gesicht.
.
9
im see stellt ein erpel
seinen motor an
der kleine runabout
schafft
tatsächlich einen wasserstart
vor begeisterung
schnatternd.
.
10
unter donnernder bläue
gellen des obersten reihers
der sich in die adria stürzt.
.
11
da im gebüsch
hantiert ein zaunkönig und singt
herzerweichend dazu
(der unterschnabel muss ordentlich vibrieren)
doch es war eine list
der weg endet blind als
große flusswiese auf der
.
12
rempelt
der buch den gold
der gold den grün
der grün den buchfink
freut sich die meise
am knödel.
.
13
künftig
wird der wald zusammenwachsen
und der kuckuck
den man nicht umsonst
um die zahl der lebensjahre fragt
sein ei in fremde nester
legen.
.
14
ich strecke mich aus
und denke an vögel
vor allem den adlern
gedenke ich.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
POEDU - Text des Monats Jänner
Mein Zimmer
ein Himmelbett wie Piratenschätze,
ein Klavier, das weich wie Wolken ist,
eine „Sternchenpracht“ die laut und leise sein kann,
süß am goldenen Himmelszelt entfacht,
zu Hause wie weiße Schokolade,
ein Klackern...klack...klack, der schönste und gemütlichste Ort,
ein Kakao wie der Schnabel meines Vogels,
ein Zitronenkuchen, der warm und süß schmeckt,
der Abend, der gelb ist,
gold so unendlich lang, weil ich nicht einschlafen kann.
Felina
(8 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
.Die Aufgabe diesmal kam von Christoph Wenzel:
Stell dir vor, du müsstest anderen dein Zimmer beschreiben, dürftest dafür aber nur einen Gegenstand, eine Farbe, ein Geräusch usw. benutzen: „Wenn mein Zimmer ein Geräusch wäre, dann wäre es …“ Vervollständige die Sätze. Versuche nun die gefundenen Beschreibungen noch etwas genauer zu fassen, indem du z.B. einen „Relativsatz“ anfügst: „Mein Zimmer ist eine Blume, die das ganze Jahr blüht“. Jetzt verschiebst die Halbsätze jeweils um einen nach unten. Und schaust, was passiert ist.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Katharina Wulkow
Sonst wirkt es nicht
Eine Hand auf dem Geländer. Fingerspitzen ertasten Sandkörner. Risse im Holz. Am Himmel kreisen Möwen, unter den gellenden Rufen wogt die Ostsee.
Kristin überspringt die letzten zwei Stufen. Für einen Atemzug hängt der Schwimmreifen um ihre Taille. Sie ist bereit. Über den Strand zu wetzen, sich ins Wasser zu stürzen. Die Luft riecht wie damals. Das Ufer voller Algen, alle finden’s ekelhaft. Nur Kristin nicht. Sie denkt an Spinat. Spinat und Kartoffelpüree.
Turnschuhe versinken im Sand. Sie bückt sich, gräbt die Finger hinein, sieht dabei zu, wie er zu Boden rieselt. Weich, wie Puderzucker, nur schwerer.
Sandburgen und Burggräben, den ganzen Tag, weil die Augen ihres Bruders dabei blauer leuchten. Haare von der Sonne gebleicht, fast weiß. Geschmolzenes Eis läuft an Fingern entlang. Die Haut bitter von der Sonnencreme.
Sie winken ihr zu. Manchmal ist es unheimlich. Der Blick, die Sommersprossen, die Art, wie sie gehen. Mama eingehakt neben Jens, der sie um einen Kopf überragt. Lachend kommen sie näher. Das gleiche Grübchen. Links. Kristin fährt sich über die Wange, bohrt den Finger in die kleine Vertiefung. Die zwei lassen sich neben ihr nieder, das Meer in den Augen. Wellen wischen die Jahre fort.
Sie sitzt zwischen Menschen. Erahnt, was mal war. Wie auf einem alten, verblassten Foto. Gegenüber ihre Großeltern. Omas Gesicht gerötet, wie immer, wenn sie sich einen Schnaps genehmigt hat. Neben ihr haut Opa mit der Hand auf den Tisch. Dieser Hand. Lange, breite Finger, Schwielen von der Landarbeit.
Kristin ist sieben, als er sie eines Morgens aufweckt, den Zeigefinger auf den Lippen. Es dürfe nicht gesprochen werden, das hat er am Abend zuvor erklärt. Sonst wirke es nicht. Er hilft ihr beim Anziehen, im Halbschlaf wankt sie die dunkle Holztreppe hinunter.
Die Sonne ist noch hinterm Horizont versteckt. Sie überqueren den Hof, aus dem Stall kommt ein Schnauben. Gräser und Bäume schlafen unter Morgenreif, auf den Feldern liegen letzte Schneereste verteilt.
Opa hält Kristins Hand. So fest, dass sie schmaler ist, als er an der Quelle wieder loslässt. Die beiden ziehen Jacke und Schuhe aus, krempeln die Hosen hoch. Das Wasser sticht auf der Haut. Kristin presst den Mund zusammen, watet hinter Opa in den Fluss. Sie waschen sich Gesicht, Hals und Arme.
Bis ihre Füße klirren. Da hebt er Kristin aus dem Wasser, setzt sie auf der Böschung ab und rubbelt sie mit einem Handtuch trocken. Die Haut brennt, unter den Händen kitzelt das Gras. Opa streicht ihr über den Kopf, während die Sonne am Himmel emporkriecht.
Die Menschen am Tisch gewinnen an Farbe. Kristin entdeckt Mama in Omas Zügen, Onkel Peer in Opas Bewegungen. Puzzlestücke ihrer selbst um den Tisch herum verteilt. Hier, zwischen ihnen, ist sie der Wildfang, der jeden Abend Matsch im Flur verteilt. Die Frau, die frisch geschieden ist. Eben erst geboren.
Im Hafenkanal liegt ein Boot. Am Bug ist ein Schild festgenagelt, auf dem Lütte steht. Kristin lauscht dem Wasser, das an die Schiffswand schwappt.
Die Fenster im Dach der Pension gegenüber sind schwarz.
Vielleicht liegen sie noch wach, Mama und Jens.
Denken an Oma und Opa, wie sie ins Taxi steigen, immer wieder winkend. An Onkel Peer, der bei Umarmungen zur Planke wird. Er weiß nicht so recht, was das alles soll mit dieser Nähe und den Küsschen.
Kristin schlendert zur Lütten hinüber, sieht sich um und klettert über den schmalen Steg aufs Boot. Verharrt vor dem Steuerhaus. Geht die Reling entlang. Backsteinhäuser säumen den Kanal, eines davon sieht aus wie das, in dem sie früher gewohnt haben.
Ein Vierteljahrhundert nistet sich ein in ihrem Bauch.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
mosaik36 - Eine Wohnung mit Zukunft
mosaik36 - Eine Wohnung mit Zukunft
Winter 2022
.
INTRO
Wir wohnen seit zehn Jahren im bedruckten Papier.
Literaturzeitschrift.
Eine Zeitschrift mit Zukunft.
Hier wollen wir alt werden.
Man macht das eigentlich nicht, aber wir hoffen auf Milde aufgrund unseres Alters: Wir haben uns für diesen Einstieg einer Textstelle von Pia Schmikl (S. 20) bedient und an unsere Situation angepasst. Es ist nämlich so, dass wir dieser Tage das zehnjährige Jubiläum der mosaik1 feiern. Und es ist auch so, dass wir traditionell lieber nach vorne als zurück blicken. Vor zehn Jahren haben wir das nicht gemacht: Niemand hat sich überlegt, was wir dereinst beim 10-jährigen Jubiläum wohl machen sollen. Und so feiern wir unseren ersten runden Geburtstag etappenweise: In dieser Ausgabe findet ihr ein paar wenige, ausgewählte Texte, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Im Herbst werden wir mit euch allen gemeinsam ein mosaik-Fest feiern. Und dann fällt uns sicher noch weiterer Jubiläums-Schabernack in diesem Jahr ein.
Und gleichzeitig blicken wir weiter in die Zukunft – mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es warten spannende Projekte auf uns: Bücher, Kooperationen und neue Ideen! Aber gleichzeitig hat sich auch nach zehn Jahren wenig an der prekären Situation des Projektes mosaik geändert. Wir arbeiten gerne und nur von Idealismus getragen – hinterfragen diese Praxis aber immer öfter und fragen uns, wie es weitergehen kann.
Bevor wir jetzt aber selber zum Partycrasher oder zur Spaßbremse werden, wünschen wir euch viel Freude mit dem neuen Heft. Aber nicht vergessen: „Lesen ist eigentlich asozial.“ (Stefanie Stegmann, S. 82)
euer mosaik
.
.
Inhalt
Spezial: 10 Jahre mosaik
Stell dir vor, du kommst nach einer Lesung ins Gespräch: Was es bräuchte, wäre eine stärkere Förderung junger und neuer Autor*innen, am besten mittels einer Zeitschrift! Man beschließt die Gründung einer solchen. Gefühlt drei Tage später feiert man das 10-jährige Jubiläum.
Wir sind keine großen Freund*innen von Sentimentalitäten, aber wir erinnern uns in dieser Ausgabe sehr gern zurück, haben Wegbegleiter*innen des mosaik gefragt, an welche Texte sie sich erinnern, welche hängen geblieben sind – und präsentieren eine nicht repräsentative Auswahl auf den ersten Seiten. Nur original auf kariertem Papier (wie bei mosaik1). Viel Freude mit dem bisschen Nostalgie.
Wellengang oder Geflüster
Pia Schmikl – Ein Fisch kennt keine Angst vor dem Ertrinken
Georg Großmann – Altokumuli | Einige Pilzarten
Stefanie Nebenführ – Das Haus
Sigune Schnabel – Kindheit
Giovanna-Beatrice Carlesso – Der Hase rennt
dringende seelenstoffe
Elke Steiner – ich schenke dir mein natternhemd
Christina König – Gegenüber
Jimmy Brainless – Der Eiswürfel
Ronja Lobner – mein letzter rest
halb Wunschvorstellung
Leo Lemke – Der Wasserwandler
Signe Ibbeken – Kurz vor Glücksstadt
Hannah Beckmann – Dunkel, Linie, Dunkel
Vera Hohleiter – Fundstücke
Anja Bachl – Kaleidoskop
Kunststrecke von Ursula Wimmesberger
BABEL – Übersetzungen
Miklós Radnóti, geboren am 5. Mai 1909 in Budapest, war ungarischer Dichter jüdischer Abstammung. Sein Werk war beeinflusst von der tschechisch-ungarischen Avantgarde und dem französischen Expressionismus. Seine Tätigkeit als Handelskorrespondent im Unternehmen seines Onkels legte er 1930 nieder, um Ungarische
und Französische Philologie zu studieren. Im selben Jahr veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband ‚Pogány köszöntő – Heidnischer Willkommensgruß‘.
Der zweite Gedichtband wurde aufgrund des Vorwurfs der Obszönität verboten und brachte ihm beinahe eine Haftstrafe ein. In den frühen 1940er Jahren wurde er zur Zwangsarbeit eingezogen und schließlich nach Bor im heutigen Serbien deportiert. Bei einem Gewaltmarsch Anfang November 1944 kollabierte er nahe der österreichisch-ungarischen Grenze und wurde mit 21 anderen Mithäftlingen hingerichtet. Sein Leichnam konnte später in einem Massengrab identifiziert werden. Bei sich trug er ein Notizbuch mit seinen letzten Gedichten. Darunter den hier vorliegenden Zyklus ‚Razglednicák‘.
Miklós Radnóti – Homály / Dämmerlicht
– Két karodban / In deinen Armen
– Razglednicák / Razgledinicen
[foejәtõ]
Wo findet (denn eigentlich) Literatur statt? Im Kulturteil setzen sich diesmal gleich mehrere Texte mit möglichen, neuen und sinnstiftenden Orten der Literatur, von Lesungen, von Gesprächen über Kunst auseinander: Raoul Eisele bewandert den urbanen Raum, Hartmut Hombrecher und Martin Peichl beleuchten jeweils innovative Ideen und Umsetzungen von unabhängigen Lesereihen, Stefanie Stegmann berichtet im Interview von ihrer zwischen/miete – Lesungen in WGs!
Kreativraum mit Friedrich Rücker
.
.
>> Infos, Leseprobe und Bestellen
freiVERS | Alexandra Regiert
Geranien hegen im Auge des Sturms
Die Welt
war ein lindgrüner Acker.
Mehr Farbe als Frucht.
Auf ihm der Weizen
mehr Licht als Korn.
Geschlossene Geranienblüten
sonnten sich in seinem Schatten.
Über den Ulmen
glitten weiße Tauben
mit purpurnen Kehlen,
die gurrten blassrosa
über dem Vieh,
das in den Norden strömte:
hin zu fragilen Gliedern
einer heiligen Ordnung,
die zerbrach, verschmolz
und wieder zerbrach.
Die Welt
ist ein leeres Blatt
auf einer schneebedeckten
Hemisphäre.
Ein weißes Gesicht
im mäandrierenden Fluss.
Wandelnde Gestalten
zwischen Lamm und Lindwurm
füttern die Tauben
mit dunklen Oratorien,
beschwören den Wind,
der die Farben birgt
und die Ulmen krümmt
im eigenen Grün.
Verweilen weltlos
am Ende der Landschaft.
Hegen Geranien
im Auge des Sturms.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
POEDU - Neujahrstext
E EL
L EF
E AN
F T
A
N
T
In Zeilen kann man
ein Wort
trennen
Eine Zeile
ist
ein Puzzle.
Regenbogenfarben
Eine Zeile
ist ein Bild in Strichen.
Fairuz
(6 Jahre alt)
.
Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
Die Aufgabe diesmal kam von Brigitta Höpler:
Die Wiener Dichterin Elfriede Gerstl (1932 – 2009) hat nachgedacht, was sich mit Gedichtzeilen alles machen lässt. Ich mag dieses Gedicht sehr, und schreibe auch immer wieder auf, was sich mit Zeilen alles machen lässt. Ich wärme mich z.B. gerne mit einer Zeile, wie mit einem Schal. Stell dir vor, was du mit Zeilen alles tun kannst.
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sonja Kettenring
Grün ist die Hoffnung
Sie steht in der Einfahrt. Eingehüllt in die dicke Jacke mit der Fellmütze, den großen Koffer neben sich, sieht sie die Straße hinunter. Als warte sie auf jemanden.
Was hat sie vor?, fragst du dich. Wo will sie nur hin?
Eine Stunde später steht sie noch immer da. Die Jacke hat sie mittlerweile ausgezogen, es ist warm geworden.
Du gehst hinaus. Musst sowieso zur Mülltonne.
Hallo, sagst du und fragst, was sie vorhat. Willst du vereisen?
Während sie nach einer Antwort sucht, folgst du ihrem Blick die Straße hinunter. Ein Auto fährt vorbei, noch eins.
Ich werde abgeholt, sagt sie irgendwann und du nickst, als wären damit alle Fragen beantwortet. Du bleibst noch eine Weile neben ihr stehen, den leeren Mülleimer in der Hand. Schließlich gehst du wieder hinein ins Haus.
Alle Viertelstunde siehst du aus dem Fenster, dem zur Straße hin. Sie steht noch immer da.
Irgendwann hörst du die Haustür, in letzter Zeit hast du gelernt, auf die Geräusche des Hauses zu hören. Du siehst erneut aus dem Fenster. Die Einfahrt ist leer. Im Haus fällt eine weitere Tür ins Schloss. Die weiße Tür mit dem grünen Glaswindspiel. Wenn du leise bist, hörst du es klingen.
Du überlegst, ob du jemanden anrufen solltest. Müsstest. Aber du hast längst alle angerufen, sie können auch nichts anderes tun als du.
Nichts könnt ihr tun.
Früher hat es auch schon mal länger gedauert, bis sie eine Antwort für dich hatte. Früher hast du gedacht, das ist richtig, das ist gut so. Wie oft hast du selbst falsche Antworten gegeben, einfach nur, weil du zu schnell warst, weil du die erstbeste Antwort gegeben hast. Die erstebeste ist nicht immer die richtige.
Später dauert es fünf Minuten, bis sie antwortet. Obwohl die Frage doch ganz einfach ist, deiner Meinung nach.
Später antwortet sie gar nicht mehr, später sieht es so aus, als verliere sie die Frage auf dem Weg zur Antwort.
Früher warst du oft mitten in der Arbeit, wenn sie geklingelt hat. Manchmal hat sie einfach nur geklingelt, um Hallo zu sagen. Das sollte man öfter machen, hast du gedacht. Manchmal war es dir auch zu viel, dieses Klingeln, dieses Hallo. Du bist gern für dich allein.
Später konntest du dich nicht mehr auf deine Arbeit konzentrieren, weil du den Geräuschen des Hauses gelauscht hast. Den fehlenden.
Später bist du es, die bei ihr klingelt. Aber sie macht nicht auf.
Du willst niemand sein, der auf Klospülungen lauscht. Jemand, der sich abends aus dem Fenster lehnt, um herauszufinden, ob bei ihr noch Licht brennt. Der sich Arbeit im Garten sucht, um unauffällig durch Fenster zu spähen. Der Zweite anruft, um mit ihnen über Dritte zu sprechen.
So jemand willst du nicht sein.
Früher hat sie mit jedem gesprochen. Sie hat in zwei Wochen mehr Leute kennengelernt als du in fünf Jahren.
Später fragen dich diese Leute, was mit ihr los sei. Wo sie denn sei, man sehe sie gar nicht mehr? Ist sie etwa ausgezogen?
Nein, sie ist nicht ausgezogen. Das weißt du. Es ist so ziemlich das einzige, was du weißt.
Aber da muss man doch etwas machen, sagt einer und klingelt energisch an ihrer Tür. Sie macht nicht auf. Sie macht niemandem mehr auf. Doch: der Polizei. Einer hat die Polizei gerufen. Die Polizei kommt und versichert sich, dass sie sich nicht umbringen will.
Wie findet man das heraus? Du hättest auch gern so eine Versicherung.
Früher hat sie sich mit einem Topf Reis zu euch auf die Terrasse gesetzt. Niemand hatte mehr Freude an einem Topf Reis als sie. Früher bekam sie eine Lebensmittel-Kiste und hat mit der Lieferantin an der Tür gelacht.
Später bleibt die Kiste vor der Tür stehen, den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend lang. Sie muss doch die Kiste hereinholen? Irgendwann trägst du sie vor ihre Tür.
Später ist in der Kiste nichts weiter als Knäckebrot.
Du willst niemand sein, der in anderer Leute Kisten hineinschaut.
Jemand erzählt dir vom Sozialpsychiatrischen Dienst. Wieder rufst du Zweite an, um über Dritte zu sprechen. Aber was können die machen, nichts. Da können wir leider nichts machen, sagen sie. Die Dritte müsse selbst bei ihnen anrufe. Sie sei schließlich volljährig, es sei ihre Entscheidung.
Du legst eine Postkarte vor ihre Tür, mit einer Telefonnummer darauf.
Irgendwann stehen zwei Frauen vor der Tür, vom Sozialpsychiatrischen Dienst. Noch jemand hat mit ihnen über Dritte gesprochen, jetzt können sie doch etwas tun, können vor dieser Tür stehen. Aber die Tür geht nicht auf.
Früher hat sie geschrien, geweint, getobt und gelacht. Oje, hast du gedacht.
Später ist da nur noch Stille.
Früher hat sie Zitronenkerne in die Erde gesetzt. Vielleicht klappt es, vielleicht wächst etwas, hat sie gesagt und sich über die ersten Blätter gefreut. Früher war sie diejenige, die dort, wo du schon hundert Mal vorbei gelaufen bist, ohne etwas zu sehen, ein Feld voller blühender Krokusse entdeckt hat. Früher hat sie alle Wunder dieser Welt gesehen.
Einmal hast du sie von ihrer Therapeutin abgeholt und in die Psychiatrie gefahren. An der Anmeldung stand ein älterer Herr der nicht mehr wusste, wie er hierher gekommen war. Wo denn sein Zuhause sei, fragte ihn der Mann hinter dem Plexiglas. Das hätte der ältere Herr auch gern gewusst.
Im Warteraum waren viele Menschen, im Warteraum war es laut. „Wenn es nur einmal so ganz stille wäre“, zitierte sie Rilke. Nicht nur einmal, ihr musstet lange warten. Dann endlich wurde sie aufgerufen.
Soll ich mit reinkommen?, hast du gefragt.
Ja, bitte.
Der Arzt hatte lange, lockige Haare, der Arzt sah müde aus. Neonlicht flackerte, Neonlicht surrte. Dem Arzt ging die Geduld aus, es dauerte ihm zu lange, auf ihre Antworten zu warten. Sie solle doch jetzt bitte antworten, dann müsse er wenigstens nicht mehr das Surren des Lichts ertragen.
Sie wollte nicht bleiben. Sie wollte, dass ich sie wieder mit nach Hause nehme.
Der Arzt vergewisserte sich, dass sie nicht die Absicht habe, sich umzubringen. Er hat sie einfach danach gefragt. So geht das also.
Später fährt sie noch einmal jemand hin. Später bleibt sie dort und jemand räumt ihre Wohnung aus. Du fragst, ob du das Zitronenbäumchen haben kannst.
Heute ruft sie dich manchmal wieder an. Ihr redet über das Wetter, übers Essen und das Fernsehprogramm. Nie musst du lange auf eine Antwort warten.
Du bist ebenfalls umgezogen. In ein Haus, in dem es nur deine eigenen Geräusche gibt. Du warst erleichtert darüber, nicht mehr auf die Klospülung lauschen zu müssen.
Einmal in der Woche gießt du das größer werdende Zitronenbäumchen und fragst dich, ob du vielleicht wirklich einmal Zitronen ernten wirst.
Manchmal wünschst du dir, wieder vor ihrer Tür zu stehen. Der weißen Tür mit dem grünen Glaswindspiel.
Ist es nicht wunderschön?, hörst du sie fragen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Carlotta Frei
Überstand
Die Mühseligkeit des Arbeitenden spiegelt sich
im Eifer seiner Vernunft,
welche an Wänden klebt
wie Sprüche übers Leben,
an die man sich gern erinnert,
damit alles nicht so ernst erscheint
und immer denke ich an uns und unsere
Ernsthaftigkeit,ein Eingeständnis daran,
dass wir Menschen sind.
Trostlos und -spendend,
Energie und Sog,
ein Loch,
das Leben verlässt
und dem Tod entspringt oder andersrum?
Was war noch die Träne der Geweinten wert,
als sie fröhlich schien und wem haben wir dein Lachen zu verdanken?
Die zarten Falten, herrliche Streifen, behüten uns
wie eine warme Decke und Dankbarkeit dackelt
in Altersgruppierungen fort und fragt sich nicht,
wie wir auf diese Welt gekommen sind.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Simon Bethge
Von dem Raum
Von dem Raum erzählt sie, klein und weiß, und vollkommen schattenfrei, sensorische Deprivation, ja, so nenne man das, wie in diesen Meditationstanks oder den Folterkellern des Guo’anbu, des chinesischen Geheimdienstes, und zwei Stühle standen in ebenjenem Raum, genauso weiß wie der Rest, schwach nach frischem Lack hätten sie geduftet, obwohl sie sich an keine Luftbewegung erinnere, die ihr den Geruch hätte zutragen können.
Sie nahm also Platz, spürte die Linie der Rückenlehne durch ihren Pullover, gerade bis zum Schulterblatt, und als man ihn ihr vorsetzte, den anderen Menschen, den Mann, der die gleichen dicken Kopfhörerschalen auf den Ohren hatte wie sie, weich und dämmend und nur das Rauschen ihres Blutes, den Puls im Ohr, zurückwerfend, ja, da hätte sie sich gefragt, ob das schon alles sei, ob da noch was komme, vielleicht mit den Wänden, die bisher nichts gewesen waren außer weiß, oder ob die Stühle sich vielleicht zu drehen beginnen würden, zu kippen, aber nichts passierte, nichts.
Der Mann habe, so weiter, das alles gleich zu Beginn viel ernster genommen als sie selbst, gibt sie zu, obwohl sie nicht genau festmachen könne, woran sie das erkannt habe, denn sein Blick, der ja den ihren traf und nichts anderes bis zuletzt, war ganz normal, fast gelangweilt, so, als habe er sich schon zig Mal in dieser Situation befunden.
Sie sagt, sie habe eine Weile gebraucht, um sich ans Licht, besser, an seine Allgegenwart, zu gewöhnen, und nachdem es ihr schließlich gelungen sei, sicher, die Helligkeit sei erstmal unangenehm gewesen, aber eben auch authentisch, habe sie die Hände in den Schoß gelegt und ihr Gegenüber einfach betrachtet, habe, wie er, einfach gesehen und, das stelle sie gern zur Diskussion, auch gewartet, dass etwas in ihr vorgehe.
Sich löse vielleicht und hinüberschwebe, das Lächeln hätte sie sich deshalb einige Male verkneifen müssen, derart surreal sei ihr das Ganze und der Gedanke vorgekommen, was sollte sich schon lösen außer den Flusen an ihrem Oberteil oder winzigen Hautpartikeln, die, wie allgemein bekannt, täglich zu Abermillionen vom Körper abgestoßen würden, so natürlich auch jetzt, und sie stellte sich, sagt sie, sie stellte sich vor, allmählich von den Hautschuppen eingeschneit, verdeckt zu werden, wie sie so zu beiden Seiten des Stuhls auf den Boden, im Übrigen sei der weiß gewesen, ob sie das schon, nein, aber das könne man sich ja denken bei der Sorgfalt, mit der der Raum gestaltet worden sei, jedenfalls war ihr Gedanke, ihre bildliche Vorstellung, die von zwei Haufen, vielleicht auch einem Kreis aus diesen Schuppen und Schüppchen, der sich um sie bilden würde, bis so viele hinuntergetaumelt wären, dass man sie ohne Probleme mit dem nackten Auge sehen könnte.
Der Mann, der, wie sie sagt, dasselbe oder zumindest Ähnliches in verwandten Worten gedacht habe, das nehme sie jetzt einfach mal an, worüber sollte man während des In-die-Augen-Schauens, des dauernden Schauens und Angeschautwerdens auch sonst, übrigens wolle sie an dieser Stelle ein Lob für ihr Gegenüber aussprechen, das nicht etwa, wie man ja hätte erwarten können, irgendwann von ihren Augen abließ, um ihren restlichen Körper, um ihre Nase oder die Wölbungen unter dem Pullover, ganz zu schweigen von dem, was ihre noch immer im Schoß gefalteten Hände verbargen, durch das Verbergen geradezu akzentuierten, einer genaueren Betrachtung zu unterziehen, nein, brav habe der Mann seine Augen dort gelassen, wo sie hin gehörten, und das habe wohl dazu beigetragen, dass sie sich während der ganzen Zeit höchstens für sich, hier legt sie eine Kunstpause ein, nicht wegen sich selbst schämte.
Ihre Disziplin sei dagegen allmählich verpufft, oder, nein, Verpuffung klinge zu plötzlich, aber relativiere man sie durch eine Allmählichkeit in ihrem Ablauf, nun, dann ließe sich das schon so sagen, und als ihre Selbstbeherrschung langsam schwand, was ja eigentlich gegen den Sinn der Übung verstoßen habe, da habe sie angefangen, sich den Mann etwas genauer anzuschauen, von oben beginnend, also dem Scheitel, tatsächlich seinem Scheitelpunkt aus, der ein bisschen nach rechts verlagert war von ihr aus gesehen, und wie ein Schützengraben seine Haare in Freund- und Feindesland teilte, ein für ihr Empfinden ungeschickter Vergleich, aber, das müsse man verstehen, durchaus zutreffend, außerdem beweisbar, hätte sie, der kleine Vorgriff sei gestattet, den Mann danach wiedergesehen und fotografiert.
Nun, die geteilten Haare waren wie gesagt schwarz und mittellang und hinter die Ohren gestrichen, ihr Schnitt habe sie an alte Poster der Backstreet Boys erinnert, diese zum Heraustrennen in Jugendmagazinen, oder, präziser, an Nick Carter, der ja blond gewesen sei und so ein, nein, schon ein Süßer nach damaligen Standards, zwar nicht ihr Lieblingsmitglied der Band, rein vom Aussehen her, aber, da stimme man ihr sicher zu, der Talentierteste der fünf.
Solche Haare habe der Mann vor ihr gehabt, und dort, wo sie nicht von den Kopfhörern, diesen dicken, alles verschluckenden und einbehaltenden Kopfhörern, verdeckt worden seien, da hätten sie geschimmert im Licht, das womöglich von oben kam oder von hinten, wer könne das jetzt noch sagen, ein sehr schöner Glanz sei darin gewesen, passend auch zum Glitzern, denn nun seien ihre Augen weitergewandert, zum Glitzern der Ohrringe, die er trug, zwei auf jeder Seite, ihre Ränder hätten unter den Rändern der Kopfhörer hervorgelugt, je einer im Ohrläppchen, silbern, und einer im Tragus, näher zum Gehörgang, golden, warum sie die nicht früher bemerkt habe, fragte sie sich und antwortete sofort, dass sie sie ja strenggenommen gar nicht hätte bemerken dürfen, weil sie nicht Teil der Situation waren, nicht wie die Augen des Mannes, die weiterhin, das habe sie gespürt und direkt erwidert, auf ihren eigenen oder eher darin geruht hätten.
Derart ermahnt, fährt sie fort, sei ihre Konzentration für eine Weile zurückgekehrt, sie habe angefangen, ihr Blinzeln, von dem es ja, vergeblich habe sie danach gesucht, keinen Plural gebe, jedenfalls keinen ihr bekannten, ihr Blinzeln also zu zählen und es bald anzuhalten, das sei dem Mann nicht entgangen, denn auch er habe aufgehört für die nächsten paar Sekunden, die zusammengenommen nicht mehr als anderthalb Minuten ergeben haben können, alles andere sei ja weltrekordverdächtig und nichts, was sie oder ihr Gegenüber ausgehalten hätten, denn obwohl die Luft, wie gesagt, von nichts Äußerem oder Innerem bewegt worden sei, hätte das Rieseln der Partikel ja nicht aufgehört, und insofern seien auch ein paar in ihre Augen geraten, deshalb hätte sie sie wieder schließen, den Versuch, den Kampf fast schon, aufgeben müssen.
Stattdessen habe sie versucht, auf die, grob geschätzt, zwei Meter Entfernung zwischen den Stühlen und also den Beteiligten, die Augenfarbe des Mannes auszumachen, ein gar nicht so leichtes Unterfangen, trotz des Lichts und ihrer, das habe der Arzt vor Kurzem noch lobend angemerkt, einwandfreien Sicht, die weitaus fernere Zahlen und Buchstaben korrekt identifizieren konnte.
Grün, ja, das sei, sagt sie, die Farbe gewesen, auf die sie sich letztlich festgelegt habe, nicht ohne einen gewissen Restzweifel, aber in Anbetracht der Umstände hätte wohl auch eine eindeutige Erkenntnis zu nichts, jedenfalls nichts Substantiellem, geführt, daher hätte sie sich damit begnügt, sich vorzustellen, dass die Augen des Mannes nun eben grün waren, grün wie, und damit habe sie, wie sie erklärt, eine ganze Reihe von Assoziationen losgetreten, Smaragde, der einfachste Vergleich, das Meer an besonders tiefen Stellen, ein weiterer simpler Sprung, auch grün wie die Tür ihrer ersten Wohnung, deren Dielen, speziell an der Grenze zwischen Flur und Küche, noch spätnachts zum Knarren neigten, sehr zum Missfallen der unteren Nachbarn, einem, ja, wie solle sie sagen, äußerst streitlustigen Ehepaar, das, so glaubte sie damals, wohl in diesen ihren vier Wänden sterben wollen würde, folglich die verbliebene Lebenszeit mit möglichst viel ungestörtem Schlaf zu verbringen gedächte.
Außerdem grün wie die Streifen in Italiens Flagge, in Kenias Flagge, was das anging, wenngleich sie natürlich wisse, dass für die beiden Flaggen erstens unterschiedliche Grüntöne verwendet worden seien und diesen zweitens unterschiedliche Symboliken zugrunde lägen, ersteres Grün etwa gehe auf eine fixe Idee der Jakobiner zurück, die, beeindruckt von der französischen Revolutions-Cockade, das italienische Volk vor die Wahl gestellt hätten, und das italienische Volk habe sich eben für Grün, das Naturrecht, Gleichheit, Hoffnung und Freiheit, entschieden, wohingegen Kenias Grün schlichtweg die savannische Vegetationsvielfalt repräsentiere.
Sie habe, gibt sie zu, nicht in Betracht gezogen, jedenfalls nicht in diesem Moment, höchstens, und nicht einmal da sei sie sicher, hinterher, dass ihr Gegenüber irgendetwas von Vexillologie, Flaggenkunde, verstehen würde, wohl aber, dass ihm der Besitz ebendieser Augen, für den, wenn überhaupt, nur seine Eltern etwas konnten, im Leben einiges erleichtert habe, das Davonkommen mit vergessenen Hausaufgaben zum Beispiel, die Schmierereien an der Turnhallenwand, an Herbstnachmittagen verbrochen und, weil er zu eitel war, um sein Kürzel nicht darunter zu setzen, ihm nächstentags vom Rektor halbernst zur Last gelegt, dann die Suche nach einer Partnerin in der Hochzeit jugendlicher Hormonflüge, kurz, das da im Schädel des Mannes seien Augen gewesen, nach denen sie, seufzt sie, früher und bisweilen noch heute oft gesucht, in die sie sich bereitwillig verliebt hätte, eigentlich noch immer verlieben könne und es zugegebenermaßen ein Stückweit getan habe in jener Situation, ohne Absicht und Angst sei sie in die Vorstellung abgeglitten, zurück, tatsächlich, in die grün betürte Wohnung auf die Couch im Wohnzimmer, nur diesmal eben nicht allein, sondern gemeinsam mit dem Mann gegenüber, der, nach gut der Hälfte ihrer Zeit im weißen Raum, zwar ein wenig müde gewirkt hätte, die Spannung seiner Lider sei nachlässig geworden und die Fältchen im Winkel näher zusammengerückt, so, als sei er drauf und dran, bei einem Film, der ihn seit Längerem verloren habe, einzunicken, er den Impuls aber unterdrücke, um ihr, die den Film, den alten, zuvorderst ausgesucht hätte, mit Meryl Streep und Clint Eastwood, einem erstaunlich natürlichen Leinwandpaar, wenn man bedenke, dass die beiden gut zwanzig Jahre auseinander geboren wurden, dazu an entgegengesetzten Küsten Amerikas mit verschiedenen kulturellen Ausprägungen, und sie habe sich gefragt, wie lange der Andere, der gerade mit dem Einschlafen kämpfte, sein Kopf sank langsam, im Sinken näherte er sich ihrer Schulter, sich wohl noch mit der stillen Übelnahme begnügen würde, dass auch sie ein paar Jahre früher zur Welt, ergo auch länger in den Genuss ihrer Abgründe und Wunder gekommen sei, viel mehr Zeit gehabt habe als er, sich Koordinaten zuzulegen und in diesen einzurichten, denn manchmal, wenn sie von einem Abendessen mit Freunden nachhause spazierten, nicht selten, sie zumindest, beschwipst, da stellte sich so ein Ausdruck auf seinem Gesicht ein, der zu fragen schien, warum sie sich mit einem wie ihm überhaupt abgebe, ihm hingebe, schließlich war sie täglich von Menschen umgeben, deren Geschichten und Ansichten viel eher den ihren entsprachen, und mit denen sich zu unterhalten viel weniger Rücksichtnahme auf intellektuelle Leerstellen erforderte, ganz zu schweigen von seiner Einwärtskehrung, wenn das Gespräch einen bestimmten Punkt erreichte, überschritt, dieser Ausdruck, der, ja, war in manchen Nächten eine regelrechte Anklage, warum sie ihn nicht endlich anschreie, längst angeschrien habe, weil seine Versuche, mit ihr mitzuhalten, dermaßen armselig und durchschaubar waren, weil durch das ewige Vor und Zurück, vor zum Bessernwollen, zurück zu Selbstanklage und Verzicht, doch niemand etwas gewann, und zuletzt, weil sie ihm die Benennung niemals abnehmen konnte, so gerne sie es täte, das ging durch ihren Kopf, während jener des Mannes auf ihre Schulter, die jetzt ganz sanft berührt worden sei, und zwar von einer Hand, die keinem von ihnen gehört habe, sondern der Dame in Bluse und Uniform, sie habe sich zu ihr hinunter gebeugt und sie gebeten, die Kopfhörer abzunehmen, vom Stuhl aufzustehen, denn die Zeit, denn fünfundvierzig Minuten seien nun um, länger dürfe man in der Installation leider nicht, obwohl sie verstehe, wie intensiv das Erlebnis für einige werden könne, dürfe man leider nicht verbringen, da hinter der Tür schon die nächsten Besucher warten würden auf ihre Chance, einem Unbekannten in diesem Raum, weiß und klein, gegenüberzusitzen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Natalie Campbell
Zitronenbaumplantagen
Meine Lippen sind maulbeerblau,
unter den Nägeln klebt glitschiger Schneckenfilm,
von Pedralva weht Wüstenwind
lehmfarbene Sandpartikel
über sattgelbe Stoppelfelder, gespickt
mit schwarzen Krähenfedern.
Ein verkrustetes Korallenriff entsteht,
wo das Weizenmeer wogt.
Auf himmelblauem Tanzboden im Studio A
Arsenal ziehe ich sepiafarbene Spuren:
folge ihnen.
Dort, wo der Fluss eine Biegung macht
und Fische mit aufgedunsenen Bäuchen
ans Ufer schwemmt,
spiele ich dir ein Lied
von rot, gold und schwarz.
Sein tieferer Bedeutungsinhalt
entzieht sich deiner oberflächlichen Betrachtung,
und meine Erinnerungslücken treiben flussabwärts,
verborgen unter schwarzen Wassermassen.
Werden Sie endlich erwachsen!
Fordert mich meine Therapeutin auf
und darauf rasiere ich mir die Haare ab,
schmelze Strähne um Strähne ein,
vollziehe eine Metamorphose
von Wikingerbraut zur kindlichen Prinzessin
und betaste staunend den zarten Flaum.
Ich heuer dich an: für ein Kunstprojekt.
Nachts stemmen wir mit einem Presslufthammer
ausgewählte Hauptverkehrsknotenpunkte auf,
und pflanzen Zitronenbäume
in die gähnenden Krater.
Brich die Versiegelung! sprayen wir neongelb
auf Zugwaggone des städtischen Nahverkehrs.
Dann werden wir berühmt, über Landesgrenzen hinaus
und reich, das Geschäft floriert,
denn Autobahnen erweisen sich als fruchtbarer Boden
für Zitronenbaumplantagen.
Prinzessinnen kämmen ihr pinkes Haar
mit pinken Gabeln und essen am Abend
Topfenknödel mit Trüffelkern
auf flambierten Himbeeren
und verdauen das ganze
in ihrem pinkfarbenen Magen.
Wegen der Erderwärmung
speichern Wolken mehr Wasser
und wenn sie sich überm Garten entladen,
schlafe ich seelenruhig im Überschwemmungsgebiet.
Ich weiß, dass der Fluss weiß:
ich bin auf seiner Seite.
(Pocahontas war ohne den weißen Schnösel
eindeutig besser dran)
Auf der Suche nach dem Goldenen Schnitt
verliere ich mich in der fünfzähligen
Symmetrie von Seesternen.
So schön stand der Weizen noch nie,
don’t be apologetic!
Und wenn du dann fällst, fühlt es sich an, wie:
fliegen.
.
.
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at