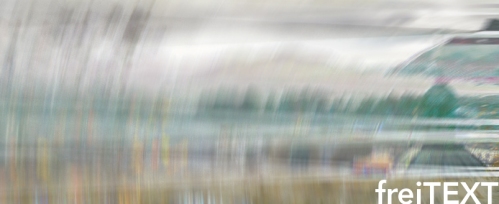freiTEXT | Karsten Redmann
Die Flucht
Mai 1972 - Ostharz, innerdeutsche Grenze, Staatsgebiet der DDR.
Seit zwei Tagen regnet es, ununterbrochen regnet es. Gassner muss an Bindfäden denken, die in der Luft hängen. An unzählige Bindfäden, Striche und Vertikalen. Regenwasser dringt durch die Kronen der Eichen, Buchen und Tannen, ergießt sich, wie an unsichtbaren Fäden, auf den mit Moos bewachsenen Waldboden, auf Ameisenvölker, braune und schwarze Käfer, und auf Gassner selbst, der an einen Baum gelehnt sitzt, Wasser in den Schuhen, sein Hemd völlig durchnässt. Die Brille setzt er nicht ab. An Schlaf ist nicht zu denken. An Gassners Rücken fließt geräuschlos Regenwasser ab. Am Boden bilden sich dunkelgrüne Pfützen, Tannennadeln darin, vereinzelt auch kleinere Spinnen und Fliegen - Kleintiere, die mit dem Tod ringen. Es riecht nach Moos und Flechten. Der Regen prasselt unentwegt. Wenn er doch nur aufstehen könnte und loslaufen, dann würde er vom Punkt zur Linie werden. Doch Gassner läuft nicht los, weil er nicht weiß, wohin, weil er keine Kraft mehr hat, sich verlaufen hat, in diesem regennassen deutschen Wald. Aber du musst, Gassner, weil du es willst. Du hast keine andere Wahl. Vergiss die Bindfäden in der Luft, den Wolkenbruch. Verdränge den Regen, die Kälte, den Schlaf. Im Grunde bist du allein, ja, aber es ist gut, hier und jetzt allein zu sein. Und später? Später kannst du schlafen, tagelang schlafen. Träumen wirst du dann, endlich wieder träumen. Von drüben? Nein, nicht von drüben, denn wenn du auf der anderen Seite angelangt bist, hast du ja dein Ziel erreicht. Und die kleine Öffnung in der Wolkendecke, auf Caspar-David-Friedrichs Bild, vom Mönch am Meer, wäre damit mehr als ein reines Versprechen deines Vaters gewesen – ein Ausweg nämlich, ein gelungener Fluchtversuch.
Aber halt, war da nicht ein Geräusch? Eine kurze Bewegung? Ein Knacken von Ästen? Dort hinter dem Baum?
Vor vier Tagen war Gassner mit 10.000 DDR-Mark in 50er und 100er Scheinen, seiner Geburtsurkunde, seinen Schulzeugnissen und dem Gesellenbrief, alles fein säuberlich in einer wasserdichten Plastiktasche verstaut, in einen Bus gestiegen, hatte den Bauernhof, die schon alt gewordene Mutter und den Bruder verlassen, und dabei versucht, möglichst unauffällig auszusehen - bei seinem ersten Fluchtversuch. Sein Plan schien aufzugehen: Der alte Fahrer des Omnibusses hatte seine Sonnenbrille nicht einmal abgesetzt, hatte nur Gassners Fahrkarte entgegen genommen und sie am perforierten Kartenrand abgerissen, so, wie es allgemein üblich war. Auch während der Fahrt in die nächstgelegene Stadt hatte der Fahrer nur selten in den Rückspiegel geblickt, was gut war, denn so ging es weiter, Kilometer für Kilometer. Die Mitreisenden waren so unauffällig wie Gassner selbst - darunter eine dickliche Frau, um die 30, mit kurzen Haaren, einem blassen Gesicht und einem Säugling auf dem Arm. Sie hatte ihren roten Wollpullover nach oben gezogen, so dass man ihre rechte Brust und den Kopf ihres Kindes sehen konnte. Unentwegt starrte die Frau auf die flaumigen schwarzen Haare ihres Säuglings und strich mit ihren dicken Fingern über Kopfhaut und Haar. Ihr gegenüber saß ein junger Mann, so um die 20, in einem hellen Cordanzug, Zigarette im Mund, ein altes, zerlesenes Buch in der Hand. Sein Blick wanderte hellwach über die Zeilen. Gassner fragte sich für einen Moment, was der Mann da las. Den blauen Einband kannte er nicht. Die Schrift darauf wurde von der Hand des Mannes verdeckt. Die hochgepriesenen Amerikaner, deren Bücher ihm sein Vater früher über Umwege besorgt hatte, kamen Gassner in den Sinn: Hemingway und Faulkner. Und während er an den alten Mann und das Meer und all die anderen Geschichten dachte, streifte sein Blick über das dichte Grün der riesigen Alleebäume – da tauchte plötzlich dieses Tier auf. Es hockte in einer der hellgrünen Baumkronen und blickte zur Seite. Ein Wisch, schon vorbei. Konnte das wirklich sein, hatte Gassner sich gefragt und sich erst wieder beruhigt, als er kurz darauf einen Wanderzirkus auf einer Wiese entdeckte. In der Mitte stand das große Zirkuszelt, am Rand des Lagers bunte Wohnwagen aus Holz, Tiere in Käfigen und vor den Käfigen jonglierende Artisten, Bälle und Keulen in der Luft. An einem kleinen Zelt flatterten bunte Fahnen im Wind. Er hatte sich also nicht getäuscht, sicher war es ein Affe gewesen. Ein Schimpanse auf der Flucht. Einer, der sich aus dem Staub machen wollte, einer der die haarigen Beine in die Hand genommen hatte, um diesem ganzen Zirkus hier zu entkommen. Sehr viel später, im Wald umher irrend, den Grenzzaun suchend, hatte sich Gassner gefragt, wie weit so ein Schimpanse, ganz auf sich allein gestellt, überhaupt käme. Denn es hatte angefangen zu regnen, und Gassner hatte sich vorgestellt, wie der Affe durch den Regen und über die Felder lief, halb springend, halb taumelnd. Auf den Zirkus folgten: ein Dorf mit Brunnen, ein Zweites ohne, dann ein Drittes, und nach einer halben Stunde Fahrt hatte der Bus schließlich angehalten, Gassner war ausgestiegen, hatte in die helle Mittagssonne geblinzelt, sich nach allen Seiten umgeschaut, seine Tasche genommen und sich auf eine der Holzbänke gesetzt. Hier wäre er also Besucher dieser Kleinstadt, nicht mehr und nicht weniger. Nur daran müsse er sich halten, an nichts anderes. Ganze fünf Mal sollte Gassner umsteigen, so der Plan: vom Bus in einen weiteren Bus, von einem Zug in den nächsten und so weiter. Bei den geplanten Kurzaufenthalten in den Dörfern und Städten wollte er sichergehen, dass ihm niemand folgte.
Moment. War da etwas? Ja, ein Geräusch. Er hat es gehört - da hinten. Jetzt kann er es sehen, verschwommen, wie durch Fäden hindurch, ein orangener Fleck auf seiner Brille, springt über Baumstümpfe und verliert sich im Unterholz. Wahrscheinlich ein Tier, schon vorbei, keine Gefahr. Durchatmen... Wind kommt jetzt auf. Am Himmel ziehen Wolken westwärts. Zwischen den Baumwipfeln entdeckt Gassner helle Flächen Licht, hier und da auch eine Vorstellung von Blau. Diese kleinen, blauen Flächen dehnen sich langsam aus. Hat es wirklich aufgehört zu regnen? Es fehlt ein Geräusch, ihm fehlt ein Geräusch - der Regen als Kulisse. Die Fäden sind weg. Jemand hat sie abgeschnitten. Gassner setzt die Brille ab, streicht mit einem Tuch über die Gläser, schaut sich um und setzt sich in Bewegung, ein federnder Gang. Die Sonne weist ihm den Weg. Nach einiger Zeit kommt es ihm vor, als würde sich der Wald um ihn herum verändern, als stünden die Bäume nicht mehr so dicht beisammen, als lichte sich der Wald, oben und auch an den Seiten. Gassner greift in die Tasche seiner nassen Hose und bricht ein Stück Schokolade, steckt es in den Mund und bewegt es mit der Zunge hin und her. Quer über ihm steht die Sonne, sie blendet.
Auch ich sehe sie jetzt und schreibe es auf. Die Sonne blendet. Mit meiner Hand schütze ich meine Augen und folge Gassners Schritten. Er sagt: „Los jetzt!“ Und: „Wir müssen weiter. Sofort!“ Wir?, möchte ich ihn fragen, und schütteln möchte ich ihn dabei, aber vielleicht ist es besser so, wahrscheinlich braucht er mich jetzt. Also folge ich seinen Anweisungen, folge ihm. Schließlich müssen wir weiter, er und ich. „Nicht so schnell!“, rufe ich, denn mir geht die Puste aus. Aber er läuft weiter, den Blick stur nach vorne gerichtet. Ich komme kaum hinterher. Wieder muss ich stehenbleiben und nach ihm rufen. Schnell ermahnt er mich, leise zu sein. „Wir wollen doch nicht riskieren geschnappt zu werden“, mahnt er. Zwischen den Bäumen weiten sich die Lücken - Lichtungen tun sich auf. Gassners Schritte werden verhaltener, vorsichtiger, er bleibt stehen, kniet sich hin, hört in den Wald hinein. Ein Geräusch? Nichts bewegt sich, nur die Wolken – ihre Schatten ziehen über uns hinweg. Vor uns öffnet sich eine Schneise, daran angrenzend ein hoher Zaun mit Stacheldraht. Plötzlich ein Wagen, kommt von rechts heran, immer näher, das Motorengeräusch schwillt an. Dann Stille, der Wagen vorbei. Gassner schnappt nach Luft. Hat er die ganze Zeit die Luft angehalten? „Endlich“, sagt er und es soll wohl beruhigend klingen. Ich sehe, wie Gassner die Umgebung genau beobachtet, sein Blick wandert vom Wachturm über die Wiese, den Zaun entlang. Erneut putzt Gassner seine Brille, doch die Schlieren bleiben. „Der Turm ist das Problem“, sagt er, nimmt ein letztes Stück Schokolade aus der Tasche und kaut darauf herum. „Wir dürfen kein Risiko eingehen“, sagt er und ich gebe ihm zu verstehen, dass ich seine Ansicht teile, dass es besser wäre, eine weniger einsehbare Stelle zu finden. Er nickt, ich nicke, wortlos folge ich ihm. Als er Sekunden später über eine Baumwurzel springt, knickt er ein, hält sich den Fuß. „Verdammter Mist“, sage ich. Ich gehe in die Hocke um mir den Fuß genauer anzusehen. „Das erste Mal“, sagt er, „meine erste Verletzung.“ „Und jetzt?“, frage ich. „Was willst du tun?“ „Ach, das krieg´ ich schon hin“, sagt er, „hast du Schokolade dabei?“ „Keine Schokolade, aber schau mal in deiner Tasche nach“, sage ich. Erstaunt fischt er ein Päckchen Traubenzucker heraus. „Das ist ja West-Ware“, sagt er und schaut mich fragend an. „Ein Geschenk“, sage ich. Er steht auf. In seinem Gesicht lese ich Schmerz. „Soll ich dir helfen?“, frage ich. „Nein, das schaffe ich schon!“, sagt er. Er nimmt ein gelbes Tuch aus seiner Tasche, legt es auf den Waldboden und drückt es gegen das feuchte Moos. Dann bindet er es fest um seinen Fuß. „So“, sagt er, „das müsste gehen.“
Wie lange hatte er darauf gewartet, diesen Wald zu betreten, diesen einen Schritt weiter zu gehen als die meisten anderen. Viel weiter als sein Vater war er gekommen; sein Vater, den sie eineinhalb Jahre zuvor inhaftiert hatten und dessen Tod der Staat vermeldete, als handele es sich um eine bloße Randnotiz. Sie sagten, dass es seinem Vater in den letzten Wochen sehr schlecht gegangen wäre. Er hätte jedwede Hilfe verweigert. Den Staat träfe keine Schuld. Ob es einen Abschiedsbrief gäbe, hatte Gassner einen der Verantwortlichen gefragt. Und der hatte ihm eine Skizze in die Hand gedrückt, auf der recht wenig zu erkennen war, nur Striche und Linien. „Das hier“, hatte er gesagt und ihm das Stück Papier ausgehändigt, „ist alles was wir von ihrem Vater haben.“ Auf den ersten Blick war wenig zu erkennen und Gassner brauchte eine Weile, um den stilisierten Mönch, den Himmel und das angedeutete Meer zu erkennen. Und er erinnerte sich, wie ihm sein Vater, in der alten Wohnung in Berlin, das Bild des Mönchs am Meer in einem Kunstband gezeigt hatte. Wie er ihm alles über das kleine Bild erzählt hatte, um dann mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand über eine helle Stelle in der Wolkendecke zu kreisen und zu sagen: „Siehst du das, mein Sohn? Siehst du das Aufklaren? Hier, direkt über dem Kopf der Figur?“, und er kreiste wieder um die Stelle, „ siehst du, hier öffnet sich der Himmel.“ Damals hatte Gassner die Anspielungen seines Vaters nicht verstanden, nicht gewusst, was er ihm damit sagen wollte. Und vielleicht war es auch besser so gewesen.
Wir kauern auf dem Boden und sondieren die Lage. Gassners Blick wirkt verschlossen. „Was ist?“, frage ich. „Ich habe Angst“, sagt er. Ich sage: „Ich weiß“, und lege meine Hand auf seine Schulter. „Warum tust du das alles?“, fragt er. „Eigentlich machst du doch alles selbst“, sage ich. „Außerdem folge ich dir, weil ich mich für dich und deine Geschichte interessiere.“ Er lächelt. „Das ist schön“, sagt er. „Aber was ist, wenn ich im Zaun hängenbleibe? Oder sie mich vom Zaun schießen? Oder eine Mine hochgeht?“ „Warte mal“, sage ich und zeige mit dem Finger auf die andere Seite, Richtung Westen. Und während Gassner meinem Fingerzeig folgt, taucht ein niederländischer Reisebus mit Grenztouristen auf. „Das sieht doch ganz nach einer guten Chance aus“, sage ich. „Los. Lauf los. Jetzt.“ Erst humpelt er, dann rennt er, noch 200 Meter, 100 Meter, 50, dann der Zaun. Gassner ist schnell. Seine rechte Hand greift in den Draht und zieht sich hoch. Im Bus sehe ich ein Blitzlichtgewitter. Gesichter kleben an den Fenstern, Münder sprechen aufgeregt miteinander. Die Oranier-Route führt hier, 1972, an der deutsch-deutschen Grenze vorbei. Für die Touristen aus den Niederlanden ist der Grenzzaun seit Jahren ein willkommener Anlass Fotos zu schießen, und einer wie Gassner, jetzt und hier, das ideale Motiv: ein Mensch auf der Flucht. Gassner ist jetzt hinter dem ersten Zaun. Ich sehe wie er sich zu mir umschaut. „Lauf!“, rufe ich. „Lauf um dein Leben!“ Ein zehn Meter breites Minenfeld. Gassner steht davor. Der Bus hält an, die Rücklichter leuchten. Er läuft über das Feld, läuft sehr schnell. Er fällt nicht, fliegt nicht in die Luft. Dann der zweite Zaun. Wieder zuerst die Hände, die Füße, ich muss an das Tuch an seinem Fuß denken, das gelbe Tuch. Ich sehe den gelben Knoten wie er am Draht entlang schrammt. Gassner lässt sich fallen, sein Körper bleibt liegen. Jetzt erst schaut er zum Bus, stützt sich auf, schaut zurück, ein Lächeln. Humpelnd verschwindet er im westdeutschen Wald. Ich stehe auf und bemerke erst jetzt, dass sich Stimmen nähern. Ein Hund hechelt. Zwei Grenzer mit Schäferhund laufen an mir vorbei. Plötzlich bellt der Hund. Ich bleibe stehen und sehe, wie sie den Hund von der Leine lassen. Blitzschnell rennt dieser über die Wiese, bremst am Zaun, überschlägt sich fast. Das Bellen hört nicht auf. Dann betreten die Grenzer die Wiese, pfeifen den Hund zurück und stecken sich Zigaretten an. Rauch steigt auf und verliert sich über der Schneise. „Sieh mal“, sagt einer der beiden und hebt einen weißen viereckigen Gegenstand vom Boden auf, etwa so groß wie eine Briefmarke.
„Sieht komisch aus“, ergänzt er.
„Das ist doch Traubenzucker!“, sagt der Zweite, steckt sich das Stück in den Mund und blinzelt in die gelbe Sonne.
Karsten Redmann
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Claudia Kraml
Wolkenbruch
Und vielleicht hätte ich doch lieber heimfahren sollen, denke ich mir zögerlich, als ich um Punkt drei Uhr nachts erwache und im Takt der prasselnden Desorientierung um Luft ringe. Stickig ist es hier im Zimmer, und heiß, so unendlich heiß, als ob man sich erst einmal mit scharfen Messern bewaffnet hindurchkämpfen müsste, um wieder Klarheit in seine Gedankengänge zu bringen. Luft, Gedanken und Angst, mehr ist es eigentlich nicht. Ja, Angst, um sie nun endlich zu nennen, und nicht etwa Furcht, denn diese augenblickliche Emotion ist durch nichts und niemanden begründbar.
Draußen herrscht gerade frühsommerlicher Weltuntergang, die Blitze jagen sich gegenseitig hinter dahinrasenden Wolkenfetzen, und Sturmregen lässt die Grenzen zum Hagel mit jedem leisen Knall auf dem Blechdach ein bisschen mehr verschwimmen. Aber das allein ist noch längst kein Grund für meinen jämmerlichen Zustand. Ich weiß ganz genau, dass es wieder mal eine von diesen Panikattacken ist, dass ich um Himmels willen Ruhe bewahren und meinen Atem nicht gewaltsam unter Kontrolle bringen soll. Mein Hirn ist nämlich längst nicht so klug, wie es manchmal tut, und gaukelt mir die furchtbarsten Szenen vor, die ich an dieser Stelle lieber nicht beschreibe, um nicht ein weiteres Mal hineingezogen zu werden in diese düstere Welt des zitternden Konjunktivs. Genauer gesagt ist es dumm, unendlich dumm, nimmt sich Monat um Monat viel zu viel vor und beginnt mich mit Szenen wie der jetzigen zu bombardieren, sobald es merkt, dass das alles vielleicht doch ein bisschen zu anmaßend war.
Ach Victoria, mit mir ist so vieles nicht in Ordnung. Kannst du eigentlich schlafen, drüben auf der anderen Uferseite, inmitten all des Getoses und unnötig hallenden Lärms? Natürlich würde ich es dir wünschen, aber irgendwo ist dann doch auch immer die egoistische Hoffnung, nicht allein zu sein mit meiner angstvollen Bewusstheit der Dinge.
Zu Hause wäre mir das nicht passiert, hält mir der vernünftige Teil meines Ichs wieder vor, und ich ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass du vielleicht doch auch schon heimgefahren bist. In deine kleine Welt des Vertrauten, wie auch ich eine solche kenne, Bann und Erholung zugleich, vorhersehbar in ihrer Beschränktheit und doch vor allem auch Rückzugsgebiet, wenn die peitschenden Kleinstadtwellen über dir zusammenzuschlagen scheinen. Nein, ich weiß nicht wirklich, wovon ich rede. Wie denn auch, sind mir so lange Ansprachen in der zweiten Person Singular doch eher fremd, und ich kann eigentlich nichts weiter behaupten außer der Tatsache, dass dein leerer Stuhl neben mir wieder einmal wie ein Mahnmal wirkte. Die Dinge kommen leider zumeist anders, als man es sich erwartet hätte. Aus logischer Hinsicht ist das völlig einleuchtend, denn wenn man all seine Hoffnung in genau einen von zigtausend möglichen Ausgängen setzt, kann es eigentlich nur schiefgehen.
Nun gut, ich werde nicht mehr versuchen, mit dem arroganten Elias über nur in meiner Phantasie existente Dichternachlässe zu debattieren, im naiven Glauben, du mögest vielleicht irgendwann doch wieder erscheinen und dich gemeinsam mit uns im ausweglosen Hypothesengewirr verlieren. Es hat schlicht und einfach keinen Sinn. Solche Erkenntnisse sind hart, tun weh, aber nicht so, dass ich es nicht ertragen könnte. Der Mensch hält so vieles aus, vielleicht mit etwas Schlafentzug und gelegentlichen kognitiven Störungen, Trugbildern, unfreiwilligem Gestammel – allein: Er tut es.
Ergo verfüge auch ich über ungeahnte Kräfte, wie etwa jene, trotz völliger Übermüdung um halb vier Uhr nachts Texte wie diesen mit bebenden Fingern auf den Bildschirm zu pinnen. Was nun aber nicht etwa eine hervorstechende prosaische Qualität implizieren sollte, denn wer diesen hier gelesen hat, kennt eigentlich schon all meine Schreiberzeugnisse – weil es ja doch immer nur um dieselbe Sache geht und ich nicht aus meiner Haut herauskann. Aus meinem beschränkten Sichtfeld, das mir Tag um Tag nur die eigene verfahrene Situation vor Augen führt. Manche nennen sie filmreif, aber so weit würde ich nie gehen. Die Leute sehen einfach gern zu, wie man sich plagt. Ich weiß, ich bin eine Person der Fragezeichen, und es ist bei weitem nicht alles so, wie ich es sage, wenngleich das nicht heißt, dass meine Worte nicht wahr wären. Manchmal herrscht bloß Schweigen vor, und mitunter verrate ich mich auch und hoffe, dass es niemand mitbekommt, was bei gedankenlosen Halbsätzen zwischen Tür und Angel ohnehin sehr unwahrscheinlich wäre.
Die Gegenwart wird durch die Vergangenheit geprägt, und Letztere war nun einmal etwas kurios, wie ich es auszudrücken pflege, aber auch das ist schon wieder viel zu konkret und ich sollte lieber den Mund halten. Darauf achten, dass einfach nichts passiert und am Ende des Jahres erleichtert das Schwinden des Damoklesschwerts zur Kenntnis nehmen. Irgendwann einen abenteuerlichen Roman darüber schreiben, falls mir die Worte bis dahin noch nicht abhandengekommen sind. Die Leerstellen füllen, die sich durch kryptische Andeutungen wie diese immer mehr auftun, je lichter die Welt am Horizont nun schon wieder wird.
Aber letztendlich ist alles ja doch so einfach und es lässt sich mit punktgenauer Präzision erkennen, dass mir wieder mal jemand ganz Bestimmter im Kopf herumspukt, nennen wir es: Ein Du. Welches mich nicht mehr loslässt, seitdem ich nach der vermeintlich ersten Begegnung mit voller Wucht gegen eine dieser feuerfesten Glastüren prallte.
Und vielleicht ist das auch schon das Einzige, worum es hier geht.
Claudia Kraml
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Helene Ziegler
Zeitlupe
Die Uhr macht tick und tack und tick und tack und tick und tack den ganzen Tag. Doch worauf warten wir? Warum leben wir? Warum sind wir hier, auf dieser Welt, die jeder von uns Heimat nennt - wir sind doch alle nur Menschen, denen die Zeit davon rennt.
Der Wecker erklingt und der Tag beginnt. Die Kleidung ist grau, die Augen sind leer, es ist lange her gelacht zu haben. Spaß und Freude gibt’s nicht mehr, denn wir laufen alle mit, in einem Strom von dem wir denken, dass er uns Halt gibt, uns liebt – uns aber eigentlich nicht verdient.
Jeder trägt auf den Schultern seine eigene Last, keiner hat mehr Rast, weil du einfach zu viele Verpflichtungen hast. Denn die Zeit bleibt nicht stehen und du musst weiter gehen.
Ich kann es nicht verstehen, warum wir Menschen uns das antun, wir werden gegen Gefühle immun. Kalt und verloren – einsam und erfroren.
Der Mensch verliert, ist irritiert, da sein Kopf nicht kapiert, was draußen passiert. Sind wir überhaupt noch Menschen? Nein, denn was ich tagtäglich sehe und tagtäglich tue, ist nicht mal menschenähnlich.
Wir sind alle wie ein Computer programmiert, praktisch auf´s Leben trainiert. Gerne würd ich in einer Welt wie dieser noch sagen können „Ich bin immer noch ich“, aber das stimmt nicht. Angepasst, zugeschnitten - gebe ich jeden Tag die gleiche Vorführung, zur selben Zeit am selben Ort und ich kann nicht fort. Keiner kann sich befreien aus dem Bann, aus dem Bann der Zeit, niemand hält sie an. Und wenn man einfach nicht mehr kann, hält unser Herz dann an. Die Zeitlupe beginnt und während die Zeit so schnell verrinnt, verweht das Leben im Wind.
Wir alle sind gleich-berechtigt zum Leben, doch du lebst und hast für´s Leben keine Zeit. Bist frei um zu leben, frei um zu sein - doch in der Menge allein.
Wir sehen Probleme, wo keine sind. Versuchen zu erklären, wofür es keine Gründe gibt. Versuchen zu verhindern, was man nicht verhindern kann, es gibt nun mal Dinge, die man nicht ändern kann. Aber der Mensch denkt, mit Denken kann er alles erreichen, der Zeit, dem Tod, dem Leben ausweichen.
Jeder ist nach außen isoliert, das ist eine Schutzmaßnahme aus Angst, Verzweiflung, Selbsthass. Also warum sind wir nun hier? Letztendlich werden wir doch sowieso verlieren, das Leben verlieren, weil unsere Herzen erfrieren.
Die Uhr tickt munter vor sich hin, wir sind alle in diesem verdammten Kreislauf drin. Jeder schiebt alles vor sich her, aber das will ich nicht mehr. Wir tun nichts, reden davon wie´s sein soll aber nicht ist – bis unsere Zeit dann abgelaufen ist. Klammern uns an etwas, was unsere Seele zerfrisst – bis unsere Zeit dann abgelaufen ist.
Versuch es wenigstens, immer weiter zu gehen, ohne zurück zu sehen. Achte nicht nur auf die Zeit, denn die bleibt sowieso nicht stehen. Lass dir nur nicht von der Zeit das Leben nehmen.
Helene Ziegler
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Katrin Theiner - Teil 2
Landschaft zum Verschwundensein (Auszug 2)
Dies ist Teil 2 - für Teil 1 aus der Vorwoche hier entlang.
Ich hatte es dunkel gelassen. Laute Schritte im Flur. Die schrille Stimme der Tante, die Hinweise abfeuerte: Seit elf Stunden, Sportschau, Herztabletten, Waffe weg, Vorstandstreffen. Männerstimmen um sie herum. Hundegebell. Arminius winselte. Sie gingen ums Haus, durch den Garten, über die Beete. Sie gingen weiter über die Felder zum Waldrand. Ihre Taschenlampen warfen weiße Lichtschleifen zwischen die Bäume. Ich zog die Gardinen zu, machte die Nachttischlampe an, operierte meinen Finger mit Nadeln. Ein Holzsplitter tief unter meinem Nagel. Später Polizei. Die Tante weinte, suchte Fotos von dem Herrn Onkel, den eh jeder kannte. Es klopfte. „Jan-Carl? Die Herren wollen dich sprechen.“ Hatte nix gesehen. Keine Ahnung. War nicht da. In der Schule. Hatte Musik an. In der Nacht sah ich meine Eltern im Traum. Wir saßen auf einer Decke im Freibad. Meine Mutter im Bikini, in einem anderen Bikini als die anderen Mütter. Mein Vater mit Lederjacke und Sonnenbrille, ein Bier in der Hand. Ich war nackt, ein hellblauer Schwimmring um die Hüften. Weißes Eis floss über meinen Bauch. Ich hatte schon früh verstanden, dass wir anders waren. Nicht schlechter, anders. Meine Eltern sahen anders aus, ich sah anders aus, hieß anders. Ich mochte das, mochte nicht die dicken Mütter deranderen Kinder, mochte die Rippen meiner Mutter, die langen Finger, die bunten Nägel, die mir Pommes in den Mund steckten, nachdem sie sie kalt gepustet hatte. Mein Vater setzte mich auf seinen Schoss. Mein Po klebte an seinem Bein. Überall Eis. Ich hab’s getan, Papa. Ich hab’s getan. Er strich mir über den Kopf. Is’ gut Junge. Ich muss nach Weiterstadt. Iss dein Eis.
„Komm runter. Ich kann das nicht sehen“, sagte ich zu Olga, streckte meine Hand zu ihr und griff mit der anderen ihren weißen Stiefel. „Hast Schiss, dass ich falle?“, lachte sie, lehnte sich weiter über die Brüstung des Hochstuhls und schaute mich auffordernd an. „Mann, krieg dich ein“, sagte sie. Sie kletterte runter zu mir, biss mir ins Ohr und inhalierte meinen Rauch. „Und? Wo liegt er?“ „Irgendwo dahinten“, sagte ich und schnippste Glut ins schwarze Dickicht. „Kann man jetzt nicht sehen. Zu dunkel.“ „Wie war das, den Alten zu killen? Geil, oder?“ „Will ich nicht drüber reden.“ “Komm. War geil, oder?“ „Ja, geil. War geil. Du bist geil. Lass uns zu dir gehen.“ „Geht nicht. Mein Alter...“
Der Herr Onkel hatte mir zum sechsten Geburtstag ein Sprengnetz geschenkt. „Ich nehm dich mit zum Frettieren“, sagte er, hielt mir die Maschen, in die ich mir einen Fußball gewünscht hätte, vor die Nase und lachte hustend. „Da wird uns das Ungeziefer nicht entkommen, Carl.“ Ich hatte mich im Dickicht verschanzt, traute mich nicht, die Ohren zuzuhalten. Wie hätte das ausgesehen? Ein Jägerkind, dem das Krepieren der Hasen zu viel war. Ich versuchte, mein Trommelfell zu ewegen, Druck zu verlagern, die Ohren innerlich zu verschließen, schaute knapp an meinem Onkel vorbei, wie er vor dem Bau lungerte und durch die Netzmaschen die zappelnden Tiere an den Ohren hielt. Zuhause war der Geburtstagstisch gedeckt. Folie lag über der Spanplatte in der Garage. Handschuhe und Messer, Skalpelle in Bechern, Flaschen mit Säuren. Der fleischige Hasenkörper umgekrempelt, wie eine alte Socke. Die Pfoten steckten noch im Fell. Die seien noch nichts für mich. Unter dem Tisch der Eimer. Der Eimer für die Innereien, an denen ich mich würde bedienen dürfen. Ich wollte verschwinden, aufgelöst sein. Ich wollte, dass er meinen richtigen Namen sagte. Ich wollte weinen, weg sein, wollte kotzen, die Unterhose gegen eine trockene tauschen, schreien. Versager. Wenigstens töten müsstest du doch können.
Sie kam mit zwei Freundinnen, küsste mich nicht, blieb außerhalb meiner Jacke, die Arme verschränkt mit forderndem Blick.
„Sag’s ihnen, J.C.! Sag ihnen, dass du den alten Wedekind umgelegt hast.“
„Hab ich.“
„Hast du nicht. Mein Alter und die anderen Bullen haben heute Morgen seine Leiche aus dem Wald gezogen. Kopfschuss.“
„Ja, war ich.“
„RAF oder was? Man Olga, der hat dich voll verarscht.“
Die Ellenbogen verschränkt gingen sie lachend weg, schauten sich nicht mehr um.
Halali, der Herr Onkel ist tot. Männer im Haus. Stiefelschritte. Stimmen. Suizid. Gewehrträger stehen Spalier. Dazwischen der helle Sarg aus Fichte. Das Jagdhorn wird geblasen. Es wird salutiert. Die Tante dahinter, wirft Sand, eine Rose. Und ich, ein Freigänger, weil der Wächter tot war. Er und ich, nicht länger verschwunden.
Katrin Theiner
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Philipp Böhm
Ruhende Kräfte
Bald, ja bald werde ich ein Flieger sein. Ein Junge braucht seine Ziele und Wünsche. An den Rändern unseres Gartens, wo die Verkrautung der Grundstücksgrenzen bereits weit fortgeschritten ist, proben wir für den Ernstfall und freuen uns bereits auf den nächsten Krieg. Mein Großvater sagte immer, die Zeichen seien damals klar gewesen. So sind sie auch jetzt, wir sind uns da sicher. Also liegen wir im Gras, wenn wir nicht gerade den Absprung üben, und blicken in den ungetrübten Himmel in der Hoffnung auf baldigen Bombenabwurf. Stets versichern wir uns aufs Neue, es könne sich nur noch um Tage, schlimmstenfalls Wochen handeln, ehe sie fallen. Doch der Sommer vergeht mit Hoffen und mit ihm unsere Euphorie. Für den Herbst wünschen wir uns keinen Krieg herbei. Nein, es muss der Sommer sein. So begrüßen wir die ersten fallenden Blätter mit Schweigen im Wissen um ein verlorenes Jahr.
Philipp Böhm
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? Sende ihn uns doch an mosaik@studlit.at
freiTEXT | Jonis Hartmann
Zangenabdruck am Ticket, Zahnabdruck am Hals
W. aus B. prüft die Fahrkarten im Zug. Heute Nacht hat ihn jemand geprüft. Man kann es sehen, wenn er sich über sein elektronisches Multitool mit Schulterriemen beugt. Bald wird er Nachtschichten fliegen, der W. aus B.
Jonis Hartmann
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? Sende ihn uns doch an mosaik@studlit.at
freiTEXT | Lina Mairinger
Ich bin die Sprache los
Ich habe meine Sprache verloren. All meine Worte, welche ich für normal pausenlos aus meiner Lunge quetsche, sind abgehauen, ohne Abschiedsworte, ohne große Reden. Es war ein sprachliches Ende, das ich eigentlich hätte vorhersehen können, denn nach wochenlangen algebraischen Rätseln, war annehmbar, dass meine sprachlich fähigere linke Gehirnhälfte, die nicht in Worte fassen konnte was ich an Zahlen zu verstehen versuchte und was ich bei den Zahlen überhaupt suchte, kapitulieren und sich aus dem Staub machen würde. Aber es ist gut, somit habe ich nämlich mehr Zeit dafür, ohne vorher lange Reden zu halten, auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass meine linke Gehirnhälfte nach Argentinien geflüchtet war und nun ein als, verschwiegen bekanntes Opossum, erfreut. Dieses Opossum begeistert womöglich nun mit meiner sprachlichen Gehirnhälfte, zahlreiche vor Erstaunen sprachlose Opossums, mit verwirrten Reden und konjugiert die Möglichkeitsformen von possum.
Vielleicht gründet das Opossum eine neue sprachliche Gattung. Nicht umsonst berichteten schon früh in der Antike Op-mer, Op-vid und Op-laton von dem kommenden Staatssystem der Op-olitiker, angeführt von Op-ama. Die Opossums wären auch bald viel beliebter als alle Menschen, denn während diese sich mit mathematischen Formeln definieren, gewinnen die Opossums mit wörtlichem argumentieren. Sie würden die Sprache revolutionieren, denn die tote Sprache Latein, würde neu fungieren. Mit O-possum als moderne Möglichleiten etwas zu können.
Menschliche Forscher ziehen sich wortlos in die Statistiken über Sterberaten von „an Worten erstickten Opossums „ zurück und hätten somit ein Hobby für ihre restliche Existenz. Inzwischen habe ich mich vermutlich einhirnig und verkrüppelt zurückgezogen. Denn der bessere, schwerere Teil meines Gehirns fehlte ja nun und ich gehe ich ja stets schief. Mit meinen neu erworbenen mathematischen Kenntnissen, kalkuliere ich vermutlich meinen beruflichen Erfolg als Bestattungsunternehmer für Opossums, denn das spannende, waren die vielen Scheintoten Opposums, die sich die Möglichkeiten des O-possum seins zunutze machen und ihren Tod vortäuschen um an ihr O-Pension ranzukommen.
Eines Tages wenn ich dann gerade kritisch ein scheintotes Opposum untersuchen würde, sehe ich vielleicht ein Opa-ossum, das die Straße entlang an mir vorbeispaziert, mich erkennt, mir und den vielen Mathematiknachprüfungen dankt, die ihnen das Wort in den Mund legten und sich dann unsicher wegen meiner bedeutungsschweren Existenz tot oder ‚nichttot‘ umfallen würde. Schweigend würde ich mich dann für mein restliches Leben wie Prometheus fühlen können, wenn nicht sogar besser, denn was ist schon das Leben verglichen mit der Sprache.
Ja, so wäre es wohl, wenn meine linke Gehirnhälfte nicht, nach langen mathematischen Foltermethoden, abgehauen und Ich nun für immer sprachlos wäre.
Lina Mairinger
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? Sende ihn uns doch an mosaik@studlit.at
freiTEXT | Marie Gamillscheg
Julian (Auszug)
Als der Bus nicht kam, ging Julian das kurze Wegstück den Berg hinauf zu Fuß. Der Boden war eisig und Julian rutschte in seinen glatten Lederschuhen immer wieder ein wenig ab. Wenn es in den nächsten Tagen weiterschneite, würde er festere Stiefel für den Weg nehmen und seine schönen Lederschuhe erst in der Schule anziehen, beschloss er. Als er die Tür aufschloss, rief er ein „Hallo“ in das leere Haus. Es roch nach Nivea-Creme und Staub. Erst als er durch das Wohnzimmer ging und die Tür zur Küche öffnete, hörte er, wie Pfannen und Töpfe geräumt wurden und Metall und Glas aufeinander klangen.
„Hallo.“ Julian holte sich ein Glas aus der Kommode, das seine Mitbewohnerin wohl gerade eingeräumt hatte. Die gelblichen Kästen und Ablagen der Küche waren schmierig. Julian hatte einmal versucht sie zu putzen, doch es hatte nicht geholfen. Als ob die ölige Schicht nicht mehr zu durchbrechen war.
„Ah, Julian.“ Seine Großmutter stand in der Speisekammer. Julian glaubte, dass sie oft aus Langweile einfach Lebensmittel und Küchengeräte von einem Ort an den anderen räumte. So lange sie nicht seine Kaffeemaschine anfasste, war ihm das egal. Sie trug heute einen dunkelblauen, langen Rock und eine grüne Wollweste über der weißen Bluse, die sie oft anhatte, wenn sie nicht außer Haus ging. Ihre dicken Füße steckten in schwarzen, festen Hauspantoffel, die klackerten, wenn sie über den Laminatboden in der Küche ging. Sie beobachtete Julian, wie er den Kochtopf mit Wasser auf die Herdplatte stellte, die Hitze auf die höchste Stufe drehte und Zwiebel und Knoblauch schnitt. Julian hasste das. Er war zu seiner Großmutter gezogen, weil er seine Wohnung nicht mit fremden Menschen teilen wollte und um allein zu sein, wenn er es wollte.
„Gehst du heute noch außer Haus?“ Er hatte auf diese Frage gewartet. Sie konnte nicht schlafen, wenn sie allein im Haus war. Er antwortete nicht und holte Tomaten aus dem Kühlschrank, die er langsam in kleine Stücke schnitt, den Saft ließ er vom Schneidbrett auf den Boden tropfen. Er wusste, dass es sie quälte, wenn er nichts sagte, aber vielleicht würde sie es sich dann abgewöhnen. Als Julian sich die dampfenden Nudeln aus dem Sieb auf einen Teller kippte und sich ins Esszimmer setzte, blieb sie in der Küche. Er hörte bald, wie Gläser aneinander stießen und er wusste, dass sie wieder Gläserstapel auseinander nahm um sie neu anzuordnen oder vielleicht um die kleineren auf die größeren zu setzen oder um einige davon erneut abzuwaschen.
Nachdem Julian sich geduscht und umgezogen hatte, zog er sich seine Stiefel an und nahm leise seinen Mantel von der Garderobe. Erst als er laut die Tür zuwarf, würde seine Großmutter merken, dass er gegangen war. Er lächelte noch immer, als er in den Bus stieg und sich die verzweifelten kleinen Schritte seiner Großmutter von der Küche in ihr Schlafzimmer vorstellte. Vielleicht würde sie seine Mutter anrufen und sich beschweren. Die Fensterscheiben im Bus waren beschlagen, trotzdem sah Julian nach draußen. Es schneite schon wieder. Wenn er nicht wiederkommen würde, würde sie einfach zwischen ihren Pfannen und Töpfen verrecken, dachte er. Er stellte sich vor, wie sie am Boden lag, um sie herum Gläser, Tassen und Teller, teilweise zerbrochen. Er würde sich hinknien und ihr die Augen schließen, wie er es aus den Filmen kannte, und ihre Haut wäre von einem Ölfilm belegt, wie ihre Pfannen.
Der Gedanke mit den Kindern kam ihm erst, als er die Schule betrat. Die Lehrerin, die eine prall gefüllte, abgegriffene Ledermappe unter dem Arm trug, schüttelte ihm die Hand und sagte: „Schön, dass auch heute noch junge, engagierte Männer in den Lehrberuf streben.“ Julian nickte und folgte ihr in die Klasse, zwanzig Kinder starrten ihn an. Er stellte sich kurz vor und sagte, dass er in der letzten Reihe sitzen würde, um den Unterricht zu beobachten. „Hospitanz, Pflichtseminar von der Uni“, fügte er hinzu. Er faltete seine Hände vor seinem Körper, er hätte auch gern eine Ledermappe in der Hand. Den Schülern war keine Reaktion anzusehen, sie hingen in ihren Stühlen und auf den Tischen, als ob die Pubertät ihnen zu viel Kraft rauben würde. Die Mädchen wussten, wie sie ihre jungen Körper, die sich gerade zu formen beginnen, am besten in enge T-Shirts zwängten und deren Ausschnitt so ausdehnten, dass der erste BH darunter zu sehen war. Die Jungs wirkten daneben jung, in ihren zu großen Pullovern, in die sie noch hineinwachsen mussten. Julian war erschöpft, als er sich hinten in die letzte Reihe setzte. Er war froh, dass er nicht selbst unterrichten musste. Von hinten waren es weniger Augen und weniger Aufmerksamkeit, Julian entspannte sich wieder. Die Lehrerin referierte über den Präpositionsgebrauch im Englischen, doch Julian konnte sich nicht konzentrieren. Er beobachtete, wie vor dem Fenster die kargen Bäume im Schneewind zitterten und drinnen, obwohl es vorgab eine andere Welt zu sein, in den Tischreihen die Mädchen sich scheinbar im selben Takt bewegten, wie sie ihre schmalen Rücken in die Höhe streckten oder sich gen die Tische beugten.
Der Rauch verflüchtigte sich schnell im hohen Raum, als ob er sich vor der Großmutter einen Stock darunter verstecken müsste. Julian machte seine Lippen schmal und versuchte Ringe auszustoßen, aber auch diese behielten nur kurz ihre Form. Der Raum war hell und trocken vom Morgenlicht. Julian fühlte sich ein bisschen wie die blonde, schöne Frau in weißer Unterwäsche in diesem Schwarz-Weiß-Film, die sich im Bett räkelte und rauchte. Vielleicht war es Brigitte Bardot, Julian wusste es nicht. Selten hatte er etwas ähnlich Ästhetisches gesehen wie diese Frau. Als er den Film vor Jahren zum ersten Mal gesehen hatte, hatte er mehrmals wieder zurückgespult, um sie wieder zu sehen; wie sie sich im Bett zur Seite drehte, sich aufrichtete und wieder zurück fallen ließ, wie sie sprach, dunkel, rauchig säuselte sie ihre Worte, das Bett groß, weiß, um sich darin zu verlieren – mit ihr. Vielleicht hatte er wegen ihr zu rauchen begonnen, überlegte er sich, und nicht nur, um sein Spießertum zu verstecken. Er griff unter der Decke neben sich und fasste auf einen nackten, behaarten Oberschenkel. Sebastian schlief immer so lang. Seine Großmutter würde bemerken, wenn er das Haus verließ und Julian müsste wieder sagen, dass er auf der Couch übernachtet hatte, weil er zu viel getrunken hätte, um noch Auto zu fahren. Julian drückte die Zigarette im Aschenbecher am Nachtisch aus und stieg vorsichtig aus dem Bett. Er öffnete die großen Flügeltüren, auch hier weiße Vorhänge, und trat nach draußen auf den Balkon. Er blickte über die Terrasse bis zur Innenstadt, wo sich die roten Dächer aneinanderdrängten, obwohl es rundherum noch genug Platz gäbe. Julian wollte schon immer auf einer Anhöhe wohnen; er hatte die Ebene der Vorstadt satt.
Es hatte geschneit über Nacht. Die zwei hohen Fichten trugen so schwer, dass sich die Äste zu Boden neigten, die Naturgeräusche klangen gedämpft, wie eingehüllt vom Schnee. Seine Großmutter würde ihm sofort sagen, dass er den Schnee aus der Einfahrt räumen müsste, wenn sie ihn sah. Julian trat wieder nach drinnen. Unter der Decke war es warm, Julian drängte seine kalten Beine gegen Sebastians. Langsam öffnete er seine Augen und gähnte, er rieb sich die von der Nacht zugequollenen Augen, um sie wieder in ihre natürliche Form zurückzudrängen. Er schmeckte nach ungeputzten Zähnen, als er Julian küsste. „Guten Morgen“, sagte Julian. „gut geschlafen?“
Sebastian nickte und drückte sich noch tiefer in den weißen Polster.
„Wann hast du Uni heute?“
Marie Gamillscheg
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? Sende ihn uns doch an mosaik@studlit.at
freiTEXT | Christine Gnahn
Der Schwan und der Geier
Ihr Lachen ist so sanft wie das Plätschern eines Gebirgsbaches. Und ich fühle mich wie die Fliege, die langsam im zarten Plätschern ertrinkt, qualvoll erstickt. Ich kann nämlich fliegen, wenn sie nicht da ist. Es gibt dann nichts, das leichter ist als ich. Das schönste Lachen, das glücklichste Strahlen und das hübscheste Mädchen weit und breit, das bin dann ich. Obgleich das arrogant klingen mag, ist es als solches nicht zu verstehen. Denn ich bin ein Mädchen wie jedes andere, verstehen Sie das nicht falsch. Aber in seiner Nähe bin ich eine Elfe. Dann habe ich Flügel, die in der Sonne glitzern und Zähne wie weiße Perlen aus dem indischen Ozean (obgleich ich tatsächlich nicht weiß, wie Perlen aus diesem Gewässer aussehen) und dann bin ich so schwebend frei und leicht wie eine Feder. Ich dufte nach süßen Früchten und ich schmecke wie ein exotisch-köstliches Gewürz. Er verzaubert mich immer wieder zu dem schönsten Kind unter der Sonne.
Doch jetzt ist sie da und jetzt hat sie das Perlenlachen. Selbstverständlich trägt sie in sich das sanfte Plätschern ihrer Stimme und die sanfte Anmut ihres weiblichen Körpers. Sie hat ein bisschen zugenommen, doch das stört hier wirklich niemanden. Vielmehr scheint es ihre unaufdringlich reizende Art, in die Welt ihre liebevolle Botschaft noch ein bisschen mehr hinauszutragen. Zu beweisen, welch Schönheit Frau und Mädchen in weicher Silhouette in sich tragen. Soviel greifbarer und lieblicher, als ich es je zu sein vermag. Freilich nicht arrogant, da sich das mit ihrer Alabaster-Unschuld und ihrem porentief reinen Gewissen ja so sehr beißen würde, dass am Ende Engels Harfe ein Mordwerkzeug wäre.
Mein Gewissen ist nicht rein und ich muss schuldhaft und mit stiller Wut bekennen, ich besitze nicht einmal eine Harfe. Ein Beil trage ich, man sieht es mir an, man linst zu mir herüber mit skeptischem Blicke, misstraut mir aus tiefstem Herzen. So geht es einem, wenn man ein Beil in den Augen trägt und jederzeit drauf und dran scheint, es in grausamer Gewalt zu benützen. Zu hacken in Blut und Fleisch und zu brüllen, zu schreien, in der Anmut eines brunftigen Stiers.
Doch ich tue nichts und ich spreche auch nicht. Kein Wort kommt aus meiner heiseren Kehle. Die Stimme würde gewiss nicht plätschern, denke ich in finsterer Ironie. Sie würde würgen, kratzen, raunen, klänge wie ein schräger und gieriger Geier. Ja, ein Geier, der bin ich, wie ich sie mit Blicken umkreise und wie eine Elster will ich es ihr stehlen, das Gold auf ihrer Seele.
Oh ja, sie würde es mir schenken, wenn ich sie darum bäte. Und dann müsste ich sie leider blutrünstig ermorden.
Sie ist der Schwan, ich der Geier.
Ich umkreise sie, bis ich schreiend davon laufe.
Weine.
Wertloses Stück Dreck, in einem letzten Verzweiflungsakt. Auf heischender Suche nach Aufmerksamkeit der Menge. Die wiederum leider ganz verliebt in sie ist, diesem göttlich Geschöpf.
Wenn ich auf dem Berg bin, kann ich wieder atmen.
Dann beginne ich zu verstehen.
Dass keiner von uns fliegen kann.
Christine Gnahn
freiTEXT ist eine Reihe literarischer Texte. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? Sende ihn uns doch an mosaik@studlit.at
freiTEXT Spezial | Texte der Arbeit
Zusammenarbeit
Hiaz?
Na!
.
.
Hiaz?
Na, no ned!
.
.
.
Hiaz?
Z’spot!
Gerhard Steinlechner
freiTEXTe der Arbeit zum Tag der Arbeit. Eine offene Zusammenstellung von Autorinnen und Autoren des mosaik. Read more