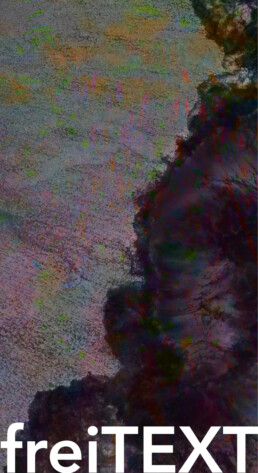freiTEXT | Tom Scheinpflug
Ram on
Es wird ein Samstag gewesen sein, denn jeden Samstag saßen Al und ich im Keller vom Ship&Mitre, um uns unter anderen Gescheiterten zu betrinken, bis das Zittern der zum Schaffen geschafften Hände endlich nachließ. Nicht dass Al und ich uns dafür verabredet hätten. Wir kannten uns vor jenem Abend nicht und für mich war er bisher eher Teil des schnapsfleckigen, nach vergälltem Leben stinkenden Interieurs der Kellerkneipe als deren Kundschaft. Zu jener Zeit verbrachte ich meine nüchternen Stunden damit, tagsüber in einem Lebensmittelgeschäft in der Warwick Street auszuhelfen, um abends das verdiente Geld an abgewetzten Roulettetischen mit bösartiger Gleichgültigkeit an die Bank zu verschenken. Diese Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber war mir seit jeher ein treuer Begleiter, ein Schatten neben mir. Ich ließ mich lieber treiben und nahm hin, was kam. Wahrscheinlich fiel es mir deshalb so leicht, mich seit ungezählten Jahren in einem anhaltenden Rauschzustand zu ertränken, ohne je Schuld darüber zu empfinden. Diese Abende waren nun mal alles, was blieb.
An einem dieser Abende trieb es mich zu Al, hier scherzhaft als „Uncle Albert“ bekannt, dessen zweifelhafter und doch liebevoll-nachsichtiger Ruf in jener Kneipe mir bereits vor unserem ersten und einzigen Wortwechsel sein tägliches Kommen und Bleiben versicherte. Er war ein wirrer und unsteter Mensch, der früher als Mittelklasseboxer seine Alkoholexzesse in Löchern wie diesem finanzierte, den die erfolglosen Jahre aber zahm und stumpf haben werden lassen, sodass ihm von seinem ohnehin schon bescheidenen Lokalruhm nur eine mickrige monatliche Versehrten-Abfindung des Kensington Boxing Clubs und eine scharf nach rechts zerschlagene, weinrote Rosazea geblieben waren.
Ich erinnere mich noch an das staubige Licht im Keller, das seine grobschlächtige Rechte matt schimmern ließ, während sich die massige Faust um ein schäumendes Pint schloss. Ich hatte soeben eine schon nicht mehr verschmerzbare Menge Pfund verloren, war allerdings bereits zu betrunken, um mir über mein Unglück ernsthafte Sorgen zu machen. Mein selig schwimmender Blick verlor sich im goldenen Brausen eines heimischen Ozeans und ich hätte nicht sagen können, wie lange ich so dasaß: den müden, verbrauchten Körper mühsam auf einem Hocker haltend, von den weniger besorgten als sichtlich angewiderten Mienen der Mitspielenden unberührt und den eigenen Blick rettungslos ertrunken im gewürgten Bierglas von „Uncle Albert“.
An diesem Abend stürmte es heftig. Ein grausamer Windzug jagte über die kahle Rundung meines Hinterkopfes und ließ mich aus dem Bann aufschrecken, nachdem er ein Kellerfenster samt Rahmung aus der Fassung gesprengt hatte und den düsteren Raum durchflutete. Als ich meinen Blick löste und aufschaute, bemerkte ich, dass Al diesen erwiderte. Er blickte mit seinen zusammengerückten Säuferaugen streng in mein Gesicht, als prüfe er mich. Worauf wusste ich nicht. Die geblähten, mit den rötlichen Pusteln vergangener Leben befleckten Wangen rahmten seinen Blick und gaben ihm, trotz des unübersehbaren Verfalls seiner Züge, das würdige Aussehen einer antiken Anemoi-Darstellung. Gerade als ich spürte, wie mich die Kraft verließ, seinem Richterblick standzuhalten, hob er schwerfällig seine Linke und winkte mich mit einer abfälligen Bewegung zu sich. Ohne zu wissen warum, erhob ich mich und trottete langsam, aber entschieden auf den Tisch in der dunklen Ecke des Raumes zu.
„Du bist hier öfter, als dir guttut“, sprach der alte Al, als ich stumm Platz genommen hatte. Seine Stimme hatte eine raue Klangfarbe, aber seine Worte klangen nicht wertend oder gar beschämend: es waren von zwischenmenschlichen Banden vollkommen losgelöste Worte, ohne Anklage oder Mitgefühl, gefühllose Tatsachen, steinern und unbeweglich wie prähistorische Monolithen. Ich hatte das Gefühl der Wind, dem der Kneipenbesitzer trotz wütend gebellten Befehlen nicht Herr zu werden schien, spielte nun eine fürchterliche Kantate. „Wo sollte ich sonst sein?“, gab ich mit verwaschener Stimme zurück, die Augen wagte ich nicht vom vernarbten Tisch zu heben. „Da draußen natürlich“, sprachs aus der Ecke und ich hatte das Gefühl die denkbar schlechteste Antwort gegeben zu haben. Die schlichte Bestimmtheit seiner Rede irritierte und erregte mich. „Heutzutage weht ein anderer Wind. Nie zuvor war es so leicht abzusaufen“, setzte er nach. Ich nickte stumm, doch verstand nicht, was er meinte. Mir fiel auf, dass er mich beim Sprechen nicht anschaute. Auch sein Blick kämpfte nun einen hoffnungslosen Kampf am Grund seines Glases. Eine Weile verharrte er in dieser Stellung, ohne meine Verwirrung zu lösen. Dann hob er erneut an:
„Dort draußen gibt es stählerne Inseln, in denen Männer wie du und ich noch einen Wert haben. Den Wert eines Zahnrädchens in einem Getriebe, zugegeben, aber ein Wert doch!“ beschwor er, plötzlich stürmisch aufbrausend, wobei er mir feine Tropfen wie Nieselregen entgegenspuckte. „Familienbande eingeschworener Schatzjäger im Kampf gegen die Gezeiten und auf der Suche nach dem schwarzen Gold. Ein lohnendes Geschäft für manche Tagelöhner. Aber für Männer wie uns …“, er pausierte, versuchte den versprengten Atem in tiefen Zügen wieder einzusaugen, „für Männer wie uns, können diese Inseln weitaus mehr sein.“ In atemloser Spannung wartete ich. Worauf, wusste ich nicht. „Hände über dem Wasser, Köpfe über dem Horizont.“, hauchte er endlich und mir war, als hätte er uns beide damit erlöst. Ich erhob mich und wankte schwerfällig, aber bestimmt zur Kellertreppe.
Sturzbetrunken stolperte ich aus der schweren Vordertüre hinaus auf die menschenleere Gasse. Noch bevor sie wieder zufiel, hatte der Wind, der außerhalb des Kellers kreischend durch die schiefen Häuserschluchten fegte, bereits alle Geräusche aus dem Innern verschluckt. In meinen Ohren pfiff es unangenehm und ich spürte den Drang, wieder hineingehen zu wollen – nur raus aus diesem Wind. Nur wusste ich, dass das nun nicht mehr möglich war. Nie wieder würde ich das Ship&Mitre betreten. Ich zog den Kragen meines zerschlissenen Regenmantels bis an die Schläfen hoch und ließ mich einem unbestimmten Ziel entgegentreiben.
Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wie lange ich durch die winddurchflutete Nacht irrte. Es müssen wohl mehrere Stunden gewesen sein, denn als ich, noch taumelnd und von schieferschwarzen Möwen mit geteertem Gefieder träumend, zu mir kam, stand ich an den Docks, auf dem St. Nicholas Place. Schwer atmend starrte ich in das graue Treiben des Hafenbeckens hinein und dachte an „Uncle Albert“. Seine letzten Worte waren unauslöschlich in meine trunkene Seele eingebrannt.
Da spürte ich es: Der Wind, der, seit ich mich meines Bewusstseins wieder ermächtigt hatte, unbarmherzig vom Nordatlantik her blies, musste sich gedreht haben, denn ich spürte, wie er sich nun an meinem gekrümmten Rücken brach und über meine durchnässten und heftig zitternden Schultern hinweg aufs offene Meer flüchtete. Unwillkürlich hob ich den Blick und erkannte weit über mir auf dem Dach des Royal Liver Buildings, dem stürmischen Tosen in heroischer Haltung trotzend, die bronzenen Schwingen von sich streckend den Stadtpatron, dessen gebieterischer Blick dem Wind aufs Meer hinaus folgte. „Hände über dem Wasser, Köpfe über dem Horizont“, hörte ich es aus einer dunklen Ecke meines Bewusstseins sprechen und wusste doch – diese Stimme gehörte mir.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Lukas Leinweber
Kleine Vergehen
1.
Als unbescholtener Staatsbürger stehe ich viel zu selten in Kontakt mit der Polizei unseres Landes, wie mir an diesem Morgen an der Kreuzung in der Innenstadt auffällt. Die Ampel ist rot, aus der Seitenstraße biegen ein Haufen Autos, von der Autobahn kommend, in den Weg ein, der vor mir liegt. Ich sehe im Rückspiegel den herannahenden Transporter mit der unverkennbaren blau-silbernen Musterung. Langsam hält er auf die Kreuzung zu und lässt die letzten Meter ausrollen. Ich gucke weiter in den Rückspiegel, sehe, dass die Farbe Rot immer noch aus der Ampelanlage mahnt und fasse mir ein Herz. Wenn ich jetzt voll beschleunige und über die Kreuzung rase, dann sind sie alarmiert, das können sie nicht durchgehen lassen, sie werden, ja sie müssen mich dann verfolgen. Ich kenne mich in diesem Teil der Stadt nicht aus. Überall haben sie ein Dreißiger-Tempolimit festgelegt, wegen des Lärms, wie sie sagen. Wenn die Verkehrsbehörde der Stadt „Klimaschutz“ auf das Schild unterhalb des Dreißiger-Symbols geschrieben hätte, erschiene mir das einleuchtender. Im Augenblick pfeife ich auf Geschwindigkeitseinschränkungen. Es wird eine wilde Verfolgungsjagd werden, aber ich weiß nicht, ob ich in dieser Ausnahmesituation in der Lage sein werde, die Kontrolle über den Wagen zu behalten. Doch sind das Fragen, die ich auch während des Fahrens beantworten kann. Ich lege den Gang ein, die Start-Stopp-Funktion aktiviert den Motor, ich gebe mit durchgedrücktem Pedal kräftig Gas, denke an die beschleunigenden Spurts in den „Fast and the Furious“-Filmen, schalte schnell in den zweiten, dann in den dritten Gang, wo mein lachhaft PS-schwacher Skoda am besten anzieht und rase über die Kreuzung, direkt den anderen Autos hinterher. Das Lenkrad halte ich steif und fest umklammert, ich bohre, soweit das mit gestern schief geschnittenen Nägeln möglich ist, meine Finger regelrecht in das Leder und blicke dabei mit drastisch erhöhtem Adrenalinspiegel in den Rückspiegel, zur Vergewisserung auch noch in die beiden Seitenspiegel, die ungenügend auf meine Sitzposition eingestellt sind. Aber hinter mir tut sich nichts. Außer mir fährt keiner an. Die Autos stehen vorbildlich in Reih und Glied. Sie warten ordnungsgemäß auf das grüne Signal, selbst ohne Blitzer. Was folgt, ist kein Hupen, kein Blaulicht, erst recht keine Sirene. Der Transporter steht weiterhin hinter der Haltelinie und macht keine Anstalten, mir zu folgen. Betrübt schließe ich zu den vor mir fahrenden PKWs auf und bringe den Wagen auf dreißig Sachen.
2.
Ich laufe am Abend durch eine gering frequentierte Fußgängerpassage und wundere mich, dass mich ein weißer SUV, vermutlich ein G-Klasse-Mercedes, viel zu knapp mit überhöhter Geschwindigkeit überholen darf. Die Passage ist doch frei, ich laufe extra am Rand bei den Geschäften, damit die Radfahrer, die dem Namen nach hier ebenfalls nichts verloren haben, mit viel Platz durchfahren können. Wieso also fährt er so dicht an dem einzigen Fußgänger weit und breit vorbei? Will er der dunkelgrauen Drohung des Himmels davonfahren? Der einzige, der einen nachvollziehbaren Grund zur Beeilung hätte, weil er schnellstens nach Hause kommen will, um dem angekündigten Gewitter zu entgehen, bin ich. In diesem monströsen Gefährt sitzt man dank Herrn Faraday sicher vor Regen, Donner und Blitz. Der Wagen braust vorbei und hält ruckartig etwa sechzig Meter vor mir auf derselben Seite an. Zum Glück ist hier nichts feucht, sonst wäre ich garantiert vollgespritzt worden. Der Fahrer, ein übergewichtiger, glatzköpfiger Mann mit hellblauem Jackett, das durch seinen mediterranen Teint besonders gut zur Geltung kommt – es steht ihm ehrlich gesagt ausgezeichnet – steigt für seine Körpermasse flink aus dem Auto und hastet zu einem Eingang. Er schließt auf und verschwindet hinter den Wänden zu meiner Rechten. Die Fahrertür steht weit offen und ragt in die Mitte des gepflasterten Wegs hinein. Ich höre beim Näherkommen, dass der Motor noch läuft. Früher ein Anlass für mich, die Leute anzusprechen und sie zu fragen, warum sie den Motor laufen lassen. Ausreden, in denen sie bekräftigen, sie wollten nur eben schnell dieses oder jenes tun, ließ ich nie gelten. Man kann den Motor immer abschalten. Aber heute reagiere ich entspannter, ich bin es müde, die Menschen auf leicht zu umgehende Versäumnisse hinzuweisen. Da kommt mir ein vergnüglicher Gedanke: Ich könnte einfach in den Wagen steigen und losfahren, wenn der Mann den Zündschlüssel hat stecken lassen und davon gehe ich aus. Ich würde mit diesem benzinschluckenden Straßenpanzer losbrettern und ungehemmt durch die Stadt rasen. Muss ein geiles Gefühl sein, sich ohne schlechtes Gewissen rücksichtlos zu verhalten. Ich habe den schicken Wagen fast erreicht, bin voller Tatendrang und Entschlossenheit, wirklich einzusteigen und loszufahren, noch dazu wo ich sehe, dass es sich bei dem Laden, in dem der Mann verschwand, um ein Juweliergeschäft handelt. Meine rechte Hand hat bereits die schwarze B-Säule fest umgriffen, damit ich mich mit einem kurzen Schwung auf den Fahrersitz befördern kann. In letzter Sekunde, obwohl mein rechter Fuß bereits auf dem Einstieg steht, breche ich mein Vorhaben abrupt ab. Auf dem Beifahrersitz sitzt eine herrisch wirkende alte Dame in teuren Markenklamotten. Trotz Sonnenbrille blickt sie angewidert auf ihre Armbanduhr und direkt darauf in Richtung Ladentür. Sie hat mich bislang nicht bemerkt, obwohl ich sie anstarre und fast eingestiegen wäre. Mit dieser angsteinflößenden Vogelscheuche möchte ich meinen Lebensabend nicht verbringen – auch nicht in einer protzigen G-Klasse. Ich nehme meine Hand von der B-Säule, setze zügig den Fuß auf den Boden, drehe mich unauffällig um neunzig Grad nach links, weiche der hervorstehenden Autotür aus und laufe weiter. Im Weitergehen höre ich eine krächzende, diabolische Stimme zetern: „Was hat denn da so lange gedauert? Es könnte jemand einsteigen und losfahren, weil du immer den Schlüssel stecken lässt. Dabei bin ich völlig wehrlos und jeder sieht es.“ Ich laufe triumphierend weiter.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Olav Amende
Spiegel
Stimme 1, Stimme 2, STIMME 1 & 2
I
Man sagt, es gibt im Leben eines Menschen immer wieder Momente, in denen ist der Mensch mit sich allein. / Und gleich, wie vielen anderen Menschen man nahe steht, / von wie vielen anderen Menschen man geliebt wird, / und wie viele andere Menschen man selbst zu lieben imstande ist, man ist, / so heißt es, / in diesen Momenten / ganz allein. //
Wir kennen diese Momente nicht. / Wir sind nie allein. / Wir haben uns. / Wir kennen uns / und spüren uns / so gut, wie keine zwei anderen Menschen / sich kennen / und spüren. / Mehr noch: / Wir kennen und spüren uns so gut / und intensiv, / wie kein einzelner Mensch / sich selbst spüren und kennen könnte. / Wir sind äußerlich und innerlich einander identisch! / Eins! / Wir benötigen keinen Spiegel. / WIR SIND DER SPIEGEL DES ANDEREN. //
Man nennt Zwillinge zwei Geschwister, / auf die Sekunde zur selben Zeit geboren, / die sich ähnlich oder aber, / – man nennt sie dann eineiig – / auf das Haar gleich sehen. / Wir sehen uns auf das Haar gleich. / Mehr noch: / Im Schnee hinterlassen wir dieselben Spuren. / Unsere Fingerabdrücke sind dieselben. / Unsere Iris ist dieselbe. / Und nähme man von uns DNA-Proben, / so geriete man in Bedrängnis: / WER IST WER? //
Betrachten wir uns das Wesen eines Menschen: / Wie tickt er? / Wie blickt er auf die Welt? / Was ist es, das ihm an ihr gefällt? / Und was nicht? / Was spricht aus seinem Gesicht, wenn er spricht? / Worin übt er sich in Verzicht, indem er spricht? / Und worin nicht? / Wie verhält sich sein Körper beim Laufen? / Wie beim Einkaufen? / Wie beim Erklettern / einer Eibe? / Wie beim Zerschmettern / einer Scheibe? / Wir dürfen sagen, in all diesen Momenten verhalten wir uns gleich, / spiegelbildlich, / identisch! / Ich weiß / und spüre, / wann sie den kleinen Finger ihrer / linken Hand / hebt. / Dann hebe ich ihn / und dann senke ich ihn. / Ich weiß / und spüre, / wann sie die Gabel / mit roten Linsen / zu ihrem Mund führt. / Dann führe ich die Gabel zum Mund. / Die Anzahl der roten Linsen, die sie auf ihrer Gabel transportiert, / entspricht / EXAKT / der Anzahl roter Linsen, die ich auf meiner Gabel / – unserer Gabel! – / transportiere. / Und wenn sie dann zur Toilette eilt, / eile auch ich zur Toilette. //
Es gibt Vieles, das darf die Außenwelt nicht wissen. / Nicht einmal unsere Eltern, / die wir sehr lieben, / dürfen das wissen. / Für diese vielen Momente haben wir uns eine Sprache ausgedacht, / die außer uns kein dritter / – kein zweiter! – / versteht. Das Prinzip ist simpel: / Wir nehmen uns einen Satz zur Hand, / picken uns dessen Vokale heraus / und sprechen allein mit diesen. / „e i e e i e o“ heißt: / „Dem Himmel erfriert der Mond.“ / Und „e i e e i e o“ heißt: / „Der Giebel brennt lichterloh.“ / Manches Mal / – in gewissen Situationen, in denen es gilt, nicht aufzufallen – / ist uns nach einer anderen Sprache zumute. / Auch ihr Prinzip ist simpel. / Wir nehmen uns einen Satz zur Hand, / picken uns dessen Vokale heraus und / formen mit diesen einen neuen Satz; / einen Satz jedoch, den wir nicht meinen. Wir sagen: / „Auf der Spitze des Berges ist’s nie still“, doch wir meinen: / „Trau‘ den finsteren Wegen in dir nicht!“ / Und wir sagen: „Fehlgeburt“, / doch wir meinen: „Engelsturz“, / doch wir meinen: „Erwähl‘ uns!“ / doch wir meinen: „Herr, trenn‘ uns!“!
II
Keiner versteht diese beiden Sprachen außer uns. / Das führt uns näher zusammen. / Und es schließt uns nach außen ab. / Uns erreicht keiner. / Und wir erreichen keinen. / „Ihr seid zu langsam“, / sagen sie. / „Gehen wir mit euch aus, so schafft ihr in derselben Zeit gerade einmal die Hälfte unserer Strecke“, / sagen sie. Und es ist exakt die Hälfte ihrer Strecke, die wir zurücklegen, nachdem wir gemeinsam starteten. / „Wenn wir mit euch gemeinsam am Tisch sitzen / und essen, / so habt ihr nur die Hälfte gegessen, / während wir schon fertig sind“, / sagen sie und meinen exakt die Hälfte. / „Und wenn wir mit euch Volleyball spielen, / so heben und senken sich eure Arme mit der Hälfte der Geschwindigkeit, mit der unsere Arme sich heben und senken.“ / „Ihr verfehlt alle Bälle!“, sagen sie. / „Und wer will da noch mit euch spielen?“, fragen sie. / Was sie nicht sehen: Unsere Arme heben und senken sich auf exakt dieselbe Weise! / Und wenn man unsere Geschwindigkeiten miteinander addiert, / so ergibt dies doch ihre Geschwindigkeit! / Seht ihr nicht: Wir zu zweit bilden eine Person! / Ich bin ihre Hälfte. / Und ich bin ihre Hälfte. //
WIR SIND DER KERKER DES ANDEREN … / Sie kann von mir gehen. / Und doch bekommt sie zu spüren, / was ich tue. Sie ist mir dann / ein amputiertes Bein, / das man spürt, / obwohl es einem abgenommen ist. / Gleich auch, was ich tue, / es berührt immer mich, / immer mich … / uns! / Wenn ich dich sehe, / sehe ich mich. Und wenn ich mich sehe, / sehe ich dich. / Immer nur dich! / Immer nur dich! / Ich sehe mich, / doch ich sehe mich. //
Wir wollten keinen Spiegel mehr. / Wir stellten ihn in die Ecke und schlossen den Raum ab. / Ich sperrte sie ein. / Und ich sperrte sie ein. / Doch es nützte nichts. / Wir bewaffneten uns mit Nägeln / und mit Steinen, / den Spiegel des anderen / einzuschmeißen. / Es schmerzte sehr. / Doch es brachte uns nichts. Was mich schmerzte, / schmerzte mich. / Verwundete ich mein Gesicht, / so verwundete ich mein Gesicht. / Ich schrie sie an! Ich schrie: / „Es gibt kein du!“ / „Es gibt nur mich!“ / „ES GIBT NUR ICH!“ //
Wir wollten uns einander behaupten: / Wer gibt zuerst nach, wer / ist die erste, die die Gabel / zum Mund führt, wer / ist die zweite, die / beim großen Volleyballturnier / die Arme hebt und senkt und wer / ist die erste, die / sich verlieben würde / IN EINEN ANDEREN MENSCHEN!
III
Wir mussten uns voneinander unterscheiden. / Wir mussten es versuchen. / Mit aller Kraft und Gewalt! / Mit der Liebe für dich! / Mit der Liebe für dich! / FÜR UNS! / FÜR MICH! / Wir begannen so: / Wie gewöhnlich gingen wir miteinander aus. / Wir trugen malvenfarbig / geblümte weiße Kleider und silbrige / Neun-Loch-Chucks. / Und nun gingen wir die Straße entlang und eine von uns beiden / blieb plötzlich stehen! / Und sie bückte sich! / Sie bückte sich, um etwas aufzuheben. / Einen Mantelknopf / oder ein dreibeiniges Plastiknashorn. / Während die andere nicht stehen blieb / und sich nicht bückte, / sondern weiterging, / einfach weiterging, bis auch sie dann, / einen Meter / oder zwei von ihrem Zwilling, / MEINEM ZWILLING!, / entfernt ebenfalls stehen blieb / und zu ihrem gebückten Zwilling blickte. //
Anderentags / unterhielten wir uns miteinander in der Öffentlichkeit / in eurer Sprache und widersprachen dabei einander. / Wir sagten immer exakt das Gegenteil des anderen. Wenn sie „Ja!“ sagte, / sagte ich „Nein!“. Sagte ich / „Schwarz!“, / sagte ich „Weiß!“ und so fort. / Wir sahen ein: / Mit dem Gegenteil auf den Satz des Gegenübers zu reagieren, / führt zu keiner Trennung. / Im Gegenteil: / Es bindet uns nur noch fester / aneinander. //
WIR MUSSTEN GETRENNTE WEGE GEHEN. / Also vertratest du dir die Beine im Garten / und du wandeltest mit einem Eis in der Hand in den Passagen. / Wir trugen schwarze Kurzblazer / und bronzefarbene Hosen. / Beide gingen wir barfuß. / Doch sie war / hier und ich / war hier. / Das erste Mal in unser beider Leben / konnten wir uns nicht sehen. / Doch auch ihr konntet uns nicht sehen, / DAS HEISST, / ihr habt uns gesehen – / mich und / mich – aber ihr saht in uns keine Zwillinge mehr! //
„Hat sie nicht auch eine Schwester?“, / fragten sie sich, als sie / dich in der Passage trafen. / Und als sie dich dann im Garten erblickten, / fragten sie sich: / „Wie mag es ihr wohl gehen, sie, / die ganz ohne einen Bruder / und ohne eine Schwester / auszukommen hat?“
IV
Ist dieser Stich zu verwinden? / Zerreißt allein der Gedanke daran dir nicht, / mir nicht, / die Stirn? / Die Brust? / Das Herz? / Das Herz? / Der Schmerz, der dich sticht, sticht mich doppelt. / Er sticht dich und damit sticht er mich. / Und damit sticht er mich. / Er sticht mich vierfach, / achtfach, / unendliche Male. / Denn voneinander getrennt sind wir Hälften einer Kugel, / die sich vierteln, / achteln, / zu nichts auflösen. //
Ihr lebt euer Leben auf der Suche nach eurer Hälfte. / Ihr findet sie oder ihr findet sie nicht. / Wir aber wurden im Angesicht unserer Hälfte geboren. / Und noch bevor wir auf die Welt kamen, blickten wir in unseren Spiegel. / Wir wussten / und wir spürten / unseren Puls in unserem Gegenüber schlagen. / Und wir wussten / und wir spürten: / Wir werden in zwei Körpern leben / als ein Mensch. / Wer könnte uns da noch trennen! / Zwischen diese beiden Körper passt kein Lufthauch. / Und zögen auch zwei Reiterarmeen an unser beider Enden, / sie müssten sich an uns verschwenden. //
i au o, ee! / e iu, aiu u! / i au! / aiu, iu! / E E U. / E E U.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Poedu - Text des Monats September
Wenn ich abends in mein Zimmer geh, schaut die Nacht durchs Fenster rein
und ich fühle mich ganz klein.
Komm ich ich morgens wieder raus,
bin ich groß und stark und der Tag klatscht mir Applaus.
Ari
(9 Jahre alt)
POEDU | Poesie von Kindern für Kinder. Monatlich gibt ein*e Autor*in online einen poetischen Anstoß.
.
Die Aufgabe kam diesmal von Gerrit Wustmann:
Eine bei den klassischen arabischen und persischen Dichtern beliebte Gedichtform war das Rubaiyat, zu Deutsch „Vierzeiler“ - Gedichte, die immer vier Zeilen haben und sich reimen. Es gibt zwei Versionen: In der berühmtesten reimen sich jeweils die ersten beiden und die letzte Zeile; es ist aber auch in Ordnung, wenn alle vier Zeilen denselben Reim haben. Hier ein Beispiel des berühmten persischen Dichters Omar Khayyam, der von 1048 bis 1131 in Persien (dem heutigen Iran) lebte:
Kein Mensch erklärt die Rätsel der Natur
Kein Mensch setzt einen Schritt nur aus der Spur
Die seine Wesensart ihm vorschrieb, und es bleibt
Der größte Meister doch ein Lehrling nur.
Schreibe einen solchen Vierzeiler! Das Thema kannst du dir selbst aussuchen, aber es wäre schön, wenn die Natur darin vorkommt, denn sie spielt auch in der klassischen persischen Lyrik eine wichtige Rolle. Zum Beispiel stehen die Rose und die Nachtigall oft für zwei Verliebte.
>> Alle POEDU Texte des Monats
>> DAS POEDU – Virtuelle Poesiewerkstatt für Kinder
.
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Advent-mosaik 2017
24 Tage | 24 Türchen | 24 AutorInnen | 24 mal Literatur.
Dein perfekter Weg durch die Vorweihnachtszeit.
Heuer schon wieder keine Schokolade. Dafür zum sechsten Mal gute Literatur, quer durch. Jeden Tag darfst du auf advent.mosaikzeitschrift.at ein weiteres „Türchen“ aufmachen und Punsch dazu trinken und Schokolade dazu essen.
Damit das funktioniert, brauchen wir aber auch Türchen-Material. Schick uns deine Texte aller Art:
schreib@mosaikzeitschrift.at | Einsendeschluss: 11. November
Inspiration dafür kannst du dir z.B. bei den freiTEXTen, den freiVERSen oder beim letztjährigen Advent-mosaik holen.
Wir freuen uns auf deine Texte!
klein und laut 2017 // Sei hier Gast ...
... sei hier Gast, wir debattieren ohne Rast.
Genug der Anspielungen auf die schönsten Hits aus Disney Filmen, es geht weiter im Programm.
Tristan Marquart ist heute noch angereist um mit uns über Ideen zu sprechen.
Er stellt das Projekt "Initiative der unabhängigen Lesereihen" (lesereihen.org) vor. Dabei betont er sehr stark, dass Vernetzung auch wirklich ein gemeinsames Ziel verfolgen muss, sonst ist sie schön und nett, aber auch nicht zielführend.
Als zentrale Punkte nennt er Themen, die auch bei uns in der Diskussion schon oft aufgetaucht sind:Interner Austausch, Aktion und Perspektive. Wichtig ist es auch, eine Sichtbarkeit zu schaffen, und darauf aufmerksam zu machen, dass es sehr wohl auch Literatur außerhalb des klassischen, institutionalisierten Literaturbetriebs gibt, ohne diesen in irgendeiner Form abzulehnen.
Die viele inhaltliche Zusammenarbeit, hat dort bestätigt, das viele Probleme in vielen Städten die selben sind (Stichwort: Kulturpolitik), die gleichen sind. Eine ordentliche Struktur zu schaffen hat geholfen, auch hinsichtlich der Motivation, wirklich etwas zu verändern.
Daraus leiten sich spannende Gespräche ab:
Über die Notwendigkeit, sich politisch zu positionieren, über Transparenz, Finanzierung und Verantwortung. Ebenso über die Probleme der Abgrenzung: Wer gehört eigentlich zu "uns" dazu, wer sind "wir", was ist unser Selbstverständnis und anhand welcher Kriterien definieren wir das, ohne ein Elitendenken in irgendeiner Form zu etablieren?
Das klingt nach wie vor nach vielen offenen Fragen, nach Ansätzen, die man noch weiterverfolgen muss. Und die gibt es auch.
Trotzdem ist viel passiert, hat sich vieles ergeben, wird noch passieren - in Zukunft, und vor allem miteinander.
Morgen findet zwar noch am Vormittag die letzte Sitzung statt, diese wird aber nicht mehr kommentiert werden.
Allen Salzburgern möchte ich die heutige Abendveranstaltung ans Herz legen - man sieht sich ab 18:00 in der Rauchmühle.
Hiermit verabschiedet sich der Live-Blog.
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.
klein und laut 2017 // Es wird konkreter. Ein bisschen.
Wir knüpfen da an, wo wir gestern Mittag aufgehört haben und versuchen, Möglichkeiten zu finden, wie eine konkrete Zusammenarbeit der Literaturzeitschriften in Zukunft aussehen könnte. Dabei wiederholt sich auch wieder die gestrige Frage:
" Warum machen wir das eigentlich alles?"
Die Autoren.
Die Leser.
Uns.
Deswegen wird ein regelmäßiger Austausch ( zur internen Kommunikation und zum Wissenstransfer) und eine gemeinsame Öffentlichkeitspräsenz (durch Kooperationsveranstaltungen, den Onlineauftritt, einen Literaturpreis) als sinnvoll erachtet und (in welcher Form auch immer) von allen Beteiligten angestrebt werden.
Klingt so, als hätten wir das gestern schon gehabt? Stimmt. Aber: neuer Tag, neue Fragen, neue Unstimmigkeiten und Anmerkungen, neue Debatten in punkto Organisation.
Aber es geht in die richtige Richtung.
So viel sei bisher schon verraten: Dies wird nicht das letzte Treffen sein!
klein und laut 2017 // Mit dem Hochzeitsmarsch im Ohr ...
... und den Füßen in der Mirabellgartenwiese melden wir uns zurück am zweiten Tag vom "Klein und Laut".
Während draußen fleißig geheiratet und das kitschige Stadtpanorama fotografiert wird, Kinder in Lederhosen im Pegasusbrunnen spielen, haben sich unsere Teilnehmer in Kleingruppen zurückgezogen um über die Ideen von gestern zu diskutieren. In einer guten Stunde werden die Ergebnisse präsentiert.
Wir sind gespannt und ihr seid auch heute wieder (mehr oder weniger) live dabei.
klein und laut 2017 // Ja! Hier! Kompetenzen!
Wir haben Ideen gesammelt und beschlossen, alle diese Inputs erst einmal bis morgen sacken zu lassen und in einer freien Minute jeder für sich noch ein bisschen zu überdenken. Morgen werden wir diese nach Themen sortiert in Kleingruppen besprechen und die Ergebnisse präsentieren.
Die letzte Stunde unseres Nachmittags nützen wir dafür, uns über unsere „ privaten Kompetenzen“ auszutauschen, also über Kenntnisse und Fähigkeiten, die wir in eine etwaige Zusammenarbeit mitbringen würden, die vielleicht über den akademischen Hintergrund, die Liebe und Fachkenntnis rund um die Literatur und die schriftstellerische Tätigkeit hinausgehen – oder auch:
„Wie können wir uns gegenseitig ausnutzen?!“
„ Ich habe eine akademische Perspektive.“
„ Ich kann Grafikdesign, ich mach es aber nicht gern.“
„ Ich kann ganz gut so Computerzeugs. Verschlüsselungen, wenn wer was braucht.“
„ Veranstaltungsorganisation ist mein Steckenpferd, was ich jetzt nicht so mag, sind Programmiersprachen.“
„ Texte mit Musik zu hinterlegen finde ich gerade wirklich interessant.“
„ Ich bin Sozialpädagogin. Also gut, dass wir darüber geredet haben.“
„ Ich hab deswegen auch Kontakt zu Leuten, die diesen Dreck wie Datenbanken SO RICHTIG gut können.“
„ Ich kann schon auch moderieren, aber ganz ehrlich, so meine liebste Beschäftigung ist es nicht“
„ Ich trag auch die Kabel und kann eine ganz solide Bar zusammenbauen.“
„Ich bin telefonisch erreichbar. Und für jeden Scheiß zu haben.“
Wie zielführend das jetzt wirklich gewesen ist, sei dahingestellt. Jedenfalls war es unterhaltsam und ein schöner, nicht zu anspruchsvoller Abschluss des ersten Tages.
mehr vom klein und laut morgen!
klein und laut // 2017 Es wird gebrainstormt ...
Es wird existenzialistisch bei uns im Pegasuszimmer, denn wir beschäftigen uns mit nichts Geringerem als der Frage:
" Warum sind wir eigentlich hier?"
Heute sollen Ideen und Ziele, die in Zukunft gemeinsam verfolgt werden können gesammelt werden. Morgen wird dann an der konkreten Umsetzung gearbeitet.
„Vielleicht brauchen wir die Vernetzung auch, um uns wieder auf unsere Ideale zurückbesinnen zu können“ (Christel, Außer.Dem)
Ideen // Ziele // Ansätze
- Zeitschriften-Pool
- Gemeinsame Lesungen, gemeinsame Zeitschriftenpräsentationen (vielleicht regelmäßig, unter einem Titel, in unterschiedlichen Städten, um mehr Öffentlichkeitsbewusstsein zu schaffen), ein „Fest der Zeitschriften“
- gemeinsame Anthologie
- sich unterstützen beim Vertrieb (und der Anzeigenakquise), bessere Präsenz im Buchhandel
- gemeinsame Öffentlichkeit herstellen (unter anderem mit dem Ziel, dass Literaturzeitschriften wieder öfter rezensiert werden)
- Netzwerk soll als solches auch präsent sein (Hinweisen auf Wettbewerbe und Einreichfristen der anderen Zeitschriften)
- Workshops zum Vermitteln von Wissen (drucktechnisches, finanzielles, … )
- zentraler Onlineshop, gemeinsamer Vertrieb in Kombination mit Verzeichnis der Autoren (vereinfacht das Finden von Texten auch für den interessierten Leser)
- gemeinsamer Veranstaltungskalender
- ein Name / eine Marke für alles!
- gemeinsamer Stand auf der Buchmesse (generell vielleicht durch Vernetzung eine breitere Präsenz ermöglichen, auch an Orten wo man „alleine vielleicht nicht hinkommt“)
- das Zurückbesinnen auf die eigentlichen Ideale
Was soll eigentlich das genaue Ziel der Vernetzung sein?
Es kann ja nicht nur um den erhöhten Zeitschriftenverkauf oder um mehr Geld gehen? (da sind wir uns einig!)
- Statement!
- Wissenstransfer → regelmäßige Treffen
- internes Feedback
- besserer Support für Autoren
- zeitschrifteninterner Motivationsschub, sich wieder über die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst werden
- das optimalere Ausnutzen der individuellen Fähigkeiten
- besserer Überblick über die Szene
- Jeder kann, keiner muss!
Wo viel Tatendrang und Motivation ist, da sind wir aber auch so frei, unseren eigenen Ideen kritisch zu begegnen...
- Aufwand Datenbank? Sinn Datenbank? Spielt das nicht dem klassischen Literaturbetrieb zu viel in die Hände?
- Will man wirklich als eine gemeinsame Marke wahrgenommen werden? Wie schafft man das, ohne irgendwie elitär zu werden?
- Wäre der Sinn von Vernetzung nicht eigentlich, dass man dadurch weniger Arbeit hat und etwas neues, das mehr Spaß macht? Hier wird von vielen großen Ideen und Zielen gesprochen, aber ist der dadurch entstehende Arbeitsaufwand für das Individuum und die einzelne Zeitschrift überhaupt noch zielführend und bewältigbar? Was ist da realistisch? Im nächsten Jahr oder längerfristig?
.... mehr davon in Kürze.
Lisa-Viktoria Niederberger