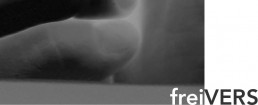freiTEXT | Vera Hohleiter
Tapgol Park
Ein Sportfest, was für eine dumme Idee… Kyu-ho fragte sich, wer wohl den Einfall gehabt hatte, dass ein Sportfest für die Angestellten der Firma eine passende Teambildungsaktivität war. Er zog die Baseballkappe tiefer ins Gesicht, denn er wollte vermeiden, dass ihn jemand auf der Straße erkannte. Diese alberne Sportjacke mit dem Unternehmenslogo war ihm peinlich.
Mürrisch stapfte er in Richtung U-Bahnhof. Er starrte vor sich hin, bis ihm plötzlich einige hundert Meter vor ihm eine vertraute Gestalt auffiel. Aus der Entfernung sah Kyu-ho nur den Rücken seines Vaters. In dem übergroßen Jackett wirkte sein Oberkörper so lang und so wuchtig, dass er überhaupt nicht mehr zu den dünnen kurzen Beinen passte. Eigentlich hatte Kyu-ho seinen Vater nur an dem viel zu großen Jackett erkannt, denn es war früher sein eigenes gewesen. Bereits vor Wochen hatte er es in der Altkleidertonne entsorgt. Sein Vater musste es wieder herausgefischt haben.
Offenbar war sein Vater ebenfalls auf dem Weg zum U-Bahnhof. Was er wohl vorhatte, wen er wohl traf, womit er sich den ganzen Tag die Zeit vertrieb? Seitdem die Firma seines Vaters in der Asienkrise bankrottgegangen war, befand er sich im ungewollten Ruhestand. Zwar versuchte er immer wieder, hier und da zu arbeiten, ließ sich in naiver Gutgläubigkeit auf zwielichtige Geschäfte ein und war dann wieder enttäuscht, wenn abermals eine Geschäftsidee geplatzt war. Kyu-ho hatte mit Anfang Zwanzig die finanzielle Bürde für die gesamte Familie übernehmen müssen – was ihm eigentlich nichts ausmachte, solange sein Vater sich von dubiosen Geschäftspartnern fernhielt. Ob er wohl wieder auf dem Weg zu so einer Scheinfirma war? Kyu-ho fragte sich, was so eilig war, dass die Angelegenheit seinen Vater so früh am Morgen aus dem Haus getrieben hatte. Der Anblick seines Vaters im Jackett auf dem Weg zur U-Bahn genügte, um ihn misstrauisch zu stimmen.
Am U-Bahnhof angekommen, bemerkte Kyu-ho, dass sein Vater den Bahnsteig der Linie 1 ansteuerte. Er selbst musste eigentlich die Linie 4 nehmen. Hin- und hergerissen, trat Kyu-ho von einem Fuß auf den anderen, tat so, als studierte er den U-Bahnplan von Seoul, während er nachdachte. Er überlegte, ob er seinem Vater noch ein Stückchen folgen sollte, weil er doch zu gerne gewusst hätte, was er im Schilde führte, oder ob er es aufgeben sollte und einfach, wie geplant, zum Sportfest der Firma gehen sollte. Vielleicht würde es niemandem auffallen, wenn er ein bisschen zu spät kam. Bei hunderten von Angestellten, konnte doch sowieso niemand den Überblick behalten…
Als er die U-Bahn der Linie 1 einfahren hörte, rannte er kurzentschlossen hinunter auf den Bahnstieg und sprang in letzter Minute in den Waggon, in dem sein Vater bereits auf einem Sitzplatz für Senioren saß. Sein Vater schien ihn gar nicht bemerkt zu haben. Vorsichtshalber versteckte sich Kyu-ho hinter einer Gruppe Teenager, sodass er nicht mehr im Sichtfeld seines Vaters war, er ihn aber dennoch im Blick behalten konnte. Von seinem Stehplatz aus beobachtete Kyu-ho seinen Vater aus den Augenwinkeln. Eigentlich unterschied ihn nichts von den anderen Senioren, die alle irgendwie verloren wirkten, zwischen all den Smartphones und den Bildschirmen, über die grell-bunte Werbespots und Musikvideos von blutjungen Popstars flimmerten. Die alten Männer mit ihren runzeligen, von Altersflecken übersäten Händen, ihrem schütteren Haar und ihrem resignierten Gesichtsausdruck wirkten wie Relikte aus einer anderen Zeit, die irgendwie nicht mehr in diese bunte optimistische K-Pop-Welt passten.
Nach wenigen Stationen erhob sich Kyu-hos Vater von seinem Seniorensitzplatz. Am U-Bahnhof Jonggak stieg er aus. Kyu-ho folgte ihm, trödelte aber absichtlich, bis er genug Abstand zu seinem Vater halten konnte. Von hinten wurde er mehrmals geschubst. Leute fluchten lautstark, weil sie fanden, dass er den Weg versperrte. Kyu-ho reagierte nicht auf die Beschimpfungen, sondern konzentrierte sich nur darauf, seinen Vater nicht aus den Augen zu verlieren.
Er folgte seinem Vater auf die Straße hinauf. Sie passierten den Jongno Tower. Kyu-ho hielt den Kopf gesenkt und versteckte sich weiter hinter seiner Baseballkappe. Er befürchtete, dass sich jemand, den er kannte, zu dieser Uhrzeit in Jongno aufhielt und vielleicht auf dem Weg zu einem Meeting war im „Top Cloud“, dem schicken Restaurant im 33. Stock des Jongno Tower.
Kyu-hos Vater bog nach links ab und schritt durch ein bunt bemaltes Holztor. Tapgol Park – Kyu-ho war noch nie dort gewesen. Niemand in seiner Altersgruppe verirrte sich dorthin. Es war ein Park, in dem sich hauptsächlich alte Männer zum Janggi spielen trafen, weil sie sonst nichts zu tun hatten. Kyu-ho fragte sich, warum der Park nicht längst als Bauland freigegeben worden war. Schließlich war im Zentrum von Seoul jedes unbebaute Fleckchen Gold wert. Man hätte einen eleganten modernen Wolkenkratzer auf dem Gelände des Parks errichten können.
Kyu-ho versteckte sich hinter dem Holzpfeiler einer Pagode. „Hey, Kleiner, hast du ein bisschen Zeit für mich?“, hauchte jemand von hinten in einer gekünstelten Stimme, die wohl verführerisch klingen sollte. Kyu-ho glaubte, einen leichten chinesischen oder vielleicht auch nordkoreanischen Akzent herauszuhören. Es war eine Prostituierte, die vom Alter her bereits weit jenseits der Menopause sein musste. Erst scheuchte er sie ungehalten weg, dann lief er ihr hinterher und drückte ihr einen 10.000-Won-Schein in die Hand und sagte, sie solle sich damit etwas zu essen kaufen. Einerseits bekümmerte es ihn, dass sich ältere Frauen so erniedrigen mussten, andererseits fand er es schamlos, dass sie einsamen Männern im Park auflauerten und versuchten, ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen.
Die Prostituierte hatte Kyu-ho abgelenkt. Für einen Moment hatte er die Spur seines Vaters verloren. Sein Blick wanderte durch den Park. Er sah sich die Gesichter der Janggi-Spieler genauer an, aber keiner war sein Vater. Er schlenderte ein bisschen an den Pagoden vorbei. Dann entdeckte er seinen Vater, der zusammen mit einem anderen alten Mann in schlechtem Englisch auf ein ausländisches Mädchen einredete. Kyu-ho fragte sich, wie das Mädchen wohl im Tapgol Park gelandet war. Es schien ihm ein so abwegiger Ort für eine junge Touristin. Dann entdeckte er, dass sie ein Buch, das wie ein Reiseführer aussah, in den Händen hielt. Die Haut der Fremden war leicht gebräunt, nicht so weiß wie die der Koreanerinnen, die sich vor jedem Sonnenstrahl versteckten, und sie hatte ein Gesicht wie ein Hollywoodstar, dessen Name Kyu-ho aber nicht einfallen wollte. Ihrem Aussehen nach konnte Kyu-ho nicht erraten, woher sie kam, vermutete aber irgendwo aus Nordamerika oder Europa, vielleicht auch aus Australien.
Kyu-ho ging ein bisschen näher heran, denn er wollte ein paar Fetzen der Unterhaltung aufschnappen. Er hörte, wie sein Vater nach dem Alter des Mädchens fragte und ob es verheiratet sei. Das Mädchen antwortete ihm betont langsam und freundlich und sagte, es sei 25 Jahre alt und nicht verheiratet. Daraufhin brachen Kyu-hos Vater und der andere alte Mann in schallendes Gelächter aus und wiederholten mehrmals das Wort „Single“, „Single“, „Single“, ... Das Mädchen kicherte ein bisschen und warf ihnen einen Blick zu, aus dem Kyu-ho herauslas, dass es die beiden alten Männer gleichzeitig lustig und lästig fand. Kyu-ho schämte sich ein bisschen für seinen Vater. Wie gerne hätte Kyu-ho die schöne Fremde aus dieser unangenehmen Situation befreit. Er hatte nur zu ihr hinübergehen müssen und ihr in korrektem Englisch erklären können, dass in der Generation seines Vaters kaum jemand Fremdsprachen sprechen konnte und dass man in dieser Generation jung geheiratet hatte, weswegen auf die alten Männer eine unverheiratete 25-Jährige wie ein übriggebliebener Weihnachtskuchen wirkte. Er hätte weiter ausführen können, dass junge Koreaner heutzutage ebenfalls immer später heirateten, hätte ihr dies und das über koreanische Kultur erläutern können und sie hätte ihm ein interessiertes Ohr geschenkt und wäre vielleicht mit ihm ins „Top Cloud“ essen gegangen und hätte ihm vielleicht sogar ihre Telefonnummer gegeben, … In seiner Vorstellung spann Kyu-ho die Geschichte weiter und weiter, bis ihm auffielt, dass das ausländische Mädchen längst gegangen war und dass sein Vater und der andere alte Mann mit einem Janggi-Spiel begonnen hatten.
Kyu-ho wandte sich ab, verließ den Park und machte sich auf den Weg zum Sportfest seiner Firma.
Vera Hohleiter
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Lea Sauer
Schlaf ist eine bittere Körnung
2
Bettkasten ein Paravent nackter Schlaf nur Schleim verbittert spätestens vier Uhr nachmittags horizontal eine Körnung im Kopf keine Luft Frische Schwüle an den Wänden an der Decke legt sich herab vor allem auf die Jochbeine drückt sich der Nachtdruck will nicht verschwinden.
Lea Sauer
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Susanne Pernkopf
Wird schon nichts gewesen sein
Es ärgerte ihn, dass er nicht mehr Tourist in seiner Stadt war. Deshalb spazierte er dieses Mal nicht über die Spabersbachgasse, sondern bog über die Albersgasse in die Morellenfeldgasse ein. Bei den Häusern kamen ihm keine Betrachtungen, er schaute nur. Als er aber zu den Fahrradständern von Haus Nummer 9 schaute, zog er seine Zigarette ganz schnell aus dem Mund. Seine linke Hand hörte auf mit der Fisherman‘s Friend Packung in der Hosentasche zu spielen und er blieb stehen. An dem Fahrradständer lehnten sieben Räder, eines ganz vorne. Es hatte keine Kotflügel, keinen Gepäcksträger und kein Licht.
Ein altes KTM Fahrrad.
Er schaute sich um und dämpfte seine Zigarette an einem Mistkübel aus. Das Fahrrad wurde vor allen anderen, ganz vorne platziert. Er steckte beide Hände in die Hosentaschen und betrachtete es. Beide Reifen hatten keine Luft. Ihm wurde warm. Die Lenkgriffe aus weißem Plastik. Der Griff für die Gangschaltung zeigte nach oben. Er drehte die Gangschaltung runter. Im Stand, das geht doch nicht. Er schaute sich um. Kein Mensch in der Morellenfeldgasse.
Er schaute auf die Fassade der Nummer 9, ein sanierter Altbau, ließ die Schultern hängen und ging weiter.
Hmmm, dachte er. Er zündete eine Zigarette an und ging stadtauswärts.
Aber warum war das Rad nicht abgesperrt?, sagte er, als er zuhause die Tür aufsperrte. Seine Freundin saß auf der Couch und las Wilhelm Tell. Wurde dein Fahrrad gestohlen?, fragte sie. Er stand vor ihr mit Jacke und Schuhen. Nein, nicht meins aber vielleicht ein anderes, sagte er. Ein Schönes?, fragte sie. Ein KTM, das war vor fünf Stunden, sagte er. Sie legte das Buch weg und zog sich die Schuhe an. Auf der Straße bot er ihr ein Fisherman’s Friend an. Es hatte nicht einmal Katzenaugen, sagte er.
Sie schaute sich das sanierte Haus an. Im ersten Stock waren neue Fenster, etwas verstaubt mit Wischspuren. Ein Porsche und drei Audis parkten vor dem Haus. Das KTM stand noch da. Sie legte ihre Hand auf den Sitz, der wackelte. Wer fährt mit einem wackeligen Sitz herum?, dachte sie und sagte er. Vielleicht hat es jemand kurz geparkt und das Schloss vergessen, sagte sie. Er schüttelte den Kopf. Wenn das Kettenblech nicht so gepflegt aussehen würde, dann hätte ich es sofort mit genommen, sagte er. Aber schau mal, sagte sie, die Geschichte geht so: Das Haus hat neue Mieter, hier der Porsche und die Audis zum Beispiel. Die haben Elektrofahrräder, die im Innenhof stehen. Der Hausmeister hat ausgemistet und im Vergleich zu den neuen Rädern kam es ihm alt und rostig vor. Deshalb hat er es einfach rausgestellt.
Er lächelte und ging um eine Birke herum, aber, sagt er, wenn die Geschichte nicht so war und jemand sein Fahrrad sucht? Dann, sagte sie, werden wir erwischt und jemand kann uns diese Geschichte endlich erklären.
Susanne Pernkopf
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Lea Sauer
Schlaf ist eine bittere Körnung
1
Hämmert Körper an Scheiben eine Furche zwischen Hitze oder Brocken Langeweile ausufernd aufgeworfen überall Fliegen auf dem Sehloch schwarz Schweiß in den Ellenbeugen brennt mir grell auf die Iris ein Bild ist eine Höhle zum Fallen darauf färbe ich Haare in Aubergine als Farbe erkennen kann ich mich nur vorgestellt zwischen Geräusch Temperatur in Dehnung Tropfen am Arm.
Lea Sauer
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Kai Wieland
Schwarze Katzen
Der erste Zufall an jenem Tag war, dass der Nebel aufzog, als die Maschine ruhig über dem Hunsrück dahinglitt, und dann erschienen die endlosen Windkraftanlagen im diffusen Grau plötzlich wie Kreuze, die aus Grabhügeln ragten. Der zweite Zufall war, dass es ausgerechnet Herr Seibold war, der auf Platz 26F teilnahmslos aus dem Fenster starrte und diesen Umstand bemerkte, während er darüber nachdachte, was die Flugbegleiterin am Boden zu ihm gesagt hatte.
„Nachts sind alle Katzen schwarz“, hatte sie lachend zu ihm gesagt, nachdem er sich bei ihr nach seinem Gate erkundigt hatte. Was sollte das bedeuten? Ohnehin schon wurde er aus solchen Frauen, aus den jungen mit strahlenden, makellosen Zähnen, nur selten klug. Und wer wusste schon, worum die Gedanken einer Stewardess kreisten, wenn sie nicht in ihrem Element war, sondern erdgebunden, wie jeder andere gewöhnliche Menschenleib. Herr Seibold war Bestattungsunternehmer, weswegen er beim Anblick der Grabkreuze im kriechenden Nebel 10.000 Meter unter ihm nicht erschauderte. Allerdings war er mit seinen Gedanken auch woanders, eben noch immer bei jenen schwarzen Katzen, denn er meinte sich vage zu erinnern, dass das Sprichwort anders ging. Dennoch suchte er den Fehler bei sich selbst, er fühlte sich nicht sicher auf dem Gebiet der Redewendungen. Als Bestattungsunternehmer hatte er vorsichtig zu sein, mit einer Bemerkung wie „Wer anderen eine Grube gräbt …“ konnte man eine Lawine lostreten. Die meisten Menschen erwarteten, und das mit jedem Recht, wie Herr Seibold einsah, vollkommene Humorlosigkeit von dem, der ihre Angehörigen unter die Erde brachte. Und doch, gab es in seinem Beruf etwa nicht das morbide Pendant zur lachhaften Kundenbeschwerde oder zum hypochondrischen Patienten? Herr Seibold war Profi in einer von Profis dominierten Branche.
Die dritte Zufall war im Grunde nicht besonders erstaunlich, aber doch erstaunlicher als die beiden zuvor. Was ist auch bemerkenswert an etwas Nebel im Hunsrück oder an einem Bestattungsunternehmer, der Kreuze sieht und über Katzen nachdenkt, über Katzen, so schwarz wie die Nacht.
Frau Schell, die vor Gate 55 mit geübt dahinhuschenden Fingern ihre Uniform richtete, nahm ihn kaum wahr. Sie konzentrierte sich auf die Glattheit ihrer Zähne, wenn sie mit der Zunge darüberfuhr, so wie immer, kurz bevor sie eine Maschine betrat. Über schwarze Katzen, oder über Katzen ganz gleich welcher Couleur, dachte Frau Schell eigentlich selten nach. Trotzdem war sie sensibel, was Farben anging. Sie verlor schnell die Geduld mit dem Mann im dunklen Anzug, und mit der hektisch Art, wie er seine Jackett- und Hosentaschen nach dem Ticket abtastete und sie dabei nach dem Weg fragte, unsicher, an welches Gate er überhaupt musste. Was die Menschen an Flughäfen so nervös machte, würde sie nie verstehen. Wo konnte man in solchen Zeiten sicherer sein als an Gate 55, zwischen Palma de Mallorca und Düsseldorf, zwischen Charles de Gaulle und José Martí. Wo sonst wusste man so genau, wohin ein jeder ging, und konnte so gleichgültig sein gegenüber der Frage, woher er kam? Sie mochte Flughäfen, war beinahe lieber dort, als an Bord einer Maschine. Und aus verschiedenen Gründen waren ihr Passagiere auch lieber als Menschen.
Anders als Frau Schell gehörte Herr Seibold zu jenen, die man schon vergaß, während man ihnen noch den Weg erklärte. An seinem äußeren Erscheinungsbild gab es nur zwei hervorstechende Merkmale, die einander jedoch neutralisierten. Seine enormen Segelohren wurden gemildert durch einen ungewöhnlich buschigen Backenbart, der in Herrn Seibolds ansonsten recht langweiligem Gesicht eine nicht weniger langweilige Symmetrie herstellte. Fast immer, wenn er mit Fremden sprach, schlug ihm eine untergründige Geringschätzung entgegen, die er fatalerweise seinem fehlenden Charisma zurechnete. Hätte sich Herr Seibold öfter rasiert und im Winter ein Stirnband getragen … er war gewiss kein faszinierender Redner, aber mit Anekdoten aus seinem Beruf hätte er die Leute durchaus faszinieren können. Natürlich verwehrte ihm das sein Berufsethos und die Angst davor, aus einem blöden Zufall heraus einen Angehörigen vor sich zu haben. Das konnte selbst einem Profi passieren.
Der dritte Zufall an diesem Tag war, dass Herr Seibold und Frau Schell sich an Bord derselben Maschine befanden, als diese über den Hunsrück schwebte und ihren Schatten auf die sich drehenden Kreuze am Boden warf wie eine verirrte Wolke.
Angesichts der Tatsache, dass Frau Schell als Bordbegleiterin arbeitete und Herr Seibold die Dienste ihrer Fluggesellschaft in Anspruch nahm, ist dieser Zufall also kein ganz und gar unglaublicher. Alltäglich war die Geschichte aber auch nicht, und Herr Seibold nahm sich vor, sie als unverfängliche Anekdote im Hinterkopf zu behalten.
Er bemerkte das bekannte Gesicht erst, als es ihm ohne ein Zeichen des Wiedererkennens, aber mit freundlicher Miene einen Kaffee anbot. Bei der Sicherheitseinweisung hatte er aus dem Fenster gesehen und die Männer in den gelben Jacken beobachtet, fasziniert von ihren unsichtbar koordinierten Bewegungen und Handlungen. Er erwartete nicht, an diesem Tag zu sterben, und er sollte Recht behalten.
„Milch und Zucker dazu?“. Ihre Stimme klang warm und freundlich, ganz anders als noch am Boden.
„Nein, danke. Ich trinke ihn … nein, danke!“
Er blickte ihr über die Schulter nach, und er fand, sie machte ihre Sache sehr routiniert. Eine ältere Dame mit kurzem grauem Haar schüttelte einige Reihen hinter ihm über ein zerknicktes Taschenbuch hinweg missbilligend den Kopf, und so drehte sich Herr Seibold eilig um und sah wieder aus dem Fenster. Noch immer überzog eine zähe graue Masse das Land.
Herr Seibold fühlte sich unwohl. Er hatte aus Nervosität vor dem Abflug zu viel gegessen, und er war nicht sicher, ob seine Hotelreservierung gültig war, denn eine Bestätigung hatte er nicht erhalten. Man müsse Urlaub machen, hatten seine Mitarbeiter gemeint, einen Tapetenwechsel brauche man von Zeit zu Zeit, und London sei eine Reise wert. Und wie so oft in seinem Leben setzte er den erstbesten Vorschlag exakt um, ohne eigene Bedürfnisse und ohne im eigentlichen Sinne überzeugt davon zu sein. Er hätte sich ebenso viel und ebenso wenig davon versprochen, nach Paris, Stockholm oder Podgorica zu fliegen. Nachts sind alle Katzen schwarz. Seine Stirn lag in tiefen Falten, als sich Frau Schell erneut an ihn wandte, um ihm einen Snack zu reichen. Ihm fiel erstmals auf, wie müde die junge Frau wirkte. Er bemerkte es nicht an ihrem Gesicht, das wie eh und je professionelle Frische ausstrahlte, sondern an der Art und Weise, wie sie sich bückte, um ihm das Käsecroissant über seine beiden Nebensitzer hinüberzureichen. Und dann war da noch der Ausdruck in ihren grauen Augen, die sich in den seinen lethargisch zu verlieren schienen, schlafwandelnd, gleichgültig.
Frau Schell hatte ein schlechtes Gedächtnis für Gesichter, was in ihrem Beruf, in dem sie sehr vielen Menschen begegnete, gewisse Vor- als auch Nachteile mit sich brachte. Herrn Seibolds größtes Problem mit seinem Beruf war, dass er die Gesichter nie wieder vergaß. Er hatte Frau Schell schon früher gesehen, es wurde ihm jäh bewusst.
„Salz und Pfeffer dazu?“
Herr Seibold war Purist. Er glaubte nicht an das Schicksal. Wenn man um die Dinge zu viel Aufhebens machte, forderte man Enttäuschungen geradezu heraus. Er beschloss, Frau Schell und ihre Katzen fortan zu ignorieren.
„Nein, vielen Dank“, erwiderte er. „Haben Sie eine Schlafmaske für mich?“
Frau Schell lächelte schwach. „Ach, wissen Sie...“
Eilig fuchtelte Herr Seibold mit einer ablehnenden Geste durch die stickige Luft. „Nicht weiter schlimm, der Flug dauert ja nicht mehr lange. Ich könnte wohl ohnehin nicht einschlafen, es ist alles so eng. So eng!“
Die junge Frau nickte freundlich und räumte wortlos seinen leeren Becher ab. Das enttäuschte Herrn Seibold, er hätte etwas mehr Schuldbewusstsein erwartet. Seiner Ansicht nach gehörte es zu den Kernaufgaben einer Stewardess, sich für die Fehler ihrer Airline zu entschuldigen. So wie er sich wieder und wieder für Dinge entschuldigen musste, die nicht in seiner Hand lagen. Er hatte damals keinen Fehler gemacht, er war Profi. Er hatte sein Beileid ausgesprochen, und die grauen Augen hatten sich geschlossen und man hatte geschwiegen, und dann war Herr Seibold an die Arbeit gegangen.
„Es tut mir Leid.“ Er hatte es ernst gemeint. Aber eigenartigerweise machte das die Menschen nur noch wütender. Auf der Bordtoilette erbrach sich eine junge Frau mit bedauernswert langen Beinen, sie erbrach sich bereits seit über einer Stunde. Er konnte sie hören, während er an seinem Kaffee schlürfte. Sie waren mittlerweile über dem offenen Meer, und es gab nichts mehr zu sehen, er sehnte die Landung herbei. Würden sich ihre Wege dann trennen? Die seinen und die von Frau Schell? Oder würde sie auch seinen Rückflug am kommenden Sonntag begleiten, und sich wieder nicht an ihn erinnern, und von den Dingen reden, als seien sie ohne Bedeutung. Er war froh, nicht mehr jung zu sein.
Beim Verlassen der Maschine schenkte Frau Schell, die mit ihren müden Augen Position am Ausgang bezogen hatte, ihm eine Miniaturtafel Schokolade. Sie tat das mit allen Passagieren, Herr Seibold wusste das. Aber dennoch spürte er eine winzige Spur Vertrautheit, als ihre weißen Zähne ihn anstrahlten, und er verharrte einen Moment und suchte in ihrem Gesicht nach einer Erwiderung des Gefühls. Aber Frau Schell hatte ihren Blick bereits abgewandt. Ihr Gesicht schenkte ihm noch Aufmerksamkeit, aber die Augen suchten bereits nach dem nächsten leeren Augenpaar in der langen Reihe hinter ihm, nach dem nächsten verschwimmenden Stück Mensch, das sich schon im selben Moment wieder zu einem blinden Fleck zu verwandeln begann.
Kai Wieland
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Safak Saricicek
kleiner abriss
1
eine zange aus stahl schmettert durch die wände der wohnung
durch die stützen
und von einer plattform spritzt ein bauarbeiter wasser
in die neuen wunden im betongehäuse, damit kein staub aufwirbelt
jedes hineinschmettern der stählernen greifer lässt beton
brocken, eisenstangen, die zwanzig oder so stockwerke der abzureißenden wohnung
hinunterstürzen
von hier, in der straßenbahn, im vorbeifahren sieht es aus wie
als ob ein gigantischer skorpion ein gigantisches haus aus sand attackiert
wenn die brocken herunterstürzen, scheinen sie aus der ferne
aus der etage zu tröpfeln, als wäre das haus ein riese, der sich zum schlafen gelegt
hatte, von den jahren ausgedörrt das aufwachen vergaß,
dessen überbleibsel es jetzt aufzuräumen gilt.
2
„ein abstruses bild“ , wirst du vielleicht sagen,
werte frau, die über mich gestolpert ist, als nutznießerin oberflächlicher affären
3
dieses haus ist die erinnerung an dich,
die es abzumontieren gilt, die maschine des abrisses ist die zeit, der wasserschlauch
- das erbarmen mit sich selbst
und auch wenn das haus, der gedanke an die zeit mit dir
entfernt ist, wird es immer wieder stehen, in meinem träumen, die träume abreißen:
das kann ich nicht.
Safak Saricicek
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Vera Hohleiter
Chungking Blues
Der Regen prasselte an die Scheibe des winzigen Fensters. Es war das einzige im Raum und so klein, dass kaum Tageslicht hereinkam. Marie hatte die Deckenbeleuchtung eingeschaltet, obwohl es erst früher Nachmittag war, denn das Halbdunkel des Zimmers deprimierte sie. Sie ging drei Schritte vom Fenster zum Bett und dann noch einmal zwei Schritte bis zur Duschecke, die eine Art Miniaturbadezimmer darstellte. Hinter der Faltwand aus Kunststoff befand sich eine Toilette, ein winziges Waschbecken und eine Handbrause. Wenn man auf der Toilette saß, stieß man mit den Knien gegen die Faltwand. Wenn man duschte, wurde die Toilette nass. Für die Duschecke zahlte Marie 50 Hongkong-Dollar extra, aber das war es ihr wert. Von Gemeinschaftsduschen hatte sie genug nach ihrer sechsmonatigen Rucksackreise durch Australien und Südostasien.
Wie ein gefangenes Tier drehte sie sich im Kreis und lief auf und ab in ihrem winzigen Zimmer im Sunflower Hotel. Es nannte sich zwar Hotel, doch eigentlich war es eher eine Pension. Durch die papierdünne Wand hörte Marie, dass Rosie, die Zimmerwirtin, nebenan eine koreanische Seifenoper ansah, in der sich eine Männerstimme und eine Frauenstimme ganz fürchterlich auf Koreanisch stritten. Rosie thronte den ganzen Tag auf dem Bett eines der Deluxe-Zimmer direkt am Eingang des Sunflower Hotels, manchmal alleine, manchmal in Begleitung ihres rund zwanzig Jahre jüngeren Ehemannes, einem Chinesen Anfang 30, den Rosie als Fernando aus Macau vorgestellt hatte. Da auch Rosies Zimmer so klein war, dass kaum andere Möbelstücke hineinpassten, saßen Rosie und Fernando auf dem Bett, tranken grünen Tee oder aßen gebratene Reisgerichte aus Pappschachteln, die aus einem der Schnellrestaurants in den unteren Stockwerken der Chungking Mansions stammten.
Der Fernseher in Rosies Zimmer lief vom frühen Morgen bis gegen Mitternacht, außer an Abenden, an denen Rosie und Fernando Tango tanzen gingen. Meist flimmerten koreanische Serien mit kantonesischen Untertiteln über den Bildschirm. Marie fragte sich, ob Rosie anhand dieser Dauerberieselung Koreanisch lernte – was ihr allerdings eher unnötig erschien, denn koreanische Touristen verirrten sich wohl kaum in das Sunflower Hotel. Sie übernachteten wahrscheinlich eher im schicken Peninsula Hotel am Hafen. Rosies Klientel bestand ausschließlich aus westlichen Backpackern, die aus allen Ecken Europas und Nordamerikas nach Hongkong gekommen waren. Amüsiert schien Rosie diese jungen Leute zu beobachten, als seien sie Figuren in einer ihrer Lieblingsserien. Sie kannte alle Gäste beim Namen und behandelte sie wie alte Freunde – nur eben wie Freunde, die für ihren Aufenthalt zahlten.
Marie sah auf die Uhr. Es war beinahe drei Uhr nachmittags. Um diese Uhrzeit hätte sie bereits am Victoria Peak sein können oder hätte durch die Straßen von Wan Chai schlendern oder mit der Fähre nach Macau fahren können – hätte ihr der Taifun nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht.
„Warum willst du überhaupt nach draußen?“ hatte Rosie gefragt, als Marie sich am Vormittag auf die Straße gewagt hatte, aber bereits nach wenigen Minuten völlig durchnässt zurückgekehrt war. „Die Chungking Mansions sind wie eine Stadt für sich. Du kannst hier drinnen ganze Tage verbringen, ohne dich zu langweilen.“
Daraufhin war Marie durch die 17 Stockwerke und die fünf Blöcke der Chungking Mansions gewandert. Sie hatte sich die Auslagen gefälschter Designerhandtaschen, bunter Satin-Cheongsams, farbenfroher Saris und wild-gemusterter afrikanischer Gewänder angesehen, ebenso wie das Angebot an billiger modischer Kleidung westlichen Stils. In einem indischen Restaurant in der 7. Etage hatte sie schließlich ein üppiges Mittagessen aus Aloo Gobi mit Reis zu sich genommen. Rosie hatte recht: die Chungking Mansions waren eine Welt für sich, aber nachdem Marie bereits fünf Stunden lang durch die schmuddeligen Gänge des Gebäudes gelaufen, mit den Aufzügen hoch- und wieder runtergefahren war, mehrmals den Kauf von gefälschten Markenuhren und Drogen aller Art abgelehnt hatte, war sie erschöpft in ihr Zimmer zurückgekehrt. Sie hatte gehofft, der Regen würde irgendwann nachlassen, aber der Taifun fegte mit nicht nachlassender Kraft über die Stadt.
Wirklich entspannen konnte sich Marie in ihrem Zimmer nicht. Die lautstarken koreanischen Fernsehauseinandersetzungen von der anderen Seite der Wand hallten durch den kleinen Raum. Ohne das Bild waren die herausgebrüllten Dialoge alles andere als interessant, sondern klangen eher unfreiwillig komisch. Ab und an wurden die Seifenopern von kantonesischen Werbespots unterbrochen oder Marie konnte Rosies und Fernandos Stimmen hören, aber nicht verstehen, worüber sie sich unterhielten.
Marie setzte sich auf ihr Bett und schaltete das winzige Fernsehgerät in ihrem Zimmer ein. Die bewegten Bilder der koreanischen Seifenoper, die Rosie und Fernando ansahen, erschienen auf ihrem Bildschirm, sodass auf einmal Bild und Ton zusammenpassten. Da Marie ohnehin nichts von der Handlung verstand, schaltete sie weiter. Sie klickte sich durch Dauerwerbesendungen, Nachrichtenprogramme und Kung-Fu-Filme. Auf einem englischsprachigen Sender blieb sie bei einer britischen Serie hängen, die in den 1920er Jahren auf dem Landsitz einer Adelsfamilie spielte. Die Damen trugen zu ihren glamourösen Abendkleidern aufwändige Hocksteckfrisuren mit Wasserwellen und diamantbesetzte Accessoires im Haar. Missmutig betrachtete Marie ihr eigenes Spiegelbild in dem kleinen Spiegel, der am Kopfende ihres Bettes hing. Sie strich über ihr strubbeliges Haar, das sie in Australien aus praktischen Gründen kurz geschnitten hatte. Je länger sie in den Spiegel sah, desto mehr zweifelte sie daran, dass diese Frisur für sie vorteilhaft war. Ihr Blick wanderte herunter und auf einmal war sie auch mit ihrem ausgeleierten T-Shirt und ihrer knöchellangen Cargohose unzufrieden. Doch ihre gesamte Reisegarderobe bestand aus alten ausgewaschenen T-Shirts und zwei unförmigen Hosen, die sie abwechselnd trug. Eigentlich hätte sie den gesamten Inhalt ihres Trekking-Rucksacks wegwerfen können. Die gammeligen Kleidungsstücke hätten nicht einmal die afrikanischen Altkleiderhändler aus dem 6. Stock mehr interessiert.
Nicht nur ihre Garderobe machte ihr schlechte Laune: das schäbige Zimmer, der Regen, ihre eigene Planlosigkeit… Sie hatte keine Ahnung, ob sie noch monatelang so weiterreisen und hier und da Gelegenheitsjob annehmen wollte, um die Reisekasse aufzubessern – oder ob sie einfach nach Hause fliegen sollte. Eigentlich wollte sie die Küste hinauf reisen, danach eine Weile in Peking bleiben und irgendwann, wenn sie genügend Fahrgeld zusammengespart hatte, sich mit der Transsibirischen Eisenbahn auf den Weg nach Moskau machen. Plötzlich schien ihr diese Idee völlig abwegig. War es nicht langsam an der Zeit für die Heimreise? War es nicht an der Zeit, sich einen richtigen Job zu suchen und erwachsen zu werden?
Marie stellte sich vor, wie es wohl war, nicht ständig umherzuziehen, sondern an einem Ort zu leben – in einem schönen Haus mit Geschirr, das zusammenpasste und schwerem Silberbesteck, in einem Haus, in dem Musik spielte und nicht Lärm von nebenan die Geräuschkulisse bildete, in einem Haus, in dem die Dielen knarrten, wenn der Hund durch den Korridor rannte. In ihrem Tagtraum war es Frühling oder Frühsommer, schon recht warm, denn die Terrassentür stand offen. Der Hund stürmte in den Garten und versuchte, einen Schmetterling zu fangen. Aus der Ferne war ein leichtes Vogelzwitschern zu hören und ein Kirschbaum im Garten stand in voller Blüte. Marie fragte sich, woher diese Bilder auf einmal kamen. Häuser mit Garten und Hunde, die Schmetterlinge jagten, hatten sie bisher nie interessiert.
Im Fernsehen tranken die Damen Tee aus zierlichen Porzellantässchen und rührten mit verschnörkelten Silberlöffelchen darin herum, bis sich der Zucker aufgelöst hatte. Für einen Augenblick überlegte sich Marie, ob sie - wenn der Regen nachließ - zum berühmten Fünf-Uhr-Tee ins Peninsula Hotel gehen sollte, um sich ein wenig aufzuheitern. Marie stellte sich vor, wie sie selbst, ähnlich wie die Damen im Fernsehen, aus einer Tasse aus hauchdünnem Porzellan Tee trinken und winzige Gebäckstücke oder akkurat geschnittene Sandwiches essen würde. Dann fiel ihr ein, dass der Nachmittagstee im Peninsula teurer war als eine Übernachtung im Sunflower Hotel und dass man sie, schlampig gekleidet wie sie war, vermutlich sowieso nicht hineinlassen würde.
Mürrisch schaltete sie den Fernseher aus. Die einzigen Geräusche, die sie jetzt noch hören konnte, waren der Regen, der immer noch mit unverminderter Intensität an die Fensterscheibe trommelte, und die koreanischen Dialogfetzen aus Rosies Zimmer. Im Kopf rechnete Marie ihr Reisebudget durch. Es reichte noch für ein paar Tage in Hongkong und für eine Zugfahrkarte nach Xiamen, wo es – nach Angaben einer niederländischen Rucksacktouristin, mit der sie sich im Flugzeug unterhalten hatte – ganz einfach sein sollte, in einer Nachhilfeschule einen Job als Sprachlehrerin zu finden. Marie überlegte sich, ob sie zurück ins Erdgeschoss der Chungking Mansions gehen und sich mit ein paar Sommerkleidern aus billigen bunten Synthetikstoffen neu einkleiden sollte. Vielleicht würde sie sich dann besser fühlen. Sie zählte die Hongkong-Dollar in ihrer Reisekasse.
Plötzlich verstummte das Fernsehgerät auf der anderen Seite der Wand und Rosie rief: „Marie, möchtest du vielleicht eine Tasse Tee?“
Vera Hohleiter
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Anne Büttner
Carrera
Bemüht, ihr zu gefallen,
gefiel ich besser als bemüht.
Bis du mich ihr schließlich überlassen hast;
Mich abgeschoben hast an sie.
Dorthin, wo ich nie sein wollte:
weg von dir.
Keine Chance zu schlingern oder anzuecken;
keine Hoffnung auf Disqualifikation.
Wie auch? Du hattest vorgesorgt:
Mich erst, als die Kurven begradigt,
die Unebenheiten beseitigt waren,
in ihre eingefahrene Spur gesetzt,
die mich sogleich erbarmungslos hielt;
mich des Vergnügens beraubte,
aus der Bahn zu schleudern.
Kein Gegenverkehr, keine Hindernisse,
kein Ende, kein Du in Sicht.
Dich hast du aus dem Rennen genommen -
Motorschaden.
Anne Büttner
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Stefan Heyer
Innere und äußere Mongolei
Die U-Bahnhöfe mied Karl zumeist. Lieber raus aus dem Mief, raus aus der Stadt, zumindest zum Wannsee. Oder gleich bis zur Ostsee. In seinen Träumen fuhr er über weite Steppen. Wurde zum Mongolen. Über die unendliche Weite. Tagelang keine Seele zu sehen. War in Berlin schwierig. Berlin war voll. Auch voller Touristen. Immer wieder ein Rucksack im Genick. Lärm machten sie auch noch. Wollte das Dorf in der Großstadt. Nah zur Arbeit. Cooles Ambiente. Lässige Altbauwohnung. Renoviert. Man war ja älter geworden. Man war ja längst kein Punk mehr. Ohrringe längst rausgemacht. Wohnte in Mitte. Nicht weit zur Politik. War jetzt Beamter geworden. War einfach sicherer. Er musste ja auch an die Zukunft denken. Nomade sein in der Mongolei. Wenn er nachts schlaflos lag. Die Fenster offen. Vom Innenhof die kühle Luft reinkam. In einer Jurte leben. Umherziehen. Unter freiem Himmel schlafen. Morgens ging er immer ins Ministerium. Lässiger Anzug. War nur eine kleine Nummer. Manchmal durfte er für den Chef Reden schreiben. Neulich hatte er sich einen Bart wachsen lassen. Über die Feiertage angefangen. Nein, nicht wie Dschingis Kahn. Für einen Hipster-Bart war er zu kurz. Und zu licht. Sein Chef hatte seltsam geschaut. Ein paar Tage später hatte er ihn abrasiert. Seine Freundin mochte ihn auch nicht. Wenn er nicht einschlafen konnte, lag er oft lang auf dem Bett und träumte. Oder setzte sich auf den Balkon. Sternenhimmel. Als wäre er in der Steppe. Um ihn herum Yaks. Der Wind erzählte von der Steppe. Morgen würde ein anstrengender Tag werden. Manchmal traf man Mongolen in Berlin.
Stefan Heyer
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Susanne Rzymbowski
Wie malt die Welt
in Farben sich
mit Pinsels Strich
der in Erinnrung bleibt
aus einer Hand
die unverzagt
im Greifen puren Seins
das losgelöst
von Sinn und Wort
der Freiheit ist entstammt
so schön der Akt
des glücklich seins
als Kind bist du geboren
Susanne Rzymbowski
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at