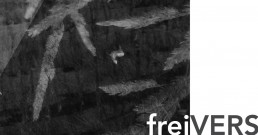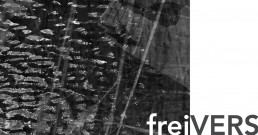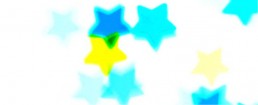freiTEXT | Ronir Mina
Ein Tag im September
Als ich heute morgen aus dem Haus trat und das Gartentor aufsperrte, fiel mir noch nichts Außergewöhnliches auf.
Erst als ich mich umdrehte um meinen Weg in die Stadt anzutreten, sah ich, dass der gesamte Weg von Fischen übersät war.
Es waren hauptsächlich Forellen und Brassen, mit weit aufgerissenen Mündern und stumpfen Augen. Auffällig waren blutige Striemen, die sich quer durch ihre Kopfpartie zogen.
Kurz bildete ich mir ein aus dem linken Augenwinkel noch ein Zucken, ein Zappeln eines Fischschwanzes wahrgenommen zu haben, ein letztes Aufbäumen noch vorhandener Lebenskraft.
Sonst war alles still.
Bei meinem Weg in die Stadt sah ich kaum Menschen. Eine ältere Frau kehrte die Straßen vor ihrer Haustür. Ihr gesamter Vorgarten war voller Hechte. Als sie mich sah, kehrte sie sich rasch um und schloss die Türe hinter sich.
Je weiter ich ging, desto mehr schien es mir, als wäre ich der einzige Mensch auf Erden. Keine Straßenbahn fuhr mehr, die Geschäfte waren geschlossen. Mit Menschen kam ich nicht in Berührung, abgesehen von ein paar wenigen dunklen Schatten an den Straßenecken. Als sie mich sahen, verschwanden sie jedoch und zogen sich in die dunkleren Ecken der Stadt zurück.
Ich ging die Herrengasse entlang, als ich plötzlich in einer Seitengasse, die mit Garnelen bedeckt war, einen Mann mit oranger Warnweste stehen sah. Er trug Brille und Klemmbrett und schien sich etwas zu notieren. Als ich Anstalten machte, mich zu ihm hinzubewegen, fuchtelte er wild mit den Armen und wies mich an, stehenzubleiben.
"Was machen Sie denn da?" schaffte ich es zu fragen, während er wild damit beschäftigt schien einen Bereich mit Klebeband abzusperren. Meine Worte trugen einen eigenartigen Nachhall. Dennoch war ich im selben Moment als die Worte meinen Körper verließen, unsicher ob ich die Frage überhaupt gestellt hatte. Er sah zunächst unsicher aus, ob ich eine Antwort wert wäre, dann schien er sich zu fassen und setzte eine gewichtige Miene auf. Er sei vom Ministerium, teilte er mir mit, und seine Aufgabe sei es, die vorhandenen Fische zu klassifizieren und in nach Größe zu ordnen. Generell beschränkte sich das Fischvorkommen auf die Familie der Lippfische, die Garnelen in der Gasse seien jedoch ein neuer Fund. Dies bedeutete wahrscheinlich, dass ihm eine nähere Verwandtschaft zwischen Garnelen und Lippfischen entgangen sei, viel konkreter und drängender war jedoch die Frage, ob er die Garnelen in der Größenaufstellung und dem Säulendiagramm berücksichtigen sollte, oder nicht. Gliederfüßer zählten schließlich, strenggenommen, nicht einmal zu den Wirbeltieren, die zu klassifizieren er den Auftrag hatte. Als ich ihn von den Brassen in meiner Wohngegend in Kenntnis setzte, die seiner Lippfisch-basierten Theorie grundlegend widersprachen, winkte er mich ungeduldig fort, als hätte ich ihn bei etwas Wichtigem gestört.
Der Rückweg erwies sich als anspruchsvoller als gedacht. Die Fische hatten alles, was sie jemals an Anmut an sich gehabt hatten, verloren. Stattdessen hatten sie begonnen einen starken Verwesungsgeruch von sich zu geben. Sich einen Weg durch die Fische zu bahnen, war ebenfalls schwieriger geworden. Einige waren, wahrscheinlich durch meine eigenen Fußtritte, schwer beschädigt worden und präsentierten ihre offenen, aufgeplatzten Wunden der steigenden Mittagssonne.
Ich wollte nicht warten, bis die Fliegen kamen, und legte die Strecke nach Hause so schnell wie möglich zurück. Als ich mich jedoch noch einmal umdrehte und die Stadt mit ihren tausenden und abertausenden Fischen dampfend vor mir liegen sah, musste ich zugeben, dass ich nie Schöneres gesehen hatte.
freiVERS | Michael Pietrucha
Samenkorn Zeit
Ich habe dir Zeit gegeben,
du hast sie mit den Augen geküsst,
habe sie unterwegs aufgehoben,
bevor sie unter meinem Schuh verschwunden wäre,
sie abgewogen; das Sonnenlicht von oben
und das Mikroskop hier unten sagten,
es sei ein Samenkorn, und geschoben
in ein Kuvert stecktest du es ein.
Ist denn das Samenkorn zu einer Ranke
auf deinem Fensterbrett gewachsen?
Michael Pietrucha
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Markus Streichardt
Provisorium
K., der gerade ins Taxi gestiegen ist, sieht einen Mann auf sich zukommen und dann mit den Fingerknöcheln gegen die Autoscheibe klopfen. Er fragt ungläubig: „Ist er das?“, und noch ehe K. antworten kann, brüllt er lauter: „Ja, das ist er! Das ist er!“ K. starrt regungslos in das entsetzte Gesicht, starrt in zwei stecknadelgroße Pupillen und einen weit aufgerissenen Mund. Er zählt drei Plomben, ehe das Taxi losbraust.
K. dreht sich um und ist überrascht, wie viel Aufmerksamkeit der Zwischenfall verursacht hat. Passanten halten ihre Handys in seine Richtung, als würden sie Fotos machen, während der Mann, der ihn angeschrien hat, aufgeregt telefoniert.
Als das Taxi abbiegt, richtet K. den Blick wieder nach vorn und lässt sich tiefer in den Sitz fallen. Nimmt der Tag gar kein Ende?, fragt er sich genervt. Immer kommt mir was in die Quere. Erst die Flugverspätung und dann noch Schienenersatzverkehr am Bundesplatz. Zwei Busse für eine rappelvolle S-Bahn und das im Hochsommer, na geht’s noch?!? „Ja, aber ist gut für unser Geschäft“, antwortet der Taxifahrer, was K. irritiert. Habe ich laut gesprochen?
„Außer die Spinner steigen zu uns ins Taxi. Genau wegen denen hab‘ ich meine Schicht gewechselt. Nachts ist es nicht mehr auszuhalten in Berlin. Zu viele Verrückte“, flucht der Taxifahrer und fügt mit weicherer Stimme hinzu, „auch zu viel Elend.“ „Kommt das oft vor?“, fragt K. und erhofft sich Ablenkung. „Inzwischen jede Nacht. Früher is so ne Type mal am Wochenende aufjetaucht, hat nen bisschen Radau jemacht und war dann wieder wech. Kenn‘ mich da aus, weeß wovon ick rede. Bin Urberliner. Vor 56 Jahren hier jeeborn, aufjeewachsn und nie rausjehkommn, wie ick zusagen pflege.“ K. grinst und denkt, ich ja, ich bin rausgekommen und habe die weite Welt gesehen.
Wegen Sanierungsarbeiten verengt sich die Fahrbahn auf eine Spur. Der Verkehr stockt. Die Stille setzt K. zu. Er bittet, das Radio einzuschalten. Mit überdrehter Stimme kündigt der Moderator den nächsten Song an: A horse with no name von America. Die Musik erfüllt ihren Zweck und bildet ein angenehmes Hintergrundrauschen. Während K. im Viervierteltakt auf die Knie trommelt, beobachtet er, wie eine Walze langsam den aufgetragenen Asphalt der Fahrbahn verdichtet und zwei Bauerarbeiter mit Besen hinterher fegen. Mit diesem beruhigenden Bild vor Augen möchte er am liebsten einschlafen und den Tag vergessen.
Die Musik wird jäh unterbrochen: »Der aus der psychiatrischen Anstalt Entlaufende wurde zuletzt in einem Taxi auf der Bundesallee Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz gesehen. Die flüchtige Person ist ca. 1,85m groß und schlank. Die Haare sind schwarz und kurz geschnitten. Er hat inzwischen seine Kleidung gewechselt. Er trägt ein dunkelblaues Jackett und eine schwarze Hose. Wie er sich aus dem gesicherten Bereich der Psychiatrie befreien konnte, ist weiterhin ungeklärt …«
K. weiß, er ist gemeint. Die aufkommende Panik versucht er mit rationalen Argumenten kleinzuhalten. Die Personenbeschreibung trifft auf jeden x-beliebigen Mann zu, denkt er angestrengt, der 1,85m groß ist, bei C&A einkaufen geht und Sport treibt. Vor anderthalb Stunden bin ich erst in Tegel gelandet. Das lässt sich leicht nachprüfen und - verdammt, ich sitze hier nur wegen diesem blöden Schienenersatzverkehr. Der Rollkoffer!, fällt ihm schlagartig ein, niemand flieht mit einem Rollkoffer! Die Vorstellung, wie er den Polizisten verschwitzte Hemden und seinen Kulturbeutel vorführt, belustigt ihn. Sein Grinsen erstarrt aber zur Grimasse, als sich sein Blick mit dem des Taxifahrers im Rückspiegel trifft. K. will die Sache klarstellen, aber dann glaubt er, eine Bewegung des Fahrers zum Handschuhfach auszumachen. Er brüllt „STOPP!“, reißt im nächsten Moment die Tür auf und springt hinaus. Dann läuft er in die entgegengesetzte Richtung davon.
Ich muss auf die Nebenstraßen ausweichen, überlegt K. verzweifelt, bevor mich der Mob fängt und massakriert. Er versucht langsamer zu laufen, aber sobald er mehr als zwei Personen auf sich zukommen sieht, macht er kehrt und zieht das Tempo an. Unterwegs wirft er sein Jackett achtlos fort.
Er flieht in die Kleingartenkolonie „Sonnenbad“, rennt die verschlungenen Pfade entlang, solange bis er sich hinter einer dichten Hecke wiederfindet. Er hört sich laut atmen und presst beide Hände auf seinen Mund.
Nach einigen Minuten steht K. vorsichtig auf, blickt sich um. Er ist auf einem verlassenen Grundstück. Der Rasen ist stellenweise verbrannt. Dahlien, Nesseln, Zinnien und Sonnenhüte säumen den Weg zum Bungalow - ein in L-Form gehaltener Flachbau mit Holzverkleidung und überdachter Steinterrasse. Im Hintergrund stehen zwei Apfelbäume, groß und mächtig, deren Äste die Außenfassade der Gartenlaube streifen. Ein verwunschener Ort, denkt K., bis ihm der Geruch von Grillfleisch und Brennspiritus in die Nase steigt und ihn an die Wirklichkeit erinnert.
Er geht zum Bungalow und rüttelt an der Tür. Verschlossen. Unter der Gartenbank entdeckt er neben Wassereimern und angerosteten Gießkannen einen halbvollen Bierkasten. Die Flaschen sind alle leicht staubig. K. pfeift. Irgendwo findet sich bestimmt ein Zweitschlüssel, denkt er, und ich komme rein.
K. füllt einen Eimer mit kaltem Wasser und legt einige Bierflaschen hinein. Dann schlendert er durch den Garten, inspiziert die Gemüsebeete und macht aus einer Laune heraus den Rasensprenger an. Gebannt verfolgt er, wie die Düsen um ihre eigene Achse rotieren und Sprühwasser im hohen Bogen ausstoßen. Das rhythmische Klicken der Automatik vermischt sich mit Kindergeschrei in der Ferne.
Dann zieht er seine Kleidung aus. Ganz selbstverständlich erst Schuhe und Socken, dann Hose und Hemd.
Während K. im selbst geschaffenen Sommerregen steht, wird ihm klar, dass die Geschehnisse, die zu seiner Verwechslung geführt haben, problemlos rekonstruiert werden können. Ich weiß, wer ich bin, denkt er und die Anderen werden es auch.
Trotzdem stellt er sich vor, wie es wäre, sich hier eine Zeit lang zu verstecken. Ich würde die reifen Tomaten und Auberginen vom Schneckenbefall befreien und ernten. Ich würde mir den Bungalow gemütlich einrichten und jeden Abend ein Lagerfeuer machen. Ja, das würde ich. Vielleicht wäre es nur ein Leben im Provisorium, denkt er, aber dieses Leben täte mir zur Abwechslung gut.
Auf diese Aussicht gönnt sich K. das erste gekühlte Bier.
Markus Streichardt
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Lütfiye Güzel
man lebt nicht jeden tag
-
eine spinne mit den augen
verfolgt
mit gutem gewissen
ihr netz nicht zerstört
dann obst von den bäumen
geschüttelt
& drei runden geweint
Lütfiye Güzel
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
24 | Kinga Tóth
„Tür auf, Tür zu“
vater wäscht sich
mutter kocht
fremde an der tür
nachtkäfer surren
grillen draußen
fremde an der tür
man sagt nichts hier
wenn sie fliehen
pfeifen die hahnsirenen
‘drauf blieb der topf
kocht über leert sich
mutter vater
fremde
Kinga Tóth
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
23 | Nicola Huppertz
tag vor heiligabend
zufällig
zwischen zwei eiligen schritten
lege ich den kopf in den nacken
und sehe wie sich die möwe
vom frühlingsmilden wind
davontragen lässt
ihr schmaler Körper
ohne gewicht
vor wolken aus hauchzarten
lamettafäden
am hellblau des himmels
während hier unten
zwischen läden und lichter-
ketten
noch immer die gesetze
der schwerkraft gelten
und die der saison
weshalb ich meinen blick abwende
und weiterhaste
der stillen zeit
entgegen
Nicola Huppertz
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
22 | Stefan Heyer
Seine Freunde konnte er nicht fragen
Viel geblieben war nicht von Aleppo. Die meisten Gebäude zerstört. Auch seine Freunde waren weggegangen. Geflohen aus der Stadt. Oder gestorben. Geschossen wurde nicht mehr. Das war auch alles. Das Leben? Musste weitergehen. Letztes Weihnachten hatten sie in der zerstörten Kirche gefeiert. Es war kalt gewesen. Ohne Dachstuhl. Heizen hätte da nicht geholfen. Aber sie hatten gefeiert.
Sein Vater hatte Arbeit. Hatte Glück gehabt. Vater stellte immer noch Seife her. Wenn er Olivenöl bekam. Und Lorbeer. War nicht leicht, die Sachen zu bekommen. Strom gab es wenig. Ein paar Stunden am Tag. Oft war der Strom plötzlich weg. Wasser gab es auch nicht immer. Das nervte am meisten. Das eine oder andere Haus wurde wieder aufgebaut.
Letztes Jahr hatte Jiro sich zu Weihnachten ein Stück Seife gewünscht. Was sollt er sich dieses Jahr wünschen? Seine Freunde konnte er nicht fragen. Es war kein Krieg mehr in der Stadt. War das jetzt Frieden? Sein Vater konnte es ihm nicht beantworten. Sie lebten. Sie hatten zu essen. Nicht immer. Manchmal hatte er Hunger. Eigentlich fast immer. Wenn kein Wasser aus der Leitung kam, musste er immer Kanister schleppen. In der Nähe gab es ein Kloster. Wenn er Hunger hatte, ging er manchmal hin. Die Schwestern hatten auch nicht viel. Doch sie gaben ihm immer etwas.
Mehl war immer knapp. Großvater würde gern mehr Brot backen. Doch sein Ofen blieb oft kalt. Holz gäbe es schon genug. Oder irgendetwas anderes zum Heizen. Doch Brot ohne Mehl konnte auch Großvater nicht backen. Süßigkeiten hatte er schon lange nicht mehr gebacken. Womit auch. In den Geschichten von Großmutter war Jiro zuhause. Auch wenn das Elternhaus nicht mehr stand. Sie erzählte wunderschöne Geschichten, Märchen. Aleppo muss schön gewesen sein. Das Leben muss schön gewesen sein. Früher. Als es keinen Krieg gegeben hat.
Er hatte keine großen Träume. Nachts war es jetzt immer still. Und dunkel. Schwarze Ruinenstadt. Überall zerschossene Häuser. Oft wurde er wach in der Nacht. Kroch zu Großmutter ins Bett. Liebte ihr weißes Haar. Vielleicht sollte er sie fragen, was er sich wünschen könnte zu Weihnachten. Jiro konnte lesen und schreiben. Zumindest ein bisschen. Er konnte jetzt wieder zur Schule gehen. Es gab Container. Die Kirche war immer noch eine Ruine. Noch hatte sie keiner aufgebaut. Schnee würde es dieses Jahr wohl auch nicht geben. Großmutter erzählte ihm manchmal vom Schnee. Schnee müsste herrlich sein.
Stefan Heyer
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
21 | Frederik Mork
fern & fern
Du bist
fern und fern
und zugeknöpft
von anderen Händen
mehr als das
durchbrichst du
alles in diesem Raum
vom damals wirren Denken
bis zum wirren Denken heute
von Erinnerungen
und Äußerungen
von Fragen bis zu
ganz anderen Fragen
Du bist
fern fern
zugeknöpft
aufgeknüpft
wartest bis die Strafe
die Bestraften holt
kommst nicht
bleibst fern
vieles wartet schon
auf deinen Platz
offene Ohren und Nähe
Frederik Mork
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
20 | Kerstin Fischer
Winterfrage
Die Portraits in Öl stehen im Schnee der Stadt.
Ihre jahrhundertealten Blicke ziehen über die Graffitis der Häuserwände.
Dann lesen sie in den Weissagungen der Kälte.
Aber der Frost ist taub für jedes Gefühl. Er baut Nester in die Jacken der Obdachlosen,
bis sie winseln wie Hunde, die durch die Schatten im Rotlicht der Amsterdamer Straßen schleichen.
Die Tiere beobachten, wie es die Genitalien wund schlägt, das Licht, bei Nacht betrachtet.
Hinter den schweren Holztüren hallt indes das Gelächter der Verstorbenen.
Es macht die Gesichter bleich. Extasy ist en vogue.
Nuttenkrallen schlagen gegen die Scheiben.
Sie brechen das Eis in dem frierenden Hirn des Mannes
mit dem Muttermal über dem Auge, das er Igel nennt.
Er wirft seine schwarzen Ringe in den Rinnstein. Der Vorhang aus Filz ist geschlossen.
Die anderen warten im Eisregen.
Kerstin Fischer
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
19 | Bas Lindgaard
Mara
In der Zwischenzeit
tauchte Mara auf
und erzählte mir
von höllischen Krämpfen.
Das Ende des Tunnels
kommt immer näher
und wahrscheinlich
erreichen wir es kotzend,
auf allen Vieren kriechend.
In der Zwischenzeit
erschien Mara
und erzählte mir
von den Krämpfen,
die ihn heimsuchten
und von dem Blut,
das er geschwitzt hat.
Man sah ihm an, dass er
dem Ende des Tunnels
immer näher kam
und wahrscheinlich
erreicht er es kotzend,
auf allen Vieren kriechend.
Ich sah ihn zuletzt meditierend,
auf einer pechschwarzen Lotosblüte,
bevor das Licht ihn verschlang.
Bas Lindgaard
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: