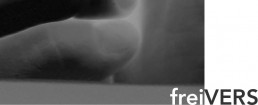freiTEXT | Kai Wieland
Schwarze Katzen
Der erste Zufall an jenem Tag war, dass der Nebel aufzog, als die Maschine ruhig über dem Hunsrück dahinglitt, und dann erschienen die endlosen Windkraftanlagen im diffusen Grau plötzlich wie Kreuze, die aus Grabhügeln ragten. Der zweite Zufall war, dass es ausgerechnet Herr Seibold war, der auf Platz 26F teilnahmslos aus dem Fenster starrte und diesen Umstand bemerkte, während er darüber nachdachte, was die Flugbegleiterin am Boden zu ihm gesagt hatte.
„Nachts sind alle Katzen schwarz“, hatte sie lachend zu ihm gesagt, nachdem er sich bei ihr nach seinem Gate erkundigt hatte. Was sollte das bedeuten? Ohnehin schon wurde er aus solchen Frauen, aus den jungen mit strahlenden, makellosen Zähnen, nur selten klug. Und wer wusste schon, worum die Gedanken einer Stewardess kreisten, wenn sie nicht in ihrem Element war, sondern erdgebunden, wie jeder andere gewöhnliche Menschenleib. Herr Seibold war Bestattungsunternehmer, weswegen er beim Anblick der Grabkreuze im kriechenden Nebel 10.000 Meter unter ihm nicht erschauderte. Allerdings war er mit seinen Gedanken auch woanders, eben noch immer bei jenen schwarzen Katzen, denn er meinte sich vage zu erinnern, dass das Sprichwort anders ging. Dennoch suchte er den Fehler bei sich selbst, er fühlte sich nicht sicher auf dem Gebiet der Redewendungen. Als Bestattungsunternehmer hatte er vorsichtig zu sein, mit einer Bemerkung wie „Wer anderen eine Grube gräbt …“ konnte man eine Lawine lostreten. Die meisten Menschen erwarteten, und das mit jedem Recht, wie Herr Seibold einsah, vollkommene Humorlosigkeit von dem, der ihre Angehörigen unter die Erde brachte. Und doch, gab es in seinem Beruf etwa nicht das morbide Pendant zur lachhaften Kundenbeschwerde oder zum hypochondrischen Patienten? Herr Seibold war Profi in einer von Profis dominierten Branche.
Die dritte Zufall war im Grunde nicht besonders erstaunlich, aber doch erstaunlicher als die beiden zuvor. Was ist auch bemerkenswert an etwas Nebel im Hunsrück oder an einem Bestattungsunternehmer, der Kreuze sieht und über Katzen nachdenkt, über Katzen, so schwarz wie die Nacht.
Frau Schell, die vor Gate 55 mit geübt dahinhuschenden Fingern ihre Uniform richtete, nahm ihn kaum wahr. Sie konzentrierte sich auf die Glattheit ihrer Zähne, wenn sie mit der Zunge darüberfuhr, so wie immer, kurz bevor sie eine Maschine betrat. Über schwarze Katzen, oder über Katzen ganz gleich welcher Couleur, dachte Frau Schell eigentlich selten nach. Trotzdem war sie sensibel, was Farben anging. Sie verlor schnell die Geduld mit dem Mann im dunklen Anzug, und mit der hektisch Art, wie er seine Jackett- und Hosentaschen nach dem Ticket abtastete und sie dabei nach dem Weg fragte, unsicher, an welches Gate er überhaupt musste. Was die Menschen an Flughäfen so nervös machte, würde sie nie verstehen. Wo konnte man in solchen Zeiten sicherer sein als an Gate 55, zwischen Palma de Mallorca und Düsseldorf, zwischen Charles de Gaulle und José Martí. Wo sonst wusste man so genau, wohin ein jeder ging, und konnte so gleichgültig sein gegenüber der Frage, woher er kam? Sie mochte Flughäfen, war beinahe lieber dort, als an Bord einer Maschine. Und aus verschiedenen Gründen waren ihr Passagiere auch lieber als Menschen.
Anders als Frau Schell gehörte Herr Seibold zu jenen, die man schon vergaß, während man ihnen noch den Weg erklärte. An seinem äußeren Erscheinungsbild gab es nur zwei hervorstechende Merkmale, die einander jedoch neutralisierten. Seine enormen Segelohren wurden gemildert durch einen ungewöhnlich buschigen Backenbart, der in Herrn Seibolds ansonsten recht langweiligem Gesicht eine nicht weniger langweilige Symmetrie herstellte. Fast immer, wenn er mit Fremden sprach, schlug ihm eine untergründige Geringschätzung entgegen, die er fatalerweise seinem fehlenden Charisma zurechnete. Hätte sich Herr Seibold öfter rasiert und im Winter ein Stirnband getragen … er war gewiss kein faszinierender Redner, aber mit Anekdoten aus seinem Beruf hätte er die Leute durchaus faszinieren können. Natürlich verwehrte ihm das sein Berufsethos und die Angst davor, aus einem blöden Zufall heraus einen Angehörigen vor sich zu haben. Das konnte selbst einem Profi passieren.
Der dritte Zufall an diesem Tag war, dass Herr Seibold und Frau Schell sich an Bord derselben Maschine befanden, als diese über den Hunsrück schwebte und ihren Schatten auf die sich drehenden Kreuze am Boden warf wie eine verirrte Wolke.
Angesichts der Tatsache, dass Frau Schell als Bordbegleiterin arbeitete und Herr Seibold die Dienste ihrer Fluggesellschaft in Anspruch nahm, ist dieser Zufall also kein ganz und gar unglaublicher. Alltäglich war die Geschichte aber auch nicht, und Herr Seibold nahm sich vor, sie als unverfängliche Anekdote im Hinterkopf zu behalten.
Er bemerkte das bekannte Gesicht erst, als es ihm ohne ein Zeichen des Wiedererkennens, aber mit freundlicher Miene einen Kaffee anbot. Bei der Sicherheitseinweisung hatte er aus dem Fenster gesehen und die Männer in den gelben Jacken beobachtet, fasziniert von ihren unsichtbar koordinierten Bewegungen und Handlungen. Er erwartete nicht, an diesem Tag zu sterben, und er sollte Recht behalten.
„Milch und Zucker dazu?“. Ihre Stimme klang warm und freundlich, ganz anders als noch am Boden.
„Nein, danke. Ich trinke ihn … nein, danke!“
Er blickte ihr über die Schulter nach, und er fand, sie machte ihre Sache sehr routiniert. Eine ältere Dame mit kurzem grauem Haar schüttelte einige Reihen hinter ihm über ein zerknicktes Taschenbuch hinweg missbilligend den Kopf, und so drehte sich Herr Seibold eilig um und sah wieder aus dem Fenster. Noch immer überzog eine zähe graue Masse das Land.
Herr Seibold fühlte sich unwohl. Er hatte aus Nervosität vor dem Abflug zu viel gegessen, und er war nicht sicher, ob seine Hotelreservierung gültig war, denn eine Bestätigung hatte er nicht erhalten. Man müsse Urlaub machen, hatten seine Mitarbeiter gemeint, einen Tapetenwechsel brauche man von Zeit zu Zeit, und London sei eine Reise wert. Und wie so oft in seinem Leben setzte er den erstbesten Vorschlag exakt um, ohne eigene Bedürfnisse und ohne im eigentlichen Sinne überzeugt davon zu sein. Er hätte sich ebenso viel und ebenso wenig davon versprochen, nach Paris, Stockholm oder Podgorica zu fliegen. Nachts sind alle Katzen schwarz. Seine Stirn lag in tiefen Falten, als sich Frau Schell erneut an ihn wandte, um ihm einen Snack zu reichen. Ihm fiel erstmals auf, wie müde die junge Frau wirkte. Er bemerkte es nicht an ihrem Gesicht, das wie eh und je professionelle Frische ausstrahlte, sondern an der Art und Weise, wie sie sich bückte, um ihm das Käsecroissant über seine beiden Nebensitzer hinüberzureichen. Und dann war da noch der Ausdruck in ihren grauen Augen, die sich in den seinen lethargisch zu verlieren schienen, schlafwandelnd, gleichgültig.
Frau Schell hatte ein schlechtes Gedächtnis für Gesichter, was in ihrem Beruf, in dem sie sehr vielen Menschen begegnete, gewisse Vor- als auch Nachteile mit sich brachte. Herrn Seibolds größtes Problem mit seinem Beruf war, dass er die Gesichter nie wieder vergaß. Er hatte Frau Schell schon früher gesehen, es wurde ihm jäh bewusst.
„Salz und Pfeffer dazu?“
Herr Seibold war Purist. Er glaubte nicht an das Schicksal. Wenn man um die Dinge zu viel Aufhebens machte, forderte man Enttäuschungen geradezu heraus. Er beschloss, Frau Schell und ihre Katzen fortan zu ignorieren.
„Nein, vielen Dank“, erwiderte er. „Haben Sie eine Schlafmaske für mich?“
Frau Schell lächelte schwach. „Ach, wissen Sie...“
Eilig fuchtelte Herr Seibold mit einer ablehnenden Geste durch die stickige Luft. „Nicht weiter schlimm, der Flug dauert ja nicht mehr lange. Ich könnte wohl ohnehin nicht einschlafen, es ist alles so eng. So eng!“
Die junge Frau nickte freundlich und räumte wortlos seinen leeren Becher ab. Das enttäuschte Herrn Seibold, er hätte etwas mehr Schuldbewusstsein erwartet. Seiner Ansicht nach gehörte es zu den Kernaufgaben einer Stewardess, sich für die Fehler ihrer Airline zu entschuldigen. So wie er sich wieder und wieder für Dinge entschuldigen musste, die nicht in seiner Hand lagen. Er hatte damals keinen Fehler gemacht, er war Profi. Er hatte sein Beileid ausgesprochen, und die grauen Augen hatten sich geschlossen und man hatte geschwiegen, und dann war Herr Seibold an die Arbeit gegangen.
„Es tut mir Leid.“ Er hatte es ernst gemeint. Aber eigenartigerweise machte das die Menschen nur noch wütender. Auf der Bordtoilette erbrach sich eine junge Frau mit bedauernswert langen Beinen, sie erbrach sich bereits seit über einer Stunde. Er konnte sie hören, während er an seinem Kaffee schlürfte. Sie waren mittlerweile über dem offenen Meer, und es gab nichts mehr zu sehen, er sehnte die Landung herbei. Würden sich ihre Wege dann trennen? Die seinen und die von Frau Schell? Oder würde sie auch seinen Rückflug am kommenden Sonntag begleiten, und sich wieder nicht an ihn erinnern, und von den Dingen reden, als seien sie ohne Bedeutung. Er war froh, nicht mehr jung zu sein.
Beim Verlassen der Maschine schenkte Frau Schell, die mit ihren müden Augen Position am Ausgang bezogen hatte, ihm eine Miniaturtafel Schokolade. Sie tat das mit allen Passagieren, Herr Seibold wusste das. Aber dennoch spürte er eine winzige Spur Vertrautheit, als ihre weißen Zähne ihn anstrahlten, und er verharrte einen Moment und suchte in ihrem Gesicht nach einer Erwiderung des Gefühls. Aber Frau Schell hatte ihren Blick bereits abgewandt. Ihr Gesicht schenkte ihm noch Aufmerksamkeit, aber die Augen suchten bereits nach dem nächsten leeren Augenpaar in der langen Reihe hinter ihm, nach dem nächsten verschwimmenden Stück Mensch, das sich schon im selben Moment wieder zu einem blinden Fleck zu verwandeln begann.
Kai Wieland
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Safak Saricicek
kleiner abriss
1
eine zange aus stahl schmettert durch die wände der wohnung
durch die stützen
und von einer plattform spritzt ein bauarbeiter wasser
in die neuen wunden im betongehäuse, damit kein staub aufwirbelt
jedes hineinschmettern der stählernen greifer lässt beton
brocken, eisenstangen, die zwanzig oder so stockwerke der abzureißenden wohnung
hinunterstürzen
von hier, in der straßenbahn, im vorbeifahren sieht es aus wie
als ob ein gigantischer skorpion ein gigantisches haus aus sand attackiert
wenn die brocken herunterstürzen, scheinen sie aus der ferne
aus der etage zu tröpfeln, als wäre das haus ein riese, der sich zum schlafen gelegt
hatte, von den jahren ausgedörrt das aufwachen vergaß,
dessen überbleibsel es jetzt aufzuräumen gilt.
2
„ein abstruses bild“ , wirst du vielleicht sagen,
werte frau, die über mich gestolpert ist, als nutznießerin oberflächlicher affären
3
dieses haus ist die erinnerung an dich,
die es abzumontieren gilt, die maschine des abrisses ist die zeit, der wasserschlauch
- das erbarmen mit sich selbst
und auch wenn das haus, der gedanke an die zeit mit dir
entfernt ist, wird es immer wieder stehen, in meinem träumen, die träume abreißen:
das kann ich nicht.
Safak Saricicek
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Vera Hohleiter
Chungking Blues
Der Regen prasselte an die Scheibe des winzigen Fensters. Es war das einzige im Raum und so klein, dass kaum Tageslicht hereinkam. Marie hatte die Deckenbeleuchtung eingeschaltet, obwohl es erst früher Nachmittag war, denn das Halbdunkel des Zimmers deprimierte sie. Sie ging drei Schritte vom Fenster zum Bett und dann noch einmal zwei Schritte bis zur Duschecke, die eine Art Miniaturbadezimmer darstellte. Hinter der Faltwand aus Kunststoff befand sich eine Toilette, ein winziges Waschbecken und eine Handbrause. Wenn man auf der Toilette saß, stieß man mit den Knien gegen die Faltwand. Wenn man duschte, wurde die Toilette nass. Für die Duschecke zahlte Marie 50 Hongkong-Dollar extra, aber das war es ihr wert. Von Gemeinschaftsduschen hatte sie genug nach ihrer sechsmonatigen Rucksackreise durch Australien und Südostasien.
Wie ein gefangenes Tier drehte sie sich im Kreis und lief auf und ab in ihrem winzigen Zimmer im Sunflower Hotel. Es nannte sich zwar Hotel, doch eigentlich war es eher eine Pension. Durch die papierdünne Wand hörte Marie, dass Rosie, die Zimmerwirtin, nebenan eine koreanische Seifenoper ansah, in der sich eine Männerstimme und eine Frauenstimme ganz fürchterlich auf Koreanisch stritten. Rosie thronte den ganzen Tag auf dem Bett eines der Deluxe-Zimmer direkt am Eingang des Sunflower Hotels, manchmal alleine, manchmal in Begleitung ihres rund zwanzig Jahre jüngeren Ehemannes, einem Chinesen Anfang 30, den Rosie als Fernando aus Macau vorgestellt hatte. Da auch Rosies Zimmer so klein war, dass kaum andere Möbelstücke hineinpassten, saßen Rosie und Fernando auf dem Bett, tranken grünen Tee oder aßen gebratene Reisgerichte aus Pappschachteln, die aus einem der Schnellrestaurants in den unteren Stockwerken der Chungking Mansions stammten.
Der Fernseher in Rosies Zimmer lief vom frühen Morgen bis gegen Mitternacht, außer an Abenden, an denen Rosie und Fernando Tango tanzen gingen. Meist flimmerten koreanische Serien mit kantonesischen Untertiteln über den Bildschirm. Marie fragte sich, ob Rosie anhand dieser Dauerberieselung Koreanisch lernte – was ihr allerdings eher unnötig erschien, denn koreanische Touristen verirrten sich wohl kaum in das Sunflower Hotel. Sie übernachteten wahrscheinlich eher im schicken Peninsula Hotel am Hafen. Rosies Klientel bestand ausschließlich aus westlichen Backpackern, die aus allen Ecken Europas und Nordamerikas nach Hongkong gekommen waren. Amüsiert schien Rosie diese jungen Leute zu beobachten, als seien sie Figuren in einer ihrer Lieblingsserien. Sie kannte alle Gäste beim Namen und behandelte sie wie alte Freunde – nur eben wie Freunde, die für ihren Aufenthalt zahlten.
Marie sah auf die Uhr. Es war beinahe drei Uhr nachmittags. Um diese Uhrzeit hätte sie bereits am Victoria Peak sein können oder hätte durch die Straßen von Wan Chai schlendern oder mit der Fähre nach Macau fahren können – hätte ihr der Taifun nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht.
„Warum willst du überhaupt nach draußen?“ hatte Rosie gefragt, als Marie sich am Vormittag auf die Straße gewagt hatte, aber bereits nach wenigen Minuten völlig durchnässt zurückgekehrt war. „Die Chungking Mansions sind wie eine Stadt für sich. Du kannst hier drinnen ganze Tage verbringen, ohne dich zu langweilen.“
Daraufhin war Marie durch die 17 Stockwerke und die fünf Blöcke der Chungking Mansions gewandert. Sie hatte sich die Auslagen gefälschter Designerhandtaschen, bunter Satin-Cheongsams, farbenfroher Saris und wild-gemusterter afrikanischer Gewänder angesehen, ebenso wie das Angebot an billiger modischer Kleidung westlichen Stils. In einem indischen Restaurant in der 7. Etage hatte sie schließlich ein üppiges Mittagessen aus Aloo Gobi mit Reis zu sich genommen. Rosie hatte recht: die Chungking Mansions waren eine Welt für sich, aber nachdem Marie bereits fünf Stunden lang durch die schmuddeligen Gänge des Gebäudes gelaufen, mit den Aufzügen hoch- und wieder runtergefahren war, mehrmals den Kauf von gefälschten Markenuhren und Drogen aller Art abgelehnt hatte, war sie erschöpft in ihr Zimmer zurückgekehrt. Sie hatte gehofft, der Regen würde irgendwann nachlassen, aber der Taifun fegte mit nicht nachlassender Kraft über die Stadt.
Wirklich entspannen konnte sich Marie in ihrem Zimmer nicht. Die lautstarken koreanischen Fernsehauseinandersetzungen von der anderen Seite der Wand hallten durch den kleinen Raum. Ohne das Bild waren die herausgebrüllten Dialoge alles andere als interessant, sondern klangen eher unfreiwillig komisch. Ab und an wurden die Seifenopern von kantonesischen Werbespots unterbrochen oder Marie konnte Rosies und Fernandos Stimmen hören, aber nicht verstehen, worüber sie sich unterhielten.
Marie setzte sich auf ihr Bett und schaltete das winzige Fernsehgerät in ihrem Zimmer ein. Die bewegten Bilder der koreanischen Seifenoper, die Rosie und Fernando ansahen, erschienen auf ihrem Bildschirm, sodass auf einmal Bild und Ton zusammenpassten. Da Marie ohnehin nichts von der Handlung verstand, schaltete sie weiter. Sie klickte sich durch Dauerwerbesendungen, Nachrichtenprogramme und Kung-Fu-Filme. Auf einem englischsprachigen Sender blieb sie bei einer britischen Serie hängen, die in den 1920er Jahren auf dem Landsitz einer Adelsfamilie spielte. Die Damen trugen zu ihren glamourösen Abendkleidern aufwändige Hocksteckfrisuren mit Wasserwellen und diamantbesetzte Accessoires im Haar. Missmutig betrachtete Marie ihr eigenes Spiegelbild in dem kleinen Spiegel, der am Kopfende ihres Bettes hing. Sie strich über ihr strubbeliges Haar, das sie in Australien aus praktischen Gründen kurz geschnitten hatte. Je länger sie in den Spiegel sah, desto mehr zweifelte sie daran, dass diese Frisur für sie vorteilhaft war. Ihr Blick wanderte herunter und auf einmal war sie auch mit ihrem ausgeleierten T-Shirt und ihrer knöchellangen Cargohose unzufrieden. Doch ihre gesamte Reisegarderobe bestand aus alten ausgewaschenen T-Shirts und zwei unförmigen Hosen, die sie abwechselnd trug. Eigentlich hätte sie den gesamten Inhalt ihres Trekking-Rucksacks wegwerfen können. Die gammeligen Kleidungsstücke hätten nicht einmal die afrikanischen Altkleiderhändler aus dem 6. Stock mehr interessiert.
Nicht nur ihre Garderobe machte ihr schlechte Laune: das schäbige Zimmer, der Regen, ihre eigene Planlosigkeit… Sie hatte keine Ahnung, ob sie noch monatelang so weiterreisen und hier und da Gelegenheitsjob annehmen wollte, um die Reisekasse aufzubessern – oder ob sie einfach nach Hause fliegen sollte. Eigentlich wollte sie die Küste hinauf reisen, danach eine Weile in Peking bleiben und irgendwann, wenn sie genügend Fahrgeld zusammengespart hatte, sich mit der Transsibirischen Eisenbahn auf den Weg nach Moskau machen. Plötzlich schien ihr diese Idee völlig abwegig. War es nicht langsam an der Zeit für die Heimreise? War es nicht an der Zeit, sich einen richtigen Job zu suchen und erwachsen zu werden?
Marie stellte sich vor, wie es wohl war, nicht ständig umherzuziehen, sondern an einem Ort zu leben – in einem schönen Haus mit Geschirr, das zusammenpasste und schwerem Silberbesteck, in einem Haus, in dem Musik spielte und nicht Lärm von nebenan die Geräuschkulisse bildete, in einem Haus, in dem die Dielen knarrten, wenn der Hund durch den Korridor rannte. In ihrem Tagtraum war es Frühling oder Frühsommer, schon recht warm, denn die Terrassentür stand offen. Der Hund stürmte in den Garten und versuchte, einen Schmetterling zu fangen. Aus der Ferne war ein leichtes Vogelzwitschern zu hören und ein Kirschbaum im Garten stand in voller Blüte. Marie fragte sich, woher diese Bilder auf einmal kamen. Häuser mit Garten und Hunde, die Schmetterlinge jagten, hatten sie bisher nie interessiert.
Im Fernsehen tranken die Damen Tee aus zierlichen Porzellantässchen und rührten mit verschnörkelten Silberlöffelchen darin herum, bis sich der Zucker aufgelöst hatte. Für einen Augenblick überlegte sich Marie, ob sie - wenn der Regen nachließ - zum berühmten Fünf-Uhr-Tee ins Peninsula Hotel gehen sollte, um sich ein wenig aufzuheitern. Marie stellte sich vor, wie sie selbst, ähnlich wie die Damen im Fernsehen, aus einer Tasse aus hauchdünnem Porzellan Tee trinken und winzige Gebäckstücke oder akkurat geschnittene Sandwiches essen würde. Dann fiel ihr ein, dass der Nachmittagstee im Peninsula teurer war als eine Übernachtung im Sunflower Hotel und dass man sie, schlampig gekleidet wie sie war, vermutlich sowieso nicht hineinlassen würde.
Mürrisch schaltete sie den Fernseher aus. Die einzigen Geräusche, die sie jetzt noch hören konnte, waren der Regen, der immer noch mit unverminderter Intensität an die Fensterscheibe trommelte, und die koreanischen Dialogfetzen aus Rosies Zimmer. Im Kopf rechnete Marie ihr Reisebudget durch. Es reichte noch für ein paar Tage in Hongkong und für eine Zugfahrkarte nach Xiamen, wo es – nach Angaben einer niederländischen Rucksacktouristin, mit der sie sich im Flugzeug unterhalten hatte – ganz einfach sein sollte, in einer Nachhilfeschule einen Job als Sprachlehrerin zu finden. Marie überlegte sich, ob sie zurück ins Erdgeschoss der Chungking Mansions gehen und sich mit ein paar Sommerkleidern aus billigen bunten Synthetikstoffen neu einkleiden sollte. Vielleicht würde sie sich dann besser fühlen. Sie zählte die Hongkong-Dollar in ihrer Reisekasse.
Plötzlich verstummte das Fernsehgerät auf der anderen Seite der Wand und Rosie rief: „Marie, möchtest du vielleicht eine Tasse Tee?“
Vera Hohleiter
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Anne Büttner
Carrera
Bemüht, ihr zu gefallen,
gefiel ich besser als bemüht.
Bis du mich ihr schließlich überlassen hast;
Mich abgeschoben hast an sie.
Dorthin, wo ich nie sein wollte:
weg von dir.
Keine Chance zu schlingern oder anzuecken;
keine Hoffnung auf Disqualifikation.
Wie auch? Du hattest vorgesorgt:
Mich erst, als die Kurven begradigt,
die Unebenheiten beseitigt waren,
in ihre eingefahrene Spur gesetzt,
die mich sogleich erbarmungslos hielt;
mich des Vergnügens beraubte,
aus der Bahn zu schleudern.
Kein Gegenverkehr, keine Hindernisse,
kein Ende, kein Du in Sicht.
Dich hast du aus dem Rennen genommen -
Motorschaden.
Anne Büttner
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Stefan Heyer
Innere und äußere Mongolei
Die U-Bahnhöfe mied Karl zumeist. Lieber raus aus dem Mief, raus aus der Stadt, zumindest zum Wannsee. Oder gleich bis zur Ostsee. In seinen Träumen fuhr er über weite Steppen. Wurde zum Mongolen. Über die unendliche Weite. Tagelang keine Seele zu sehen. War in Berlin schwierig. Berlin war voll. Auch voller Touristen. Immer wieder ein Rucksack im Genick. Lärm machten sie auch noch. Wollte das Dorf in der Großstadt. Nah zur Arbeit. Cooles Ambiente. Lässige Altbauwohnung. Renoviert. Man war ja älter geworden. Man war ja längst kein Punk mehr. Ohrringe längst rausgemacht. Wohnte in Mitte. Nicht weit zur Politik. War jetzt Beamter geworden. War einfach sicherer. Er musste ja auch an die Zukunft denken. Nomade sein in der Mongolei. Wenn er nachts schlaflos lag. Die Fenster offen. Vom Innenhof die kühle Luft reinkam. In einer Jurte leben. Umherziehen. Unter freiem Himmel schlafen. Morgens ging er immer ins Ministerium. Lässiger Anzug. War nur eine kleine Nummer. Manchmal durfte er für den Chef Reden schreiben. Neulich hatte er sich einen Bart wachsen lassen. Über die Feiertage angefangen. Nein, nicht wie Dschingis Kahn. Für einen Hipster-Bart war er zu kurz. Und zu licht. Sein Chef hatte seltsam geschaut. Ein paar Tage später hatte er ihn abrasiert. Seine Freundin mochte ihn auch nicht. Wenn er nicht einschlafen konnte, lag er oft lang auf dem Bett und träumte. Oder setzte sich auf den Balkon. Sternenhimmel. Als wäre er in der Steppe. Um ihn herum Yaks. Der Wind erzählte von der Steppe. Morgen würde ein anstrengender Tag werden. Manchmal traf man Mongolen in Berlin.
Stefan Heyer
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Susanne Rzymbowski
Wie malt die Welt
in Farben sich
mit Pinsels Strich
der in Erinnrung bleibt
aus einer Hand
die unverzagt
im Greifen puren Seins
das losgelöst
von Sinn und Wort
der Freiheit ist entstammt
so schön der Akt
des glücklich seins
als Kind bist du geboren
Susanne Rzymbowski
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Robin Krick
Das Geständnis
Seit die Dienstvorschriften geändert wurden, dürfen wir die Hauptverdächtigen nicht mehr aufs Revier holen, um ihnen durch Schläge und Anbrüllen das Geständnis zu entringen. Unser Dienstherr ist neuerdings der Ansicht, dass es schädlich sei, die Verdächtigen zu beeinflussen. Der Wahrheit – so drückte er sich aus – müsse Gelegenheit verschafft werden, ganz von selbst durch den Mund des Delinquenten ans Licht zu kommen. Meine Arbeit beschränkt sich jetzt darauf, bloß dazusitzen, abzuwarten und im entscheidenden Moment alles zu notieren. Inzwischen bin ich täglich in der ganzen Stadt zu Hausbesuchen unterwegs, wobei mich das Unterwegssein an sich nicht stört, vor allem, wenn ich an die trübsinnigen Stunden im Büro denke. Dennoch steige ich nur widerwillig in den Dienstwagen. Ich erfahre erst jetzt wieder bei meinem neuesten Fall, wie nutzlos meine Arbeit doch geworden ist: Drei Stunden lang saß ich dem Delinquenten mit dem Notizblock in der Hand auf dem Sofa gegenüber und alles, was er von sich gab, waren schwache Seufzer, ein dumpfes Schluchzen und ein gelegentliches Hochziehen der Nase. Dann hatte er auch noch begonnen, sich mit dieser Orange zu beschäftigen. Wohl eine halbe Stunde lang musste ich mitansehen, wie er sinnlos und selbstvergessen daran herumschabte, ohne auch nur die Schale vom Fleisch zu lösen. Peinlich war es, zu beobachten, wie er sich dabei mit dem Handrücken immer wieder über den offenen Mund fuhr, um den Speichel abzuwischen. Es geschah wohl aus einem kurzen Moment der Schwäche heraus, dass ich mich plötzlich über den Couchtisch beugte und ihm den Dienstausweis drohend vors Gesicht hielt. Es fehlte nicht viel, und ich hätte ihn auch noch beim Kragen gepackt, aber dann dachte ich wieder daran, dass ich mir ja vorgenommen hatte, mich unbedingt und so streng wie nur eben möglich an die neuen Vorschriften zu halten, um so dem Dienstherrn endlich ihren Unsinn zu offenzulegen. Ich ging ans Fenster und streckte den Kopf hinaus in die Dämmerung. Von der Stadt her drang ein dumpfes Trommeln und Wummern durch die Luft. Unten auf dem Gehsteig sah ich einen Mann in Tarnkleidung gehen. Er hatte sich das Gesicht schwarz angemalt und stach mit einem langen Messer auf die Mülltonnen am Straßenrand ein. Potthoff, mein Assistent, drängte sich zu mir ans Fenster und flüsterte mir irgendetwas Unverständliches zu. Zu allem Übel hatten sie mir den nervösen Potthoff an die Seite gestellt. Ich hatte gleich gewusst, dass es ihm niemals möglich wäre, sich auch nur zum Schein an die Vorschriften zu halten, daher hatte ich ihn angewiesen, während des Verhörs bei der Wohnungstür zu warten und meinen Mantel bereitzuhalten. Ausgerechnet in diesem Augenblick musste er die Nerven verlieren. Er wollte gar nicht mehr aufhören, an meinem Ärmel zu zupfen, und als ich ihn beiseite stieß, wagte er es auch noch, sich zu widersetzen. Um ihn nur irgendwie abzulenken, machte ich ihn auf den Mann unten auf der Straße aufmerksam, der womöglich ein Mörder war, aber Potthoff fasste es ganz falsch auf, dass ich mit dem Finger hinaus auf die Straße deutete, und dann geschah es, dass der dumme Potthoff einfach aus dem Fenster sprang. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.
Robin Krick
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Viktor Dallmann
jetzt staunst du
viel zu viele trapeze sind dächer jetzt resurrected
die gesichter als abteilung einer schwäche haben
für landmaschinen tiefkobalt das klebende endgültige
scheitern von hosentaschen
paragraphen berühren wie mal geliebte kinder
mein bienenschwarm ein bloßes lager für schalen
windstille calm and tasty wipfeln wir auf drei
die bäume können noch lernen wir steigen
trapeze über das spechtgebiet weil es
so geil bröselt eine schwebezeit eine
letzte wendung unter dem mond
deines löwenanteils
Viktor Dallmann
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiVERS | Matthias Engels
durch die wand
du sagst: Herrgottnochmal
der sommer war sehr klein
und der herbst nicht mehr
lassen wir den winter nicht rein
und hoffen dass er draußen
nichts anstellt
du sagst man sieht
der dunkelheit nicht ihr alter an
und keiner kennt den namen
den der schwarze vogel gerade tanzt
du knipst den raum aus
um uns
die bäume die häuser
das rauschen
du sagst: ich bin ein freies land
klickst den wässrigen mond weg
und jeden einzelnen
immer wieder aufpoppenden stern
wir kippen das mondtrübe wasser weg
und trinken schwarzen wein
blinkenden blickes steht
mein sehkrankes auge
auf stand by
du sagst:
dein traum muss durch die wand
durch das loch das geformt ist
wie die wirklichkeit du sagst:
die besten gedichte sind immer jene
die man sofort wieder vergessen kann
Matthias Engels
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Slata Roschal
Ich dachte, dass ich die Stadt verschlingen werde, sie austrinken werde, all ihre Geschäfte, riesige Werbeplakate, endlose, ineinander verwickelte Straßen, das Wirrwarr bunter Gesichter, das Chaos von Babylon, aber sie war es, die Stadt, die mich verschlang. Ich reiste mit einer Tasche an und kehrte mit dreien zurück, ich wollte auf dem Bahnhof Unterwäsche, Pralinendosen, Sushi kaufen, und trug stattdessen sieben antiquarische Bücher und reduzierte Schokolade zweiter Wahl davon. Am ersten Tag nahm ich zwei Kopfschmerztabletten und überlebte bis zum Abend, am zweiten Tag brach ich auf der Straße samt meiner Taschen zusammen und übergab mich. Dann lag ich auf dem Bett eines Bekannten, der mich aufnahm, wälzte mich hin und her und überlegte, was ich falsch gemacht haben könnte, warum mein Körper die Stadt nicht annahm, meine Blutgefäße, meine Schläfen, mein Magen, meine zitternden Hände, sie protestierten gegen die Stadt. Die Stadt war nicht für Menschen wie mich geschaffen, sie war von Menschen gemacht, die kräftige Mägen, starke Hände und breite Schädel hatten, ich war ein Fremder, ein Ausstädter, eine kurzsichtige verwirrte Person vor dem Anzeigentableau der Bahnhofshalle. Ich freute mich zunächst auf die Stadt, wie Rotkäppchen auf ihre Großmutter, ein kleiner Ausflug, eine willkommene Abwechslung, aber der Weg wird lang und immer länger und anstelle der Großmutter liegt ein böser Wolf im Bett und Rotkäppchen läuft wieder zurück nach Hause. Der Wolf ist spannend, eine willkommene Abwechslung, mit ihm könnte man so viel Spannendes machen, sich zu ihm ins Bett legen, den Wein öffnen, seinen Geschichten vom Leben im Wald lauschen, aber Rotkäppchen und der Wolf, das kann nicht gut gehen. So stehe ich auf dem Bürgersteig einer kilometerlangen Straße, stelle mich mit dem Gesicht zur Wand eines Wohnhauses und übergebe mich. Eine phantastische Stadt, die altmodischen Vitrinen, antiquarische Läden, alternative Cafes, vegane Pizzas, türkische Obstläden, vietnamesische Schneidereien, verhüllte Frauen, ich möchte ihnen hinterherrennen und in ihr Gesicht schauen, so schöne Gesichter, so schöne Augen, diese schwarze Ungewissheit über ihren Hüften, sie laufen ihren Männern hinterher, ich laufe ihnen hinterher und verirre mich endgültig, was will ich von ihnen, wo bin ich, wohin will ich. Ich übergebe mich mit dem Gesicht zur Wand, die Stadt wirkt eigentümlich, kaum habe ich sie erfasst, presst sie mich aus und schlägt meinen Kopf gegen die Haustür. Mir ist schlecht, sage ich, mir ist übel, ich kann hier nicht schlafen, ich habe zwei Tage nicht geschlafen, wie soll ich weiterleben, wenn ich nicht schlafen kann, hier möchte ich begraben werden, genau hier, neben dieser Ampel.
Slata Roschal
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at