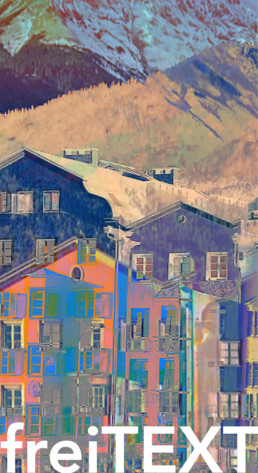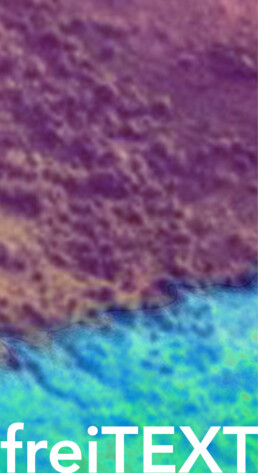freiTEXT | Robin Dietz
Heute gehe ich nicht mehr ans Meer
Über das Cap Martin wurde schon viel geschrieben, denke ich mir manchmal. Und es stimmt, es ist einfach das Kap, an dem die schönste Bucht mit dem schönsten Meer der Welt zusammentrifft. Aber scheinbar hat niemand sich die Zeit genommen, so richtig hinzuschauen. Die Rede von den brandenden Wellen und der türkisfarbenen See stimmt vielleicht, sie taugt aber doch gar nichts. Jetzt hat die Sonne ihren Zenit bereits erreicht und es beginnt das, was ich die magische Zeit nenne. Es ist, als würden die Sterne im Wasser liegen, tausende Sterne, die von einer Sekunde auf die andere verglühen und Platz machen für ihre Brüder und Schwestern. Und die Wellen legen abwechselnd den Blick auf sie frei und verstellen ihn wieder und legen ihn frei, verstellen und legen ihn frei. Wie Edelsteine glitzert das Meer, ein funkelndes, lautloses Feuerwerk, das keinen Nachthimmel mehr braucht. Man kann das von überall hier beobachten und es sieht doch niemand hin. Dabei hat in dieser Zwischenzeit das Wasser mehr zu sagen als alles andere in der Welt. Aber niemand hört zu. Von meinem Balkon aus kann ich die Menschen unten am Strand sehen. Sie sind ungefähr so groß wie die Hälfte meines kleinen Fingers, wahrscheinlich sogar noch kleiner. Mittlerweile ist mein Blick auch ohne Fernglas so geschärft, dass ich genau erkennen kann, ob sie zu lange in der Sonne waren. Claude steht da unten. Es muss Claude sein. Auch wenn es ungewöhnlich ist, dass er am Meer steht. Ich erkenne ihn an seiner Körperhaltung. Für gewöhnlich sitzt er nur auf seinem faltbaren Strandstuhl und schaut in ein Buch. Ob er wirklich liest, frage ich mich manchmal und wozu überhaupt. Claude sagt, er lese Romane, und ich frage mich, wozu überhaupt. Aber es ist Claude dort unten. Ich erkenne ihn an seiner Badehose, wobei viele Leute diese Badehose haben. Claude trägt gerne, was viele Leute tragen. Aber seine Badehose ist alt, sehr alt, so alt wie seine Socken, die nicht gut gewaschen sind. Was ihn angetrieben hat, ans Meer zu gehen? Ich gehe heute nicht mehr ans Meer. Man hat auch einen herrlichen Blick vom Parkplatzdeck aus. Man überblickt das Kap und sieht bis nach Monaco, sieht die großen Häuser, die nicht bewohnt sind, die Briefkastenfirmen, sieht die Schiffe, die vor den Bojen ankern und am Abend wieder verschwinden, sieht, wie grün das Kap trotz der vielen Häuser immer noch ist. Aber man muss nicht erst aufs Parkdeck. Von meinem Balkon ist der Blick auch wunderschön. Wenn man in der Bucht schwimmt, bis zu den Bojen, dann hat man das Meer für sich allein. Hier kommt niemand hin und die Leute auf den Yachten gucken doch nur auf ihre Teller. Und die Leute am Strand reiben sich doch nur ihre Schultern aneinander. Oder sie stehen bloß im Wasser herum oder schwimmen mal für gerade einmal hundert Meter raus. Ich habe diese Leute nie begreifen können, wie ich die Leute auf den Yachten nie habe begreifen können. Sie schippern in unsere Bucht mit ihren riesigen Yachten, und in unsere Bucht geschippert, steigen sie plötzlich aus ihren Yachten heraus und steigen auf, steigen wie selbstverständlich auf ihre kleinen Jetskis und fahren bis zum Abend mit ihren kleinen Jetskis um ihre riesige Yacht herum und steigen dann wieder auf ihre riesige Yacht und fahren in die nächste Bucht, um gleich wieder auf ihre winzigen Jetskis zu steigen. Die belgische Königsfamilie soll ein Haus hier besitzen, Coco Chanel hat hier gewohnt und der Diktator Sese Seko Mobutu. Das ist nur schwer zu begreifen. Auch Winston Churchill wusste die Bucht zu schätzen. Heute zieren Tafeln für die Touristen den Wanderweg nach Menton. Auf jeder Tafel stehen ein paar Dinge drauf, was sie mit einem Zitat von Churchill aufgehübscht haben, damit der Wandernde weiß, was er über die Landschaft denken soll. Die Superreichen brauchen natürlich nicht an den Strand der gewöhnlichen Reichen. Es ist ihnen da auch einfach zu voll und unbehaglich mit den gewöhnlichen Reichen, deshalb baden sie lieber unter Aufsicht vor dem eigenen Grundstück. Da sitzt ihnen auch keiner auf ihrem Lieblingsquadratmeter, da können sie ganz beruhigt sein, wenn das Champagnerfrühstück mal wieder länger gedauert hat. Wenn ich an meine Boje schwimme und auf die Bucht schaue, sehe ich immer sofort die Casa del Mare und kann es doch wieder nicht glauben. Sie haben sie direkt am Strand gebaut und gleich auch noch so lang wie den Strand selbst haben sie die Casa del Mare gebaut. Nur einen kleinen Platz haben sie für die Strandbesucher gelassen, die sich auf einer schmalen Treppe links des Palastes hinunterschlängeln, um sich ins Wasser stellen zu können. Ein kleines Restaurant liegt neben der Villa, aber dort gehe ich niemals hin, die Leute sind dort einfach zu unfreundlich, denke ich. In diesem Prachtbau aber, der den größten Teil des Strandes ausmacht, wohnt Alexander Mashkevitch. Zumindest gehört ihm dieses Schloss. Er wohnt auf seiner Lady Lara. Zumindest gehört ihm diese Luxusyacht. Er ist schon immer auch manchmal zwischen ein paar dubiosen Geschäften bereits braun gebrannt und mit gemachtem Lächeln in seine Villa gekommen. Mit seiner Lady Lara ist er angekommen oder gleich mit seinem Helikopter auf der Villa gelandet. Jetzt ist er schon ein paar Jahre nicht mehr hier gewesen. Ich mache mir Sorgen um ihn. Manchmal schaue ich dann in meiner App nach, wo Lady Lara ankert. Aber ob Mashkevitch sich auf ihr aufhält, das weiß ich dann ja auch nicht. Dieses Jahr hat er zum ersten Mal seinen Pool nicht mit Wasser füllen lassen. Von meiner Wohnung kann ich das genau beobachten. Mashkevitch respektiert unser Wasserproblem. Nur sein Gärtner dekoriert den Pool mit schnell abblühenden Pflanzen, um ihn dann gleich wieder mit schnell abblühenden Pflanzen zu dekorieren und sein Gärtner gießt den Garten so ausgiebig, als würde er jeden Tag den Pool aufs Neue befüllen. Aber Mashkevitch hat wegen unseres Wasserproblems angeordnet, seinen Pool nicht zu befüllen. Und alle anderen Pools der Gegend sind bis zum Rand gefüllt, aber außer in unserem Pool schwimmt niemals jemand und ich denke unweigerlich, dass Mashkevitch vielleicht der viel kleinere Verbrecher ist. Wenn ich an meine Boje geschwommen bin, denke ich an alle Verbrecher hier und schaue immer gleich auf die Prachtvilla und kann es immer noch nicht glauben. Ich sehe die steinernen und zum Teil efeubewachsenen Mauern und den gebändigten Garten der wilden Kapflora mit seinen tropischen Palmen, knorrigen Olivenbäumen und immergrünen Nadelbäumen. Und kann es nicht glauben. Und dann schaue ich immer weiter nach rechts, wo Le Corbusier hinter Eileen Grays moderner Villa einfach seine Hütte gestellt hat. Nur eine kleine Hütte hat der Corbusier dahingestellt, einen winzigen Holzbau, den er da der Casa Del Mare entgegengesetzt hat, ein Minimalhaus am Meer neben das Maximalhaus am Meer hat er einfach dahingestellt und dann hat der Corbusier das kleine Ding einfach sein Schloss genannt, um der Casa Del Mare etwas entgegenzusetzen. Die kleinen dreisechsundsechzig auf dreisechsundsechzig neben dem strandlangen vier Hektar großen Grundstück, das kann ich bis heute nicht glauben und gucke immer hin und her zwischen den Bauten, wenn ich zu meiner Boje geschwommen bin. Und manchmal denke ich mir, schon längst an meine Boje geschwommen, das winzige Holzhaus unter der Erde sei mit den Wurzeln der Bäume verbunden und die Casa Del Mare, das riesige Schloss, verdränge mit seinem gigantischen Fundament die Wurzeln der Bäume. Eine Villa mit 15 Zimmern gegen eine begehbare Spirale, denke ich mir manchmal. Es ist ein Witz, der in der Landschaft steht und alle gucken hin, aber keiner lacht, denke ich mir manchmal, an meine Boje geschwommen. Und an meine Boje geschwommen, denke ich mir, was ist schon der Unterschied, wenn Eileen Gray eigenhändig den Maultieren zuguckt, wie sie die Bauteile runterschaffen und Le Corbusier eigenhändig die Bauteile auf Korsica herstellen und per Schiff anliefern lässt und Mashkevitch einfach in das fertige Schloss am Strand zieht? Was ist schon der Unterschied, denke ich mir manchmal bei meiner Boje. Sie alle nehmen sich hier etwas raus und verbrechen hier aber ganz gewaltig etwas, denke ich mir dann, an meine Boje geschwommen, sie alle glauben, sie könnten sich das einfach so erlauben. Und dann schaue ich mir lieber, an meine Boje geschwommen, die Bucht an, ich überblicke ganz einfach meine Bucht. Und so oft ich die Bucht auch überblicke, immer wieder mache ich Halt bei der Höhenburg auf dem höchsten Punkt der Gemeinde und gucke mir schon auch die Höhenburg einmal an und denke mir, da steht sie ja noch auf dem höchsten Punkt der Gemeinde und denke mir, dass sie ihren mittelalterlichen Charakter ja noch bewahrt hat, wie sie da noch so steht. Und wie oft habe ich, an meine Boje geschwommen, schon die Häuser in der Bucht gezählt? Es sind genau eintausendvierhundertzweiunddreißig Häuser. Zumindest zählte ich am häufigsten bis eintausendvierhundertzweiunddreißig und dachte, ich hätte nun alle Häuser in der Bucht gezählt. Aber am zweithäufigsten zählte ich eintausendvierhunderteinundvierzig Häuser und dachte, ich hätte alle Häuser in der Bucht gezählt. Das ist ein Unterschied von neun Häusern, denke ich mir manchmal, an meine Boje geschwommen, und frage mich, wie es sein kann, dass sich ein solch großer Unterschied ergibt. Ich habe auch oft schon deutlich weniger Häuser und oft auch schon mal deutlich mehr Häuser in der Bucht gezählt, am häufigsten aber bin ich auf eintausendvierhunderteinundvierzig und eintausendvierhundertzweiunddreißig Häuser gekommen. Ich kann das kaum glauben, denke ich, an meine Boje geschwommen, und muss dann immer zusehen, dass ich wieder an Land komme, weil mir die Lippen über das Zählen schon wieder ganz blau geworden sind. Aber heute schwimme ich nicht mehr an meine Boje und ans Meer gehe ich auch nicht. Sie haben wegen des Wasserproblems ja auch die Duschen am Strand abmontiert. Es regnet einfach zu wenig. Und wenn ich eine kostenlose Dusche will, dann muss ich an den Pool. Der Pool ist eine Annehmlichkeit, der nur den Bewohnern hier zuteilwird. Hohe Mauern und dicke Stahltüren schützen uns Bewohner vor Eindringlingen und der Hausmeister sieht zu, dass es immer schön aufgeräumt ist, wenn wir ein bisschen im Pool planschen wollen. Claude muss seine Gewohnheiten geändert haben, sonst würde er jetzt ja nicht am Meer stehen. Montags und dienstags geht er für gewöhnlich morgens an den Pool und nachmittags ans Meer. Er sagt, der Pool sei dann am schönsten, weil er den Pool montags und dienstags am Vormittag für sich allein habe. Aber jetzt steht er ja am Meer und schwimmt doch wieder nicht. Am Meer sitzt Claude eigentlich nur auf seinem faltbaren Strandstuhl im Schatten und liest und sagt, so sei es auszuhalten. Und am Pool schwimmt Claude auch nie. Er liegt dann auf seiner Liege am Pool und liest und sagt, so sei es auszuhalten. Und ich denke mir immer, das ist doch kaum auszuhalten. Und ob er wirklich liest, frage ich mich manchmal und wozu überhaupt. Und wenn er sich vollgelesen hat, dann nimmt er noch eine kostenlose Dusche am Pool, so als ob er sich das Gelesene gleich wieder abwaschen wolle. Wenn Claude am Pool steht, dann erkenne ich ihn immer schon an seiner Körperhaltung. Claude steht aber niemals am Pool und eigentlich steht er auch nie am Meer. Am Meer sitzt er nur auf seinem faltbaren Strandstuhl. Und am Pool liegt er nur auf seiner Liege und hat ein Buch in der Hand und die alte Badehose an. Daran erkenne ich ihn. Ich denke, er will einfach nur seine Ruhe haben und liest überhaupt nicht. So entgeht er der Gefahr, in ein Gespräch verwickelt zu werden. Er guckt dann in seiner Liege am Pool liegend besonders intensiv in das Buch, so als würde er gedanklich nur schwer folgen können. Er nimmt das in Kauf, denke ich, weil er nicht in ein Gespräch verwickelt werden will. Aber die Leute am Pool sind schamlos und unfreundlich. Sie sehen ja selbst, wie intensiv Claude in das Buch guckt und wie schwer es ihm fällt, so intensiv ins Buch zu gucken und sie tun trotzdem ganz interessiert daran, wie Claude das Wetter findet. Wie soll Claude denn das Wetter finden, denke ich mir, das Wetter hier ist immer herrlich. Oder sie fragen Claude tatsächlich, was er denn liest, so als ob es sie wirklich interessiert. Die Leute hier sind einfach schamlos und unfreundlich. Der Pool ist eine Annehmlichkeit für die Leute, die nicht mehr ans Meer können, weil das Meer und ihre Wohnung von vielen Treppen getrennt sind. Sie können die Treppen nicht mehr laufen, denken die Leute am Pool. Das kann eigentlich gar nicht sein, weil das Meer so unendlich schön ist und ob man kann oder nicht, das Meer zieht einen runter. Sogar Claude steht ja am Meer und hat die Treppen überwunden. Früher war Claude immer wandern. Das war seine Leidenschaft. Anders als seine Lust zu Romanen habe ich Claude seine Lust auf das Wandern immer abgenommen. Er ist nicht einfach zum Wandern gegangen, um vor den Leuten am Meer und von den Leuten am Pool zu fliehen. Seine Lust auf das Wandern war eine aufrichtige Lust. Da hat sich Claude seine Nüsse genommen und ein Stück Käse und ein Stück Brot und Datteln und ist zum Wandern und ist mit seinem Wandern seiner aufrichtigen Lust nachgegangen. Aber jetzt geht Claude nicht mehr zum Wandern, weil er sich beide Knie kaputtgewandert hat. Aber am Meer steht er heute doch mit seinen kaputtgewanderten Knien, weil das Meer hier so unendlich schön ist, nimmt Claude die Treppen mit seinen kaputtgewanderten Knien unendlich leicht, denke ich mir. Der Pool hier ist den Leuten eine Annehmlichkeit. Von hier können sie aufs Meer schauen und sich überlegen, ob sie vielleicht doch noch nach unten ans Meer gehen, ob sie es doch noch ans Meer schaffen können. Ein paar Treppen haben sie ja schon von ihrer Wohnung zum Pool hinter sich gebracht. Ich gehe heute nicht mehr an den Pool. Auch wenn der Pool mir eine Annehmlichkeit bedeutet, weil ich dort eine kostenlose Dusche bekomme. Eigentlich sitzen die Leute bloß am Pool oder stehen im Pool. Die Leute, die am Pool sitzen oder im Pool stehen sind eigentlich nur Fossilien. Sie sind eigentlich nichts anderes als Zeugnisse vergangenen Lebens, wie der dicke Mann, der seit Jahren von seiner Frau in den Pool gehievt wird und da steht er dann stundenlang im Pool und hat den Mund offen und seit Jahren hat er dort am Pool stundenlang stehend seinen Schaum an den Mundwinkeln hängen und kriegt den Mund nicht mehr zu, bis seine Frau sich erbarmt und ihm den Mund zuklappt und ihn aus dem Pool hievt. Und seine Frau sitzt auf einer Liege am Pool und findet ein Haar, sehe ich durch das Fernglas, und während ihr Mann stundenlang im Pool mit schäumendem Mund die schäumenden Wellen am Meer imitiert, nimmt sie das Haar herbei und versucht es stundenlang zu spalten, sehe ich durch das Fernglas und wie sie das Haar stundenlang zu spalten versucht, gelingt es ihr irgendwann doch und erst dann, wenn sie das Haar gespalten hat, klappt sie ihren Mann zu und hievt ihn aus dem Pool. Und Claude muss das alles mitansehen, denke ich mir manchmal und er versucht, in sein Buch zu schauen. Wenn man an den Pool kommt, dann stürzen sich die Leute gleich auf einen und fragen nach dem Wetter und wie man es findet und wie soll man das Wetter finden. Das Wetter hier ist immer herrlich. Und die Leute sagen das auch. Die Leute am Pool sagen, das Wetter hier ist immer herrlich, sagen sie und dass es darüber nichts zu reden gäbe, weil es so herrlich ist, und dann reden sie stundenlang doch wieder über das Wetter. Der Pool ist für mich eine Unannehmlichkeit, wenn ich eine kostenlose Dusche brauche. Brauche ich eine kostenlose Dusche, gehe ich an den Pool und bin gleich ein Gefangener und die Leute stürzen sich auf mich und reden mir das herrliche Wetter in den Kopf und ich will bloß meine kostenlose Dusche. Ich brauche eine Dusche, denke ich mir, aber an den Pool kann ich nicht gehen und am Meer bekomme ich keine kostenlose Dusche mehr. Als ich heute Morgen mit dem Fernglas den Pool überprüfe und schaue, ob ich es wagen kann, sehe ich, wie der Hausmeister den Pool für uns schon aufgeräumt hat. Und wie der Hausmeister den Pool verlässt, kommt auch schon eine Frau und sieht sich um und ich bekomme keine kostenlose Dusche mehr. Ich sehe genau, wie sie sich umsieht und ich frage mich, wonach sie sich eigentlich umsieht. Aber dann nimmt sie doch eine Dusche und steigt in den Pool. Bevor man in den Pool steigt, muss man eine Dusche nehmen. Und die Frau sieht sich um und fühlt sich völlig unbeobachtet und nimmt trotzdem eine Dusche. Sie hat sich sehr korrekt verhalten. Aber ich kann mich der Gefahr einer kostenlosen Dusche nicht mehr aussetzen, das herrliche Wetter kann ich mir von der Frau am Pool nicht in den Kopf reden lassen und so gehe ich nicht mehr an den Pool. Ich könnte vielleicht auf unser Parkplatzdeck gehen und in den Briefkasten schauen. Doch der Briefkasten ist eigentlich immer leer. Aber vom Parkplatzdeck aus kann ich den Pool sehen und das Meer. Ich sehe dann den Pool und ich sehe das Meer. Ich bin dann im sechsten Stock und kann Claude trotzdem am Meer genau an seiner Badehose erkennen. Ich erkenne Claude dann vom Parkplatzdeck aus an seiner Körperhaltung und sehe, dass er noch am Meer steht. Mein Blick ist auch ohne Fernglas mittlerweile so geschärft, dass ich Claude vom Parkplatzdeck aus erkennen kann, obwohl er dann nur noch strichmännchengroß am Meer steht und ich kann dann beurteilen, ob er zu lange in der Sonne war. Und ich stehe dann auf dem Parkplatzdeck und Claude würde niemals darauf kommen, dass ich ihn auch von hier aus sehen kann. Vom Parkplatzdeck aus hat man eine wunderbare Aussicht, so wie von meinem Balkon aus. Aber die Perspektive ist hier doch eine andere. Es ist eine leicht verschobene Perspektive, habe ich mir immer gedacht, wenn ich auf dem Parkplatzdeck stand. Aber diese Perspektive macht doch alles anders. Oder wenn ich im Treppenhaus stand und von dort aus die wunderbare Aussicht genossen habe. Auch von dem Punkt dort im Treppenhaus, der auf der Höhe meines Balkons liegt, nur ein paar Meter nach links verschoben, ist die wunderbare Aussicht dieselbe, es ist dieselbe wunderbare Aussicht, aber eben doch leicht verschoben und dadurch ganz anders. Von hier habe ich die Felsen in der Mitte der Bucht oft gezählt. Es sind genau zehn Felsen. Steht das Wasser bei ablandigem Wind tiefer, sind es genau zwei oder drei Felsen mehr. Es gibt aber niemals ablandigen Wind. Wo soll er denn auch herkommen, der ablandige Wind, habe ich mich oft gefragt und darüber gelacht. Wenn die Wellen einmal höher sind, dann sieht man manchmal auch nur sechs oder sieben Felsen in der Mitte der Bucht. Ein paar Felsen sind aber immer zu sehen, weil die Wellen niemals unbequem stark sind in meiner Bucht. Die Aussicht auf meine Bucht ist von überall hier wunderbar. Manchmal gucke ich die Aussicht an und ertappe mich dabei, wie ich die Aussicht gar nicht mehr sehe. Ich gucke dann die Aussicht an und konzentriere mich auf die Aussicht und darauf, wie herrlich die Aussicht ist und ertappe mich dabei, wie ich die Aussicht doch nicht mehr sehe. Morgens ist es auf dem Parkplatzdeck noch sehr ruhig. Es kommt nur einmal vielleicht ein Nachbar vorbei und hat sein Baguette in der Tüte. Abends ist es hier dann vergleichsweise voll, wenn die Leute mit ihren teuren Wagen in die Stadt fahren, um sich in den teuren Restaurants die Mägen mit Schrott vollzumachen. Ich gehe nicht in die Restaurants. Die Leute sind dort sehr unfreundlich. Ich stehe lieber auf meinem Parkplatzdeck. Stehe ich morgens auf dem Parkplatzdeck, gucke ich immer aufs Meer. Stehe ich abends auf meinem Parkplatzdeck, gucke ich immer auf die Häuser. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das war schon immer so. Ich frage mich das auch gar nicht mehr. Ich akzeptiere das einfach. Abends sehe ich manchmal auch die Lichter des automatischen Rasenmähers auf Mashkevitchs Anwesen zwischen den Blättern der Bäume kurz aufblitzen. Und morgens sehe ich mit meinem Fernglas den gemähten Rasen bei Mashkevitch und frage mich, ob Mashkevitch, wenn er sich ganz woanders aufhält, vielleicht auf seiner Lady Lara zwischen ein paar dubiosen Geschäften noch schnell durch eine seiner Kameras spähend davon überzeugt, wie gut der Rasen gemäht ist. Aber selbst sein gut gepflegter Rasen hat schon auch ein paar wenige braune Stellen. Abends kann man auch das Spiel der Taschenlampe beobachten. Das Sicherheitspersonal auf Mashkevitchs Anwesen hat taktische Taschenlampen und kann sehr gut mit ihnen umgehen. Das Sicherheitspersonal leuchtet den Bereich vor sich kurz aus, um dann kurz das Licht zu dimmen, um dann kurz durch mehrmaliges Tippen ein paar Morse in die Dunkelheit zu schicken. Und morgens kann man dann gut sehen, dass in der Nacht alles in Ordnung gewesen sein muss. Und ich frage mich dann manchmal, ob Mashkevitch sich vielleicht mit den paar braunen Stellen im Rasen einverstanden gibt und ganz anderswo auf der Welt beruhigt aufatmet, weil in der Nacht alles in Ordnung war. Aber heute gehe ich auch nicht mehr auf das Parkplatzdeck, morgens nicht und abends nicht. Mir läuft das Parkplatzdeck ja nicht davon. Von meinem Balkon aus kann ich durch das Fernglas das Sicherheitspersonal bei Mashkevitch genau erkennen. Es sind insgesamt fünfzehn oder sechzehn Angestellte im Sicherheitspersonal, die in Schichten von acht Stunden den Tag unter sich aufteilen. Sie nehmen ihre Arbeit sehr ernst und wissen doch, dass niemand es wagen würde, sich auf das bombastische Grundstück zu schleichen. Aber einmal habe ich gesehen, wie einer von der Sicherheit sich fünfzehn Meter vom Pool aufhielt und dann in der Nase gepopelt hat. Das war genau an dem Tag, als in der darauffolgenden Nacht eine Familie am Strand übernachtet hat. Ich habe genau sehen können, wie sie dort in ihren Schlafsäcken auf Matten lagen, in wohlüberlegtem Abstand zu Mashkevitchs Mauer und dem Meer, nämlich etwa genau in der Mitte. Und als Erstes steht die Mutter auf und blickt sich in alle Richtungen um und läuft auf Mashkevitchs Schloss am Meer zu und hockt sich vor die Mauer und pisst unter ständigem Hin- und Herschauen einfach gegen die Mauer von Mashkevitchs Schloss. Und dann wachen die Söhne auf und pissen gegen die Mauer. Und während sich die Mutter schon die Achseln mit Feuchttüchern durchgewischt hat und es die Söhne gerade tun und die Mutter schon angefangen hat, sich die Zähne zu putzen und es dann die Söhne tun, steht noch der Vater auf und pisst als Letztes an Mashkevitchs Mauer. Und der Vater stand am längsten an der Mauer. Und als der Vater sich dann die Zähne putzt, haben die Mutter und die Söhne schon längst an Mashkevitchs Mauer ausgespuckt und als letztes spuckt der Vater noch an die Mauer aus und hat sich die Achseln schon mit Feuchttüchern durchgewischt. Und ich denke mir, Mashkevitch muss das wissen und ob Mashkevitch das weiß und warum er nichts dagegen tut und wo Mashkevitch eigentlich ist und ob es ihm gut geht. Ich kann natürlich nicht einfach so runter, habe ich mir gedacht, weil der Weg einfach zu weit ist und sie wären längst fortgekommen, dachte ich mir. Aber wäre ich gleich, als die Frau sich unter ständigem Um- und Hin- und Hersehen entleert hat, losgelaufen, dann hätte ich vielleicht den Vater noch zur Rede stellen können. Stattdessen habe ich einfach nur zugeguckt und alles beobachtet und als es nichts mehr zu beobachten gab, habe ich nicht mehr hinsehen können und habe mir den Pickel auf dem Po einfach ausgedrückt. Und dann sind Mashkevitch auch zwei Bäume umgeknickt und er hat nichts dagegen unternommen. Sie liegen nicht auf dem Rasen, aber sie stehen doch in einem für sie ungesunden Winkel. Ich weiß nicht, wie es vom Anwesen betrachtet aussieht, aber ich frage mich schon, warum Mashkevitch nichts unternimmt und ob er wohlauf ist. Man sieht heute nicht mehr viel durch das Fernglas. Auf den Schiffen ist auch immer weniger los. Man sieht sie nur noch hin und wieder ein paar Stühle rücken oder das Deck schrubben und die Familien kann man beim Essen durchs Fernglas sehen, wie sie nur auf ihre Teller gucken. In einem der Häuser sehe ich schon auch mal eine ältere Frau morgens auf dem Balkon sitzen und für zwanzig Minuten eine Zeitung lesen. Es ist die mit dem bunten Nachthemd, das so bunt ist, dass sie sich einfach auch unbeobachtet fühlen muss, wenn sie auf ihrem Balkon sitzt und Zeitung liest. Und auch der Mann vierzig Häuser weiter rechts sitzt jeden Morgen auf seinem Balkon und atmet seine Zigarette auf und holt sich erst dann einen Kaffee, um noch eine Zigarette dazu zu rauchen. Heute sieht man nicht mehr viel durch das Fernglas. Aber früher habe ich schon auch mal in einem der Schlafzimmer in einer der Villen ein paar Sachen auf dem Boden liegen sehen. Es muss ein Herrenbademantel gewesen sein und wahrscheinlich auch ein BH dort auf dem Boden in einem der Schlafzimmer in einer der Villen. Heute sehe ich durch das Fernglas den Mann, der in unregelmäßigen Abständen mit seinem Metalldetektor an den Strand kommt und niemals etwas gefunden hat. Sein Detektor schlägt schon auch mal aus und dann guckt er hoffnungsvoll und sucht den Boden ab und verrückt ein paar Steine und hat doch wieder nichts gefunden. Und dann ist da noch der Mann, der mit hoher Sorgfalt Steine am Strand auswählt und sie seit Stunden auf den Felsen platziert. Dem Mann steht der Schweiß im Gesicht und er ist von seiner stundenlangen Tätigkeit angestrengt und versucht die Steine in ein paar Zwischenräume zu stellen, sodass sie nicht herunterfallen. Er spielt, denke ich mir, und ist dabei so angestrengt, er spielt ein anstrengendes Spiel und ich frage mich, wozu überhaupt. Als es da unten angefangen hat zu brennen, bin ich in zweiunddreißig Sekunden auf das Parkplatzdeck gerannt. Nach nur sechs Minuten und vierzehn Sekunden, die ich oben stand, war die Feuerwehr mit siebenundzwanzig Mann schon da. Und nach nur vierundzwanzig Minuten war das Feuer schon gelöscht. Ich kann mich hier einfach auch sicher fühlen. Nur zwei kleinere Bäume waren verkohlt. Vielleicht leben sie sogar noch. Und als ich den Aufzug wieder runternehme, wird mir plötzlich bewusst, dass ich immer, wenn ich in den Aufzug steige, nur zwei Knöpfe drücke. Fahre ich in meine Wohnung, drücke ich die Zwei und fahre ich auf das Parkplatzdeck drücke ich die Sechs. Und noch niemals habe ich einen anderen Knopf gedrückt. Ich habe es so leicht und doch weiß ich nie, wenn ich in den Fahrstuhl steige, welchen Knopf ich drücken muss. Ich muss mich immer erst umdrehen und gucken, ob ich das Parkplatzdeck aus dem Aufzug sehe und die Zwei drücken muss oder ob ich das Treppenhaus auf meiner Etage sehe und die Sechs drücken muss. Noch niemals habe ich einen anderen Knopf im Aufzug gedrückt und mir aber oft gedacht, ich könnte einen anderen Knopf drücken, es ist doch so leicht, und niemals habe ich es hingekriegt. Ich drücke auf die Eins und fahre zu Claude runter, denke ich mir manchmal. Claude ist mein Freund. Wenn ich mal von meiner Boje zurückgeschwommen bin, dann unterhalten wir uns schon auch mal, wenn er auf seinem faltbaren Strandstuhl sitzt und in das Buch guckt. Ich frage ihn schon auch mal, was er heute vom Wetter hält und was er eigentlich liest, so als ob es etwas zur Sache täte. Einmal haben wir auch zusammen bei mir gegessen und einmal haben wir zusammen bei ihm gegessen in den vielen Jahren. Aber er isst lieber bei sich und ich esse lieber bei mir. Er mag die Gewürze und will alles mit seinen Händen bearbeiten, sogar die Bohnen reinigt er wie eine alte Frau und kocht alles frisch, weil er nichts zu tun hat, sagt er. Und ich verstehe die Gewürze nicht und koche den Fisch immer in der Mikrowelle, eine Minute eine Seite und eine Minute die andere Seite, damit ich nichts weiter zu tun habe, sage ich ihm. Und so essen wir nicht mehr zusammen. Claude sehe ich nur, wie er am Meer sitzt oder wie er am Pool sitzt oder ich sehe ihn eben durchs Fernglas, wie er heute sogar am Meer steht. Ich könnte einfach zu Claude runterfahren und an seiner Tür klingeln, er steht ja am Meer und öffnet mir sicher nicht. Aber heute fahre ich nicht mehr zu Claude runter. Ich könnte auch nach Monaco zum Einkaufen fahren, wenn mir danach ist oder wenn ich etwas brauche. Manchmal zieht es mich schon nach Monaco und ich drücke im Aufzug die Sechs und fahre mit meinem Auto nach Monaco. Manchmal macht der Prinz mit seiner Familie ein öffentliches Picknick oder ich gehe in eines der Museen oder ich spaziere im Park, denke ich mir. Aber dann fahre ich nach Monaco und gehe doch nur einkaufen, weil ich wieder etwas brauche. Manchmal zieht es mich eben schon nach Monaco, wenn ich meiner Bucht überdrüssig geworden bin. Und wenn ich nach Monaco gefahren bin, zieht es mich gleich schon wieder in meine Bucht zurück und ich kaufe nur kurz in Monaco ein, soviel ich greifen kann kaufe ich ein und fahre schnell zurück in meine Bucht. Aber heute zieht es mich nicht nach Monaco. Und in Menton gehe ich niemals einkaufen. Die Leute sind dort einfach so unfreundlich. Aus Menton kommt seit Jahren immer ein Paar morgens an den Strand in unsere Bucht. Sie fährt immer mit dem Zug und er läuft die neun Kilometer aus Menton immer. Und dann schwimmen sie und baden ihre Körper in unserer Bucht und sie fährt mit dem Zug wieder nach Menton. Und er sitzt dann noch in unserer Bucht und putzt sich die Füße ab und zieht sich die weißen Trainingssocken, die er immer anhat, bis ganz nach oben bis zur Mitte der Wade und braucht fast länger als eine Minute pro Socke, bis er sich die weißen Trainingssocken bis zur Mitte der Wade hochgezogen hat und dann läuft er los und sie hat schon längst den Zug genommen, wenn er noch sein Handtuch und seine Badehose in fast länger als fünf Minuten eingepackt hat und er sich dabei nach allen umschaut und dann ist er los und ist fertig und läuft wieder in sein Menton hinein und morgen kommen sie wieder, sie mit dem Zug und er zu Fuß und alles läuft genauso wie heute und gestern und die Jahre zuvor. Nach Menton könnte ich auch wieder mal laufen, denke ich mir manchmal, der Weg ist idyllisch und es tut dem Körper gut, aber wozu, denke ich mir dann und laufe den schönen Weg nicht bis nach Menton. Ich stehe mit meinem Fernglas auf dem Balkon und schaue weg von dem am Meer stehenden Claude und schaue auf das Hotel ganz oben auf dem Felsen. Wenn mal ein bisschen der Wind weht, denke ich an das Hotel ganz oben auf dem Felsen, weil es mehr Glas als Beton verbaut hat und denke mir, dass es wackeln muss und dass es irgendwann von dort oben einfach herunterkippt auf unsere Bucht oder herunterrutscht. Und dann sehe ich durch mein Fernglas und sehe, dass es doch sehr solide dort oben auf dem Felsen steht. Jeder hat hier ein Fernglas. Meinen Nachbarn sehe ich oft, wie er mehrere Stunden auf seinem Balkon mit seinem Fernglas verbringt und ich frage mich, wozu überhaupt. Er hat kein Standfernglas wie ich und muss sein Fernglas immer halten und hängt irgendwann nur noch auf seinem Balkonsims mit seinem Fernglas in der Hand, wenn ich ein paar Balkone weiter mit meinem Standfernglas stehe. Ich habe auch schon einmal jemanden dort drüben auf der anderen Seite der Bucht mit einem Fernglas gesehen, wie er mit seinem Fernglas genau auf meinen Balkon geguckt hat, wie ich dastehe und mit meinem Fernglas auf seinen Balkon gucke. Und wie er mit seinem Fernglas sieht, dass ich ihn mit meinem Fernglas sehe, da tut er plötzlich so, als ob er auf die Berge hinter mir sehe und ich frage mich, was es für ein Gefühl für ihn gewesen sein muss, dass ich ihn da ertappt habe, wie er mich mit seinem Fernglas auf meinem Balkon beobachtet hat. Und dann frage ich mich, was er gesehen hat und wie ich aussehe mit meinem Fernglas auf dem Balkon, was er für ein Bild von mir durch sein Fernglas gesehen hat, wie ich hier mit meinem Fernglas auf dem Balkon stehe und wie ich dann glaube, genau das Bild, das er durch sein Fernglas von mir gesehen hat, im Kopf zu haben, wird mir plötzlich bewusst, dass es das Bild gar nicht gewesen sein kann, weil das Bild, das ich dann im Kopf hatte, ein Bild von mir mit meinem Fernglas auf meinem Balkon war, das man nur im Kopf haben kann, wenn man hinter mir auf meiner Couch im Wohnzimmer sitzt und mich von hinten auf meinem Balkon mit meinem Fernglas auf dem Balkon stehen sieht. Ich habe mich den Tag über gefragt, wie ich das Bild plötzlich nur von hinter mir auf meiner Couch im Wohnzimmer sitzend, wie ich auf dem Balkon mit meinem Fernglas stehe, im Kopf haben konnte. Aber schon ein paar Tage später habe ich es einfach akzeptiert und denke kaum noch daran und sehe wieder völlig befreit durch mein Fernglas. Claude steht da unten am Meer. Und ich muss daran denken, wie Claude dann doch immer mal wieder von ein paar Touristen, die nicht zu den Reichen hier gehören, so intensiv er sich auch in sein Buch vertieft, angesprochen wird. Claude findet immer einen guten Umgang mit den paar Touristen. Und da erzählt er den Touristen von der kalten Quelle, die unweit des Strandes aus den Felsen ins Meer spült und dass wir im Sommer immer näher an der kalten Quelle schwimmen und im Winter immer weiter weg von der kalten Quelle schwimmen und ich höre Claude zu und sehe seine glaubhaften Armbewegungen und will es ihm fast abnehmen und denke, Claude schwimmt im Sommer immer näher an der kalten Quelle und im Winter immer weiter weg von der kalten Quelle und weiß es doch, dass Claude im Sommer wie im Winter immer nur auf seinem faltbaren Strandstuhl sitzt und in sein Buch hineinstarrt. Aber jetzt muss er seine Gewohnheiten geändert haben. Jetzt steht er da unten am Meer und schwimmt doch nicht. Ich werde ihn fragen, denke ich mir, wenn ich ihn das nächste Mal treffe, werde ich ihn fragen, ob er auf seinem faltbaren Strandstuhl sitzt oder tatsächlich am Meer steht. Aber das läuft mir ja nicht davon. Claude läuft mir ja nicht davon. Und heute gehe ich auch nicht mehr raus.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiVERS | Judith Klara Lüdtke
Näher
Näher an das Fenster ran, aus dem Wohnzimmer hinausblicken
Näher an das Fenster ran, hinausschauen
Auf den Zwetschgenbaum
Auf das dunkle Fenster gegenüber
Auf die grünen Pfosten
Auf die wilde Rose
Auf den Farn
Erinnerungen in Holz, Glas, Stein, Pflanzen, Lichtern, Farben
Alles in Farben
Bäume der Bilder, die ich male
Bäume aus Bildern, die ich male
Bäume aus Fenstern
Bäume in Fenstern
Geht da die Geschichte weiter?
Fängt sie da an, sich in Kapiteln auf Äste zu verteilen?
Fängt sie da an weiterzuwachsen?
Fängt sie da an?
Immer weiter zu wachsen
Immer weiter zu blühen
Mit der Gewissheit, dass im neuen Frühling die Blätter wieder kommen?
In Ästen trauriger Tage
Wächst das Holz geprägter Stunden
Erinnerungen an den Ästen
Erinnerungen in den Blättern
Erinnerungen in den Fenstern, in denen sie sich spiegeln
Erinnerungen in Bäumen
Bäume in Bildern, die ich male
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sabine Dreßler
Familie
Bei uns hat jeder seinen eigenen Platz am Tisch. Wir sind zu viert. Also auch vier Stühle. Die Stühle sehen alle gleich aus: Holz, weiß lackiert, ausgepolsterte Sitzfläche, überzogen mit gräulichem Kunststoff, abwischbar. Ich sitze immer nahe der Schrankwand mit Blick auf die Küche. Maren sitzt links von mir, Mutti rechts. Und mir gegenüber, an der Balkontür und mit Blick aus dem Fenster sitzt Vati. Er hat den schönsten, den hellsten Platz. Hell genug, um Sonntag darauf ausgiebig Zeitung zum Kaffee zu lesen. So, genau so sitzen wir immer: zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendbrot. Ich weiß nicht mehr, wie das gekommen ist, wie das entschieden wurde, dass Vati mit Fensterblick und ich mit Küchenblick sitzen und nicht andersherum. Dass wir immer so sitzen und nicht etwa rotieren oder sitzen, wie es uns gerade passt. Aber es ist so.
In letzter Zeit ist Vatis Platz beim Abendbrot häufig leer. „Wartet nicht auf mich, es wird heute spät“, sagt er ins Telefon und dann legt Mutti auf, setzt sich rechts von mir an den Tisch und schweigt. Und kaut lang an einem Bissen. Und so kräftig, dass ich ihre Kiefernmuskeln sehen kann. Und dann schweigen wir auch und kauen. Niemand von uns wäre auf die Idee gekommen, sich auf Vatis Platz, auf den schönsten, den hellsten Platz zu setzen. Er ist frei. Mutti könnte es tun. Ich könnte es tun. Maren. Einfach so. Aber niemand von uns setzt sich da hin. Das würde alles durcheinanderbringen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sonja Lauterbach
Zwischen Lametta und Plastiktanne – Die große Leere in der Vorhölle der Besinnlichkeit
Es begab sich aber zu der Zeit, dass man mich bat, etwas Besinnliches zu schreiben. Ein harmloses Wort, sollte man meinen. Doch inzwischen klingt „Besinnlichkeit“ wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Epoche – irgendwo zwischen Schallplatte, Telefonzelle und intakter Aufmerksamkeitsspanne.
Ich nahm also an. Das war mein erster Fehler.
Der zweite war, tatsächlich damit anzufangen.
Denn seien wir ehrlich: Wer hat denn bitte noch Muße, sich zu besinnen? Meine Besinnung liegt seit Jahren in der Warteschleife des globalen Kundenservice. „Ihre Besinnung ist uns wichtig. Wenn es um die perfekte Stimmung geht, drücken sie die Eins, …“
Vorfreude ist auch nicht mehr das, was sie mal war
Früher, so heißt es, begann Weihnachten, wenn der erste Schnee fiel. Heute beginnt es, wenn der Algorithmus entscheidet, dass du bereit bist, Geld auszugeben. Im September. „Cozy Christmas Vibes“ auf Spotify, während draußen noch Wespen im Biergarten tanzen. Das ist keine Einstimmung – das ist eine Drohung.
Ich wollte mich also einstimmen. Ich zündete eine Kerze an – Bio, fair gehandelt, klimaneutral versandt, selbstverständlich mit moralischem Zertifikat – und wollte etwas schreiben über Schnee, Stille, Zauber.
Dann kam eine Push-Nachricht: „Nur noch 3 Tage! 40% auf alle Weihnachtsartikel! Tannenbaum-Emoji 🎄“
Es waren noch 47 Tage bis Weihnachten.
Feldforschung im Glühweinmilieu
Vielleicht, dachte ich, muss man raus. Auf den Weihnachtsmarkt. Das wahre Leben spüren.
Der Glühweinduft! Das Lachen der Kinder! Die Wärme der Gemeinschaft!
Ich kam an – und fand: einen Outdoor-Ausschank mit QR-Code-Bezahlsystem. Meine Finger waren zu kalt, die App zu langsam, das WLAN zu schwach. Der Glühwein kostete 5,50 €, die Tasse 3 € Pfand, und als endlich alles bezahlt war, war das Getränk bereits kalt.
Der Duft? Desinfektionsmittel.
Die Kinder? Am Handy.
Die Gemeinschaft? Jeder für sich, aber gemeinsam frierend.
Neben mir sagte ein Mann ins Telefon:
„Nein, ist nicht so besonders. Ja, ich komm bald heim.“
Ich nickte innerlich. Er sprach für uns alle.
Sinnlichkeit auf Sparflamme
Sinnlichkeit, hieß es, sei das Ziel.
Doch was ist Sinnlichkeit in einer Welt, in der selbst der Glühwein digitalisiert wurde?
Früher war’s ein Keks zu viel. Ein Kuss im Kerzenlicht, das Wachs tropfte, und niemand beschwert sich, weil es schön war. Heute tropft nur noch das WLAN.
„Alexa, spiel Weihnachtsmusik.“
„Ich habe keine Verbindung zum Internet.“
Das ist der wahre Weihnachts-GAU: der Zusammenbruch der Datenverbindung. Kein Engel, kein Stern, kein Halleluja – nur das kalte Schweigen der Sprachassistentin.
Die moralisch korrekte Zielgruppe
Und dann sehe ich euch vor mir – ja, euch, liebe Zuhörende.
In euren ethisch geprüften Wollpullis, mit einem ökologisch einwandfreien schlechten Gewissen.
Ihr habt eine Gans gekauft, die ein gutes, veganes Leben hatte – bis sie es nicht mehr hatte. Und ihr habt Geschenke organisiert, die nicht Freude bringen sollen, sondern Gewissensberuhigung: Eine Ziege für Afrika. Im Namen von Tante Gertrude. Die Ziege weiß nichts davon, aber ihr habt es getan – und das zählt. Das Foto der Referenz-Ziege ähnelt stark ihrem Gesicht, als Tante Gertrude das Zertifikat auspackte.
Ihr seid erschöpft. Nicht vom Feiern. Vom Versuch, es moralisch richtig zu tun.
Ihr wollt Wärme – aber der Strompreis friert selbst den Elektrokamin ein.
Der große Kollaps
Also schreibe ich. Nicht besinnlich, nicht festlich, sondern: erschöpft.
Weihnachten ist längst kein Fest mehr, es ist ein Projekt. Ein kollektives Burn-out mit Glitzer und Beleuchtung.
Die Engel? Haben gekündigt.
„Unbezahlte Überstunden im Himmel? Sorry, Petrus, das machen wir nicht mehr. Wir gründen jetzt eine Consulting-Firma – oder werden Influencer. Bessere Arbeitszeiten, gleiches Strahlen.“
Der Trotz der Letzten
Und trotzdem – wir feiern weiter.
Nicht, weil es schön ist, sondern weil wir es noch können.
Wir wissen, dass es albern ist. Und genau darin liegt der Trost.
Wenn 37 Handys gleichzeitig „Stille Nacht“ spielen, jedes mit einer anderen Latenz, entsteht etwas Großartiges: der schiefe Chor der Unvollkommenheit.
Das ist vielleicht das neue Besinnliche – das Wissen, dass wir keine Besinnung mehr haben. Und das neue Sinnliche – die Sehnsucht nach einer Minute Ruhe, in der niemand etwas bestellt, bewertet oder liked.
Epilog mit Glühweinresten
Ich wünsche euch keine frohe Weihnacht. Froh ist überbewertet.
Ich wünsche euch eine erträgliche.
Geschenke, die so nutzlos sind wie dieser Text – und gerade deshalb perfekt.
Einen Moment, in dem niemand fragt, ob das jetzt nachhaltig genug ist.
Und wenn Alexa wieder streikt, sagt einfach: „Dann eben nicht“ – und singt selbst.
Denn nur, wer nichts mehr erwartet, kann noch überrascht werden –
von einem Lächeln, einem funktionierenden Lichterkettenstecker,
oder der ehrlichen Stille nach dem kollektiven Weihnachtswahnsinn.
Frohe Ratlosigkeit.
Und möge euer Fest so schön scheitern, dass ihr es später gern erzählt.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Sarah Niklowitz
Kafkas Schloss
Flinke Augen huschen über Seite 201, während die Kuppen von Zeigefinger und Daumen der rechten Hand sich bereitmachen. Umblättern. Ein Prozess, der in Zeitlupe einem Vorspiel gleicht, beginnend an der oberen rechten Ecke, erst mit zwei Fingern, dann nur noch mit dem Zeigefinger sanft über die Kante streichend, bis das Papier schwach wird und sich mit einem stummen Seufzen auf den Rücken fallen lässt. Es genießt den neugierigen Blick auf seine Rückseite und lehnt sich entspannt zurück, bis das Augenpaar sich dem nächsten Blatt widmet und das Zusammenspiel aus Daumen, Zeigefinger und Seufzen von vorn beginnt. Das Schloss genießt die Zärtlichkeiten 220 Seiten lang. Ob Kafka sich im Grabe umdreht, um dieses Grauen nicht zu sehen oder zufrieden lächelnd jede Berührung seines Werkes beobachtet, bleibt sein wohlgehütetes Geheimnis. Die Neugier ist groß, was er wohl davon hielte, dass seine Zeilen sich als Herumtreiber entpuppten. Das Schloss, den Kinderschuhen längst entwachsen, geht ohnehin seine eigenen Wege, zumindest lässt es sich bereitwillig auf jedes neue Hände- und Augenpaar ein, das sich von ihm angezogen fühlt. So kommt es, dass Kafkas Werk Abenteuer erlebt, von denen wir Menschen nur lesen können. Diese Reise endet in 18 Seiten. Der Abschied ist ein vertrauter Ablauf für beide Beteiligten, ein Auf Wiedersehen zwischen einer weit gereisten Geschichte und Fingern, die trotz ihrer Jugend bereits 276 Beziehungen dieser Art führten. Alle endeten auf dieselbe Weise. Die Gedanken verharren noch drei tiefe Atemzüge auf dem letzten Satz, bevor sich der Einband wieder um die Seiten schließt. Ein letztes Mal streicht diese Hand über seinen Rücken, ein Abschied mit Aussicht auf ein Wiedersehen, vielleicht in ein paar Jahren. Das stumme Versprechen einander nicht zu vergessen gefolgt von der Übergabe an den Turm der Gelesenen. Wäre dieses Werk ein einfaches Buch, würde sein Weg hier enden, auch wenn die Chance auf ein oder zwei neue Bekanntschaften nicht auszuschließen sind. Die Wahrscheinlichkeit des Verblassens unter einer Ansammlung von Staubkörnern ist hoch. Doch diese Ausgabe von Kafkas Schloss ist nicht für den frühen Ruhestand bestimmt. Dieses Werk folgt einem anderen Schicksal.
Zwischen in Klarsichtfolie überzogenen Einbänden finde ich mich wieder. Der Boden des Aluminiumregals fühlt sich kalt an, doch meine Nachbarn wärmen mich an Vorder- und Rückseite. Leise brummendes Neonlicht hüllt den Raum in einen leicht muffigen Gelbstich, der mir bedeutet, dass ich wieder zu Hause bin. Die Ecken meines Einbands dröseln sich mit jedem Griff weiter auf, wie splissige Haarenden. Mir wohlvertraute Hände streichen sanft darüber, bevor sie mich zurück ins Regal stellen – so schlimm scheint es noch nicht zu sein. Jedes Leben hinterlässt seine Spuren, auch das eines Bibliotheksbuches. Meine Reisen verbringe ich weitgehend als stiller Beobachter, doch zurück im zweiten Regalfach von oben unter dem Schild Romane K-L teile ich meine Erlebnisse mit dir. Wir Bücher sehen mehr als du denkst. Wir erinnern uns an jeden Blick, der uns je traf, jede Hand, die uns einst hielt. Wenn du das nächste Mal in einer Bibliothek stehst, halte einmal inne und nimm dir Zeit, genau hinzuhören. Wenn du es schaffst, deine eigenen Gedanken ganz leise zu stellen, kannst du uns hören. Das emsige Wispern zwischen den Seiten, während Rückkehrende von ihrem letzten Abenteuer erzählen und Neuankömmlinge darüber philosophieren, wer sie wohl als erstes auswählt und über den Scanner zieht, dessen Piepsen die Leihfrist von vier Wochen einläutet. Mascha Kalékos Sei klug und halte dich an Wunder berichtet mir gerade von der salzig-heißen Träne eines Herren mit rauen Fingerkuppen, die sie auf Seite 22 traf als Heinz Kahlaus Fundsachen sich den Weg in unser Zwiegespräch bahnen. Das Atmen fällt mir schwer, es wird langsam eng zwischen K und L und ich hoffe auf einen baldigen Reiseantritt. In diesem Jahr stehen meine Chancen gut, denn der Geburtstag meines Schöpfers wird groß gefeiert. Jeder möchte ein Stück von ihm haben und so war ich in den letzten Monaten mehr unterwegs als die meisten anderen hier. Selbst die Neuerscheinungen blicken mir neidvoll hinterher, wenn ich in fremden Taschen das Haus verlasse. Heute schließe ich meine Augen zwischen Kahlau und Hesse, der sich wohl verirrt hat, was manchmal passiert, wenn die Tochter des Bibliothekars zu Besuch ist. Sie findet, Hermann Hesse passt besser zu Mascha und mir als zu Hemingway, die diskutieren ihr immer zu laut, sagte sie einst. Gerade gehe ich vom Dösen in einen tiefen Schlaf über, da reißt mich ein gekonnter Handgriff aus meinen Träumen, noch bevor sie beginnen. Ich wurde vorbestellt. Auf dem Wagen mit den Bereitstellungen für den nächsten Tag ist mir ein wenig frisch um den Einband und es kribbelt in den aufgedröselten Ecken. Wer mich wohl morgen abholen wird?
Es duftet nach Sandelholz, die Heizung haucht dem großen Raum mit stetem Rauschen Wärme ein. Zwischen Seite 31 und 32 steckt eine Postkarte aus Kreta mit verblasster Tinte. Liebe Grüße von Oma und Opa. Aus der anderen Ecke des Raumes schallen abwechselnd fremde Stimmen aus einem Laptop-Lautsprecher, meine momentane Besitzerin scheint ein wenig wortkarg in diesem Spektakel. Doch ich spüre ihre Blicke auf mir. Sie hat es mir gemütlich gemacht, ich liege eingekuschelt in die warmen Worte ihrer Großeltern auf einer Decke, die so weich ist, wie ich mir die Konsistenz einer Wolke vorstelle. Fernab jeder Realität besteht diese aus 100 Prozent Wolle. Das ungeduldige Wippen mit ihrem rechten Fuß unter dem großen Holztisch, auf dem der plappernde Laptop seinen Platz hat, macht mich nervös. Tschüss! Das erste und letzte Wort, das in diesem Raum heute gesprochen wurde. Ein tiefer Seufzer lässt Bildschirm und Tastatur miteinander verschmelzen. Als sie sich unter die wolkenweiche Decke schiebt, lande ich auf ihrem Schoß und spüre, wie ihr Körper ruhiger wird, der Atem tief und gleichmäßig. Meine Seiten legt sie so zart um, als drohten sie beim nächsten Windhauch auseinanderzufallen. Obwohl sie einen leichten Gelbschleier vorweisen, sind sie von robuster Qualität. Ich verstehe meinen Auftrag und versuche meine Seiten möglichst zu entspannen, damit sich die Hände, die mich halten, nicht an mir schneiden können. Es gibt Momente, da bemühe ich mich um extra scharfe Kanten. Immer dann, wenn ich merke, dass jemand mich nur benutzt, um Eindruck zu schinden und überhaupt nicht an einem ehrlichen Kennenlernen interessiert ist. Dem letzten Junggesellen bescherte ich nach dem vierten Date in einer Woche ein blutendes Rinnsal aus dem rechten Zeigefinger, als er mich viermal an derselben Stelle aufschlug und sein Gegenüber mit denselben Worten einzunehmen versuchte, wie bereits drei Male zuvor. Manchmal besteht meine Aufgabe darin Trost zu spenden und zuzuhören, doch dann und wann nehme ich es mir heraus ein Zeichen zu setzen. Die bräunlich gefärbten Flecken auf den entsprechenden Seiten tragen alle Bibliotheksbücher, wenigstens die, die in ihrem Leben mindestens eine bitter geweinte Träne gekostet haben. Oft sind wir die einzigen, die den Schmerz eines gebrochenen Herzens wirklich zu Gesicht bekommen. Wenn du jemanden dabei erwischt, der seine Nase tief zwischen unseren Kapiteln vergräbt, dann sei dir sicher, dieser Mensch hat ein reines Herz. Die Augen geschlossen, halten sie uns dicht an ihr Gesicht und atmen unsere Seele ein. Unser Duft aus bedrucktem Papier, Tränen und Blut ist für die einen ein Graus und versetzt andere in einen Rausch der Glückseligkeit. Die letzten Monate versanken in einem Kreislauf aus Enge im Aluminiumregal, unterbrochenen Gesprächen mit Mascha und Reisen in Rucksäcken, Jutebeuteln, mal behandschuhten und mal schwitzigen Händen. Tränen, Stimmen, Düfte fremder Schlaf- und Wohnzimmer, Zugfahrten, sanfte Berührungen, Scannen, Piepsen, Rückgabefach, zweites Regalbrett von oben zwischen K und L. Zwei Wochen vergehen und ich langweile mich in meinem Regalfach. Fast hätte mich der Staubwedel erwischt, doch gerade rechtzeitig greift eine zittrige Hand nach mir, ich stolpere und falle auf den braunen Teppichboden. Keuchend werde ich aufgehoben und getätschelt, wie ein Kind mit aufgeschlagenem Knie. Mir ist, als würde man mir ein bunt gemustertes Pflaster aufkleben, damit die Wunde besser heilen kann. Der Scanner piepst, vier Wochen bin ich dein. Eingehüllt in Leder und Chanel No. 5 trete ich meine Reise an, nichtsahnend, wie besonders sie für uns beide sein würde.
Die samtige Textur von Eichenholz schmiegt sich an meinen Rücken und ich lausche aufmerksam seinen Erzählungen, während meine neue Besitzerin sich auf unser Rendezvous vorbereitet. Es kann nicht mehr lange dauern, denn das Zischen des Kessels geht langsam in ein Gurgeln über. Beinahe andächtig gießen die vorhin noch zittrigen Hände das heiße Wasser in die Tasse, aus der sogleich ein dampfender Wall aus Pfefferminz emporsteigt. Stille. Die Atmosphäre gleicht dem Moment nach einem gemeinsamen Abend mit Freund:innen, die nach stundenlangem Lachen, Reden und Philosophieren den Heimweg antreten. Pfefferminz, Chanel No. 5 und ein mir unbekanntes Aroma vermischen sich und ich werde von kalten, aber sanften Händen begrüßt. Ich spüre ein Lächeln, so wohlwollend und wehmütig zugleich, dass meine Seiten ins Flattern geraten und das Umblättern schwerfällt, doch gemeinsam schaffen wir es. Dreizehn Schlucke Pfefferminztee und 57 Seiten. Dann verstummen die Hände, die mich halten. Draußen wird es dunkel und nur eine Stehlampe mit beblümtem Schirm direkt über dem Sessel, auf dem wir es uns gemütlich gemacht haben, hüllt den Raum in eine friedvolle Stille. Ich spüre, wie ich langsam Richtung Teppichboden gleite und falle schließlich weich. Diesmal bleibe ich liegen. Kein angestrengtes Keuchen, mit dem ich aufgehoben werde, nicht einmal der kleinste Atemhauch. Frieden. Pfefferminz, Chanel No. 5 und Frieden.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Martin Ködelpeter
gespenster
1 die gladiolen sind frisch geschnitten. sie stehen aufrecht in einer gläsernen, nach oben schmal zulaufenden vase. durch das helle glas kann man im wasser einzelne luftbläschen erkennen. sie sitzen auf den stielen und auf den schwertförmig in die höhe strebenden blättern. einige bläschen haben sich auch am glas gesammelt. knapp oberhalb des vasenrands, etwa auf halber höhe der gewächse, spreizen sich die ersten blüten von ihren stängeln ab. ihre form ist die komplizierteste. eine frau berührt mit ihrem zeigefinger vorsichtig eines der gelben fruchtblätter. die kinder, die sich im halbkreis um sie versammelt haben, nicken. sie wissen, dass das geheimnis darin besteht, nur das zu malen, was man tatsächlich sieht. nachdem die kinder mit ihrer arbeit begonnen haben und die pinsel ihren weg durch die bereitgestellten farbkästen suchen, verändert sich das klima im raum. die angestrengte, wie ein boot schwankende stille, die kleinen, über das raue aquarellpapier streichenden fäuste, die gleichgültigkeit der gladiolen in ihrer vase, all dies ist plötzlich kaum mehr zu ertragen.
2 das misstrauen gegenüber den worten, bis in die haarspitzen ist es dir gewachsen, tropft auf die schuhe, hinterlässt überall seine spuren. schon bald sickert es in die druckerpatronen, die dir von ihren haken im elektronikgeschäft unverhohlen ins gesicht lachen.
3 und wieder: der alte traum, in die wälder zu gehen, eine höhle zu graben, abseits der rahmen menschlicher proportion. im schatten der eichen findest du dich zwischen zweigen verstreut. beschämt, nicht zerbrechen zu können, wenn ein tier auf dich tritt.
4 die flügel sind zerbrochen. schmutz bedeckt das nasse gesicht. unmöglich, den jungen vogel zu orten, der dir aus der dunkelheit ein lied über sein porzellanenes federkleid singt.
5 und sicher, es ist reizvoll, die gewalt abzuwägen, das scharnier an der tür durch die augen des entschlossenen räubers zu sehen. und die gewalt, die deine finger bewohnt und die auch das eisen bewohnt, das du auf deinen fingern geschickt zu balancieren vermagst, schreibt seine kerben in den asphalt breiter straßen, fügt seine spuren behutsam in die kiefer und augenhöhlen blauviolett schimmernder nachmittage.
6 du trägst die steine in deinen händen. die steine tragen die namen der väter. die väter tragen keine steine. sie sind tot. an einem bach bleibst du stehen. du legst die steine ins wasser, drückst sie hinab wie den kopf eines kindes, drückst sie hinein in den boden des bachs. schon bald beginnen die steine zu schluchzen. du hältst sie fest. du hältst die steine wie seifenstücke, deren schäumende leiber nur darauf warten, deinem griff zu entgleiten, nach oben zu flitschen und dir die namen der väter mit felsiger tinte ins angstvoll verzerrte antlitz zu schreiben.
7 es sind die zähne, die vergessen, die stunden zu addieren, der kiefer, der über das knirschen der wochen in verwirrung gerät.
8 und jeden tag kommt ein neuer tag und rüttelt an den ästen der träume, rüttelt das nachtobst aus dir, das du aufliest und mühsam zerkleinerst, das du, gebeugt über das schneidebrett, zurück in den körper zu stopfen beginnst. und auch die kerne und stiele und auch die schalen und die zu boden gefallenen teile stopfst du zurück in den körper, alles stopfst du zurück und leckst schließlich sogar den saft von der klinge des messers. leckst mit der zunge die zähne, die den dunklen geschmack noch einen moment festzuhalten verstehen.
9 das foto zeigt dich auf einer breiten allee. der ort ist dir unbekannt. nichts wirkt vertraut. ist es überhaupt eine allee? jemand scheint das negativ mit einer chemischen lösung bearbeitet zu haben. jede dunkelheit, jeder kontrast - weggeätzt. du blinzelst, suchst im grauweißen rauschen nach einem bekannten detail. doch da ist nichts. nur du und dein im grellen licht beinahe transparent gewordener schatten.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tamàs Török
Hitze
Sobald die Tür zum kühlen Treppenhaus hinter mir ins Schloss fällt, wird mir jedes Mal aufs Neue klar, wieso die Sonne eine Gottheit war.
Der Winkel, in dem ihr Licht auf die Speckbacherstraße in Innsbruck fällt, ändert sich und meine Winterdepression wird zur Atemnot zwischen glühendem Asphalt. Ich senke den Blick vor ihrem Glanz und suche Zuflucht in den Schatten.
Egal hinter wie vielen Fachbegriffen und Zahlen man sie auch zu verstecken versucht, das subjektive Empfinden ihrer mich beinahe in die Knie zwingenden Macht bleibt dieselbe.
So, wie ich sie bei meinen Winterspaziergängen suche, wie eine in die kalte Dunkelheit jenseits des wärmenden Lagerfeuers verbannte Motte, beginnt der Sommer für mich an jenem Tag, an dem ich die Straßenseite wechsle, um vor ihr zu fliehen. Es ist zur selben Zeit, in der das üppige Jeansblau des Frühlingshimmels dem ausgewaschenen Look des Sommers weicht, in dem unser weißes Inferno so lautlos wütet.
Die mich umgebenden Hausfronten sind ausdruckslos wie die Dünen von Arrakis, hinter deren gesenkten Rolllädenlidern die Bewohner sich wie fiebrige Gedanken wälzen.
Eine Biene klammert sich an eine gefallene Blüte auf dem sengenden Fußgängerweg, nuckelt noch im Todeskampf am Blütenstaub.
Ein Moped surrt an mir vorbei und ich denke an eine Mücke aus Metall.
Soll ich über den Zebrastreifen sandwalken wie Timothée?
Sirenen heulen in der Ferne, die nie verstummt sind, die drückende Stille war also bloß Einbildung, meine Entrückung ein Placebo. Alles ist wie immer. Die Krankenwagen kommen immer näher mit ihrer sterbenden Fracht, zerbröseln meinen Kopf im Vorbeifahren in einer Explosion aus Schall. Sobald sie um die Ecke biegen, werde ich ganz von allein wieder ganz.
Zivilisten hupen, weil es an den Ampeln staut und auf jedes Hupen antworten zwei, drei weitere kniggegerechte Revolverschüsse im gezähmten Westen.
Die Minuten rinnen an den Kirchtürmen herab, wie Harz an Baumstämmen und ihr Klingeln vermischt sich mit dem Krächzen von auf Regenrinnen harrenden Raben.
Worauf sie harren? Auf frisches Aas.
Und sie warten nicht umsonst, denn in den Menschenbrüsten pocht es vor Wut und Einsamkeit, die Herzen im Rippenkäfig gefangene Berserker, denen jeder Grund recht und einer zu viel ist. Denn die Gefühle herrschen wieder im zivilisierten Durcheinander, das Denken wurde vom Lagerfeuer verbannt.
Was sonst so leicht fällt, ist plötzlich schwer. Nicht pöbeln, zuschlagen, nachtreten und draufspucken, nachdem die zittrige, auf ihren Rollator gestützte Pensionistin mit den Muschelpralinen und der Kochrumflasche im Korb sich an der Kassa vordrängelt, eine größere Herausforderung, als sich Leser von Proust und Woolf eingestehen möchten.
Andererseits verschlingen das Weltgeschehen und die wirtschaftliche Lage schon seit Jahren die schimmligen Madeleines im Panikraum der Selbstbeherrschung.
Was mal wirklich schön wäre, wäre eine Pause. Von allem.
Einfach mal Siesta machen und die Welt Welt sein lassen.
Wie viel einfacher doch alles wäre, wenn wir weniger erwarten könnten. Zuerst von uns selbst und dann allmählich von all den anderen, anstatt durch das Vakuum der Hitze zu rasen, nur um auszubrennen und zu verglühen, wie durch die Einsamkeit des Weltraums stürzende Sterne.
Wir schwitzen schließlich alle und der Herbst kommt früh genug.
An zu Tuendem wird es uns niemals mangeln. Das Leben ist unerschöpflich, aber ich bin es nicht.
Cut. Stop.
Aus die Maus.
So wie damals im Kindergarten, als ich mit vom Mittagessen prallem Bauch mürrisch wurde, ist es höchste Zeit für ein Nickerchen auf meinem Rorschachtest aus Schweiß und Leinen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Patricia Malcher
Rundungsfehler
„Es muss weitergehen.“
Martin nickt, versteht, was ich meine, während ihm Tränen über die Wangen laufen.
Dabei bin ich es doch, die weinen sollte. Der man erklären müsste, was da in den letzten Tagen passiert ist. Mit ihr, mit mir, mit unserer Familie.
„Ich bin nicht die Erste, der das passiert ist“, sage ich.
Wieder nickt Martin, aber diesmal kommt er auf mich zu, umrundet meinen Schreibtisch, auf dem Stapel von Schülerheften liegen, die seit zwei Wochen darauf warten, von mir korrigiert zu werden.
Ermittle den Umfang des Kreises.
Berechne den Durchmesser.
Bestimme den Flächeninhalt.
Ich spüre Martins Atem im Nacken und zwei Arme, die mich umfangen. Ich schüttle sie ab, mache mich frei von der Wärme meines Mannes.
„Ich muss arbeiten“, sage ich, drehe mich von ihm weg. „Siehst du nicht, was hier alles liegengeblieben ist?“
Hinter meinem Rücken höre ich, wie er in seine Hosentasche greift. Kurze Zeit später ertönt bereits sein Schnäuzen.
Ich balle die Fäuste und lege sie auf der Tischplatte ab. Mein Blick wandert zur Uhr.
„Du musst los“, sage ich, obwohl er noch Zeit hat und vor der verschlossenen Kindergartentür wird warten müssen, wenn er jetzt schon aufbricht.
Ich klappe ein Heft zu, nachdem ich einen Fehler mit rotem Stift angestrichen und die entsprechende Stelle in der Rechnung markiert habe.
Martin geht in den Flur, zieht Jacke und Schuhe an und greift zum Schlüssel.
Als die Tür ins Schloss fällt, lege ich den Stift zur Seite und atme aus. Mein Körper sackt zusammen, meine Gesichtsmuskeln erschlaffen.
Ich habe zwanzig Minuten, bis Florian hereingerauscht kommt, mir vom Buddeln in der Sandkiste erzählt, von Playmobil-Welten und vom Streit mit Benni, eigentlich sein Freund, aber hin und wieder eben doch gemein und doof.
Ich schaue an mir hinunter. Mit der Hand befühle ich die leere Rundung meines Bauches. Eine Gewohnheit, die schwer abzulegen ist. Auch nach zwei Wochen kommt es noch zu Übersprunghandlungen. Unangemessen und wenig hilfreich. Und trotzdem hoffe ich auf eine Reaktion.
Mir wird übel und wie in den letzten Tagen auch beginnt mein Kopf zu schmerzen. Es sticht und hämmert hinter meiner Stirn. Ich verstehe nicht. Eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten.
Wir waren allein, sie und ich. Alles war in Ordnung. Gut. Vital. Bis die Ordnung mir von einem Moment zum anderen zwischen den Beinen hinaustropfte.
Ich merke, wie mein Unterleib bei der Erinnerung krampft, als wolle er halten, was nicht zu halten gewesen war.
Der Kopf, der Bauch, die Muskeln.
Ich greife nach dem nächsten Heft, schlage es auf.
Das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser beträgt gerundet Drei, lese ich in krakeliger Schrift und spüre die Wut wie feuriges Sodbrennen im Hals.
„Pi“, sage ich laut und schlage mit der flachen Hand auf den Tisch. „Pi“, zische ich und sehe, wie meine Spucke die Seite trifft und die blaue Tinte des Schülers zu verwässern beginnt.
Mit Schwung gebe ich dem Stapel neben mir einen Stoß. Er kommt ins Wanken und Heft um Heft rutscht über die Tischkante zu Boden.
Ich schließe die Augen, zittere.
„Wir sind drei“, hat Martin Florian versichert, als ich im Krankenhaus lag, „auch wenn Mama für ein paar Tage nicht bei uns ist.“
Eine Lüge, die beruhigen sollte. Auf ihre Kosten.
Ich lege meinen Kopf ab und merke, dass ich weine. Träne um Träne entweicht meinem Körper, wie eine Nachkommastelle nach der anderen. Der Schmerz in meinem Kopf schwindet und blockiert stattdessen meine Brust. Das Atmen fällt mir schwer und doch habe ich Gewissheit.
Auch wenn sie es nicht über das Komma hinaus geschafft hat, wird sie da sein. Tag für Tag, bis tief in die Unendlichkeit hinein.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Tom Scheinpflug
Ram on
Es wird ein Samstag gewesen sein, denn jeden Samstag saßen Al und ich im Keller vom Ship&Mitre, um uns unter anderen Gescheiterten zu betrinken, bis das Zittern der zum Schaffen geschafften Hände endlich nachließ. Nicht dass Al und ich uns dafür verabredet hätten. Wir kannten uns vor jenem Abend nicht und für mich war er bisher eher Teil des schnapsfleckigen, nach vergälltem Leben stinkenden Interieurs der Kellerkneipe als deren Kundschaft. Zu jener Zeit verbrachte ich meine nüchternen Stunden damit, tagsüber in einem Lebensmittelgeschäft in der Warwick Street auszuhelfen, um abends das verdiente Geld an abgewetzten Roulettetischen mit bösartiger Gleichgültigkeit an die Bank zu verschenken. Diese Gleichgültigkeit dem Leben gegenüber war mir seit jeher ein treuer Begleiter, ein Schatten neben mir. Ich ließ mich lieber treiben und nahm hin, was kam. Wahrscheinlich fiel es mir deshalb so leicht, mich seit ungezählten Jahren in einem anhaltenden Rauschzustand zu ertränken, ohne je Schuld darüber zu empfinden. Diese Abende waren nun mal alles, was blieb.
An einem dieser Abende trieb es mich zu Al, hier scherzhaft als „Uncle Albert“ bekannt, dessen zweifelhafter und doch liebevoll-nachsichtiger Ruf in jener Kneipe mir bereits vor unserem ersten und einzigen Wortwechsel sein tägliches Kommen und Bleiben versicherte. Er war ein wirrer und unsteter Mensch, der früher als Mittelklasseboxer seine Alkoholexzesse in Löchern wie diesem finanzierte, den die erfolglosen Jahre aber zahm und stumpf haben werden lassen, sodass ihm von seinem ohnehin schon bescheidenen Lokalruhm nur eine mickrige monatliche Versehrten-Abfindung des Kensington Boxing Clubs und eine scharf nach rechts zerschlagene, weinrote Rosazea geblieben waren.
Ich erinnere mich noch an das staubige Licht im Keller, das seine grobschlächtige Rechte matt schimmern ließ, während sich die massige Faust um ein schäumendes Pint schloss. Ich hatte soeben eine schon nicht mehr verschmerzbare Menge Pfund verloren, war allerdings bereits zu betrunken, um mir über mein Unglück ernsthafte Sorgen zu machen. Mein selig schwimmender Blick verlor sich im goldenen Brausen eines heimischen Ozeans und ich hätte nicht sagen können, wie lange ich so dasaß: den müden, verbrauchten Körper mühsam auf einem Hocker haltend, von den weniger besorgten als sichtlich angewiderten Mienen der Mitspielenden unberührt und den eigenen Blick rettungslos ertrunken im gewürgten Bierglas von „Uncle Albert“.
An diesem Abend stürmte es heftig. Ein grausamer Windzug jagte über die kahle Rundung meines Hinterkopfes und ließ mich aus dem Bann aufschrecken, nachdem er ein Kellerfenster samt Rahmung aus der Fassung gesprengt hatte und den düsteren Raum durchflutete. Als ich meinen Blick löste und aufschaute, bemerkte ich, dass Al diesen erwiderte. Er blickte mit seinen zusammengerückten Säuferaugen streng in mein Gesicht, als prüfe er mich. Worauf wusste ich nicht. Die geblähten, mit den rötlichen Pusteln vergangener Leben befleckten Wangen rahmten seinen Blick und gaben ihm, trotz des unübersehbaren Verfalls seiner Züge, das würdige Aussehen einer antiken Anemoi-Darstellung. Gerade als ich spürte, wie mich die Kraft verließ, seinem Richterblick standzuhalten, hob er schwerfällig seine Linke und winkte mich mit einer abfälligen Bewegung zu sich. Ohne zu wissen warum, erhob ich mich und trottete langsam, aber entschieden auf den Tisch in der dunklen Ecke des Raumes zu.
„Du bist hier öfter, als dir guttut“, sprach der alte Al, als ich stumm Platz genommen hatte. Seine Stimme hatte eine raue Klangfarbe, aber seine Worte klangen nicht wertend oder gar beschämend: es waren von zwischenmenschlichen Banden vollkommen losgelöste Worte, ohne Anklage oder Mitgefühl, gefühllose Tatsachen, steinern und unbeweglich wie prähistorische Monolithen. Ich hatte das Gefühl der Wind, dem der Kneipenbesitzer trotz wütend gebellten Befehlen nicht Herr zu werden schien, spielte nun eine fürchterliche Kantate. „Wo sollte ich sonst sein?“, gab ich mit verwaschener Stimme zurück, die Augen wagte ich nicht vom vernarbten Tisch zu heben. „Da draußen natürlich“, sprachs aus der Ecke und ich hatte das Gefühl die denkbar schlechteste Antwort gegeben zu haben. Die schlichte Bestimmtheit seiner Rede irritierte und erregte mich. „Heutzutage weht ein anderer Wind. Nie zuvor war es so leicht abzusaufen“, setzte er nach. Ich nickte stumm, doch verstand nicht, was er meinte. Mir fiel auf, dass er mich beim Sprechen nicht anschaute. Auch sein Blick kämpfte nun einen hoffnungslosen Kampf am Grund seines Glases. Eine Weile verharrte er in dieser Stellung, ohne meine Verwirrung zu lösen. Dann hob er erneut an:
„Dort draußen gibt es stählerne Inseln, in denen Männer wie du und ich noch einen Wert haben. Den Wert eines Zahnrädchens in einem Getriebe, zugegeben, aber ein Wert doch!“ beschwor er, plötzlich stürmisch aufbrausend, wobei er mir feine Tropfen wie Nieselregen entgegenspuckte. „Familienbande eingeschworener Schatzjäger im Kampf gegen die Gezeiten und auf der Suche nach dem schwarzen Gold. Ein lohnendes Geschäft für manche Tagelöhner. Aber für Männer wie uns …“, er pausierte, versuchte den versprengten Atem in tiefen Zügen wieder einzusaugen, „für Männer wie uns, können diese Inseln weitaus mehr sein.“ In atemloser Spannung wartete ich. Worauf, wusste ich nicht. „Hände über dem Wasser, Köpfe über dem Horizont.“, hauchte er endlich und mir war, als hätte er uns beide damit erlöst. Ich erhob mich und wankte schwerfällig, aber bestimmt zur Kellertreppe.
Sturzbetrunken stolperte ich aus der schweren Vordertüre hinaus auf die menschenleere Gasse. Noch bevor sie wieder zufiel, hatte der Wind, der außerhalb des Kellers kreischend durch die schiefen Häuserschluchten fegte, bereits alle Geräusche aus dem Innern verschluckt. In meinen Ohren pfiff es unangenehm und ich spürte den Drang, wieder hineingehen zu wollen – nur raus aus diesem Wind. Nur wusste ich, dass das nun nicht mehr möglich war. Nie wieder würde ich das Ship&Mitre betreten. Ich zog den Kragen meines zerschlissenen Regenmantels bis an die Schläfen hoch und ließ mich einem unbestimmten Ziel entgegentreiben.
Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, wie lange ich durch die winddurchflutete Nacht irrte. Es müssen wohl mehrere Stunden gewesen sein, denn als ich, noch taumelnd und von schieferschwarzen Möwen mit geteertem Gefieder träumend, zu mir kam, stand ich an den Docks, auf dem St. Nicholas Place. Schwer atmend starrte ich in das graue Treiben des Hafenbeckens hinein und dachte an „Uncle Albert“. Seine letzten Worte waren unauslöschlich in meine trunkene Seele eingebrannt.
Da spürte ich es: Der Wind, der, seit ich mich meines Bewusstseins wieder ermächtigt hatte, unbarmherzig vom Nordatlantik her blies, musste sich gedreht haben, denn ich spürte, wie er sich nun an meinem gekrümmten Rücken brach und über meine durchnässten und heftig zitternden Schultern hinweg aufs offene Meer flüchtete. Unwillkürlich hob ich den Blick und erkannte weit über mir auf dem Dach des Royal Liver Buildings, dem stürmischen Tosen in heroischer Haltung trotzend, die bronzenen Schwingen von sich streckend den Stadtpatron, dessen gebieterischer Blick dem Wind aufs Meer hinaus folgte. „Hände über dem Wasser, Köpfe über dem Horizont“, hörte ich es aus einer dunklen Ecke meines Bewusstseins sprechen und wusste doch – diese Stimme gehörte mir.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Miriam Bußkamp
Filterzelle
Mittwoch
Ich fahre auf das vielleicht schönste Licht zu, das der Himmel hervorbringen kann. Alles ist wie durch einen Pastellfilter getaucht, nichts Grelles liegt mehr in der Luft. Stattdessen ist der Horizont in der Entfernung schüchtern gerötet, streicht auf eine makabere Weise zärtlich über die Wipfel der riesigen Nadelbäume, die die Interstate zu beiden Seiten säumen. Es ist ein tückischer Nebeneffekt von Luftverschmutzung, dass die erhöhte Partikeldichte uns nicht abschreckt, sondern das Licht in so schönen Tönen streut, dass wir uns daran nicht satt sehen können. Nur ein paar Meilen östlich von hier machen sich ganze Vororte darauf gefasst, jederzeit eine Evakuierungsmeldung zu erhalten. Es ist seltsam, in diese Richtung zu fahren, in die Richtung der Waldbrände. Ich habe jedoch keine Wahl. Hier im Süden der Stadt liegt der einzige Baumarkt, bei dem ich noch eine Filterzelle zur Abholung vorbestellen konnte. Eine Filterzelle, wie sie in Klimaanlagen verbaut werden: ein Viereck aus grauer Pappe mit weißen Paneelen aus Vlies. Schöner wäre einer der kleinen, dekorativen oder unscheinbaren Luftfilter gewesen, wie man sie sich normalerweise in die Wohnung stellen würde. Die sind aber nirgends mehr zu bekommen. Die hässlichen Filterzellen sind ebenfalls knapp geworden, seit die Lokalzeitung gestern eine Bastelanleitung veröffentlicht hat, wie man aus ihnen einen provisorischen Luftfilter bauen kann. Aber ich hatte Glück. Eine der letzten vorrätigen Filterzellen hat es online in meinen Warenkorb geschafft. Ich hole die Filterzelle ab, weil der Versand zu lange dauern würde.
Wieder zuhause lässt sich die Filterzelle mit Gaffer-Tape problemlos an unseren eckigen Ventilator anbringen. Wir klemmen den Ventilator sonst morgens und abends in unsere Schiebefenster, um kühle Luft in unsere Wohnung zu leiten. Jetzt bekommt er die Aufgabe, die Luft im Raum durch die Filterzelle zu ziehen und gereinigt wieder in Umlauf zu bringen. Wir beobachten die Nachrichten zu den Bränden und der Rauchentwicklung und schalten unseren selbstgebauten Luftfilter ein, als die Werte der Luftqualität am Abend im violetten Bereich gemeldet werden, very unhealthy.
Dann schauen wir uns an, wie am Morgen Caleb Ewan die elfte Etappe der Tour de France gewonnen hat. Neun Stunden Zeitverschiebung, der Atlantik und die gesamte Breite des nordamerikanischen Kontinents trennen uns von Châtelaillon-Plage. Wir bekommen den malerischen Küstenort erstmal aus der Vogelperspektive zu sehen und ich frage mich, ob die Strecken von einer französischen Tourismusbehörde ausgewählt werden. Ich jedenfalls hätte nichts dagegen, dort ein paar Tage meine Zehen in den Sand zu graben, ganz ohne das Bedürfnis, hundertsiebzig Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Ganz ohne die Anstrengung, die den Fahrern schon bald im Gesicht steht und sie durch die Etappe begleitet.
Es ist heute keine kleine Ausreißer-Gruppe, die ins Ziel einfährt. Es ist ein Pulk von gut dreißig, der sich geschlossen der Zielgerade von Poitiers nähert und in dem jeder Fahrer auf den perfekten Moment für einen Vorstoß wartet. Ich habe mich noch immer nicht an den Anblick der Menschenmenge gewöhnt, von der sie am Etappenende angefeuert werden. Dicht an dicht stehen die Zuschauer entlang der Banden. Es ist lange her, dass ich zuletzt eng bei anderen Menschen gestanden bin.
Donnerstag
Es wird nicht richtig hell heute. Wo sonst blauer Himmel zu sehen ist, erstreckt sich ein orange getöntes Grau. Die Sonne schafft es nicht, die Rauchdecke zu durchdringen, während der Rauch selbst keine Schwierigkeiten hat, überall hin einen Weg zu finden. Wir riechen ihn im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, überall. Es reicht nicht, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wir leben in einem alten Haus und wenn wir die Fenster schließen, trifft verzogenes Holz auf verzogenes Holz. Wir tragen zusammen, was wir an Tüchern und Lappen haben und dichten die Rahmen ab so gut wir können. Dann lassen wir den Luftfilter eine Weile in allen Räumen laufen.
Der Tag zieht sich. Nach einem halben Jahr im Lockdown bin ich übersättigt an Geschichten. Ich kann keine Romane mehr lesen, keine Serien mehr schauen, keine Podcasts mehr hören. Sie machen mir keinen Spaß mehr, weil sich mein Leben nicht mehr an ihnen reiben kann. Mein Leben steht auf Pause.
Stattdessen verfolge ich die Nachrichten rund um die Ausbreitung der Brände, die Prognosen und die Evakuierungen. In den letzten Monaten ist es zur Routine geworden, täglich die R-Werte für Oregon, die USA und Deutschland zu beobachten. Jetzt ist es der LQI, der Luftqualitätsindex, den ich zuerst checke und der heute noch schlechter ist als gestern.
Die Brände fressen sich immer weiter in die Wälder.
Der Rauch wird bleiben, bis der Wind sich dreht.
Nach mehr als 100 Tagen durchgehender Proteste für Black Lives Matter, geht heute niemand in Portland auf die Straßen.
Präsident Trump verkündet, dass die Waldbrände nicht im Klimawandel, sondern allein in schlechtem Forstmanagement begründet sind. Dieser bullshit hat die gleiche Farbe wie unser neuer LQI: braun, hazardous.
In Etappe zwölf fährt Marc Hirschi dem Peloton schon früh davon. Nach dem letzten Aufstieg der Etappe lässt er alle hinter sich und fährt die letzten dreißig Kilometer im Alleingang. Mir fällt vor allem der Kontrast zwischen den trockenen, abgeernteten Feldern in der Ebene und den üppigen Wäldern in der Höhe auf. Ich frage mich, wie schnell sich dort ein Feuer ausbreiten würde. Die Bäume auf dem Bildschirm sehen saftig aus, aber ich weiß, dass der Schein trügen kann. Schließlich kommen mir auch beim Wandern hier in Oregon die immergrünen Wälder vor wie ein ewiges Paradies. Die Nadeln reihen sich dicht an dicht um die feinen Zweige, die wiederum von starken Ästen gehalten werden. Moose schlängeln sich auf der Schattenseite die Rinde entlang. Hohe Farne aus sattem Grün bedecken den Boden. Ich liebe es, dass die Sommer hier heiß und trocken sind. Ich habe mich daran schneller gewöhnt als die Bäume, denen ich den Wassermangel nicht ansehen kann und die den Bränden trotzdem nichts entgegenzusetzen haben. Der kleinste Funkenflug sorgt für neue Brandherde.
Freitag
Portland ist heute offiziell die Stadt mit der schlechtesten jemals gemessenen Luftqualität. Weltweit. Die bisher verwendete LQI-Skala kann den aktuellen Wert nicht abbilden. Sie endet bei 500, aber wir liegen heute bei 504.
Ich fühle mich eingesperrt. Spaziergänge waren in den letzten Monaten fast der einzige Anlass, das Haus zu verlassen. Nun sitzen wir im Wohnzimmer wie zwei Heuschrecken unter einem umgestülpten Marmeladenglas. Wie lange dauert es eigentlich, bis die Luft in einer Wohnung so verbraucht ist, dass sie zu wenig Sauerstoff enthält? Ich widerstehe dem Drang, Google zu fragen. Stattdessen checke ich das Wetter, schaue, ob die Meteorologen zuversichtlich sind, dass wir bald wieder auflandigen Wind bekommen. Fehlanzeige. Enttäuscht lege ich das Handy zur Seite. Ich muss raus. Wenn Spaziergänge draußen nicht möglich sind, dann muss ich eben in einem Gebäude spazieren gehen.
In der Mall ist nicht viel los. Warum sollte es auch? Ich habe gehofft, dass sie mir Schutz vor dem Rauch bieten würde, aber durch meine Stoffmaske schmecke ich noch immer eine Note in der Luft. Lange sollte ich nicht bleiben.
Ich komme mir komisch vor, an den schlecht besuchten Geschäften vorbei zu schlendern, mir Dinge anzusehen, für die ich selbst dann keine Verwendung hätte, wenn keine Pandemie und keine Waldbrandkrise wäre. Trotzdem spüre ich die Verheißung, dass ich mit neuen Dingen auch neue, gute Gefühle nach Hause nehmen könnte. Ich gehe in ein Kosmetikgeschäft und schaue mir Lippenstifte an, wie ich sie gerne trage, aber es nur noch selten tue. Am Ende verschmiert die Farbe doch nur in der Maske.
Der Smalltalk mit der Verkäuferin wird schnell persönlich. Ihr Onkel lebe unweit von hier in der Kleinstadt Molalla und ignoriere die Aufforderung zur Evakuierung seitens der Sicherheitsbehörden, erzählt sie. „Er bleibt, weil auf Facebook geteilt wurde, dass die Antifa die Feuer gelegt hat, um danach die evakuierten Häuser zu plündern. Ich weiß nicht, wie ich ihn davon überzeugen kann, dass das eine Lüge ist.“
Ich stelle mir vor, wie es wäre, den ganzen Tag in diesem fensterlosen, verrauchten Laden zu stehen und mir Sorgen zu machen, weil sich jemand in meiner Familie bei einer akuten Gefahrenlage lieber an Verschwörungstheorien hält als an die Warnungen der Behörden.
Die Verkäuferin hält meinen Blick, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. „That‘s so fucked up“, ringe ich mir schließlich ab, „ich hoffe, dein Onkel bringt sich bald in Sicherheit.“
Sie seufzt mit hängenden Schultern, die mir die gesamte Rückfahrt vor Augen bleiben.
Bei der Tour de France trennen heute sieben Bergabschnitte die Fahrer von Puy Mary und deshalb zeigt die Zusammenfassung vor allem Bilder, in denen die definierten Wadenmuskeln der Fahrer langsam, aber kraftvoll gegen die Steigung um die Pedalachse kreisen. Zum Angriff erheben die Fahrer sich dann aus dem Sattel und die Fahrräder unter ihnen schwanken. Unser Luftfilter surrt im Takt dazu. Die körperliche Verausgabung hat ihren Reiz. Das Gefühl der Erschöpfung und Zufriedenheit, nachdem man alles gegeben hat, die Ruhe, wenn Atem und Puls sich verlangsamen. Der Stolz, eine Herausforderung gemeistert zu haben. Ich beneide sie. Unsere Herausforderung ist passiv, ein Aussitzen. Wir können unsere Kräfte nicht einteilen, weil wir nicht wissen, wie lange wir sie brauchen werden. Dreißig Kilometer und fünfzehn Prozent Steigung klingen leichter zu bewältigen als bis ein Impfstoff da ist oder bis sich das Wetter ändert.
Samstag
Die Nachrichten in Deutschland berichten abermals über die schlechten Luftqualitätswerte. Wir wachen auf zu verschiedenen Textnachrichten von Freunden und Familie. Wir telefonieren viel und erzählen das Wenige, das es aus dem Marmeladenglas zu berichten gibt.
Als ich den Müll rausbringe, friere ich. In der Rauchdecke ist es nicht nur dunkler, sondern auch kälter. Ohne sie würde die Sonne uns noch immer sommerliche Temperaturen bescheren. Der Geruch von Lagerfeuer dringt mir in die Nase, stärker als zuvor. Ich denke an die zerstörten Wandergebiete, die dieser Rauch bedeutet; Häuser, die bis auf den Grund herunterbrennen, ausgelöschte Leben. Acht Menschen sind den Bränden in Oregon schon zum Opfer gefallen und wer weiß, wieviele Tiere ihnen in der Wildnis und auf den Farmen nicht entkommen konnten. Dieser Geruch ist nicht nur Douglasfichten und Farne, er ist auch Fotoalben, Fernseher, Plastikstühle. Haut, Fell und Knochen. Und er überlagert alles. Den faulenden Müll rieche ich nicht, als ich den Deckel der Bio-Tonne hebe.
Zurück im Wohnzimmer kommt mir die gefilterte Luft dagegen frisch vor, obwohl es dieselbe ist, die schon seit über drei Tagen in diesem Raum zirkuliert. Die Zeltburgen der Obdachlosen, deren Kuppeln seit Beginn der Pandemie zahlreicher geworden sind, kommen mir in den Sinn. Die hastig eingerichtete Notunterkunft auf dem Messegelände wird vor allem von Menschen aus dem südlichen Oregon genutzt, die vor den Feuern hierher geflüchtet sind.
Fast stündlich suchen wir nach Updates, wie schnell sich die Feuer ausweiten und wie sich die höchste Evakuierungsstufe an diesen immer neuen Grenzen des Gefahrenraums entlang hangelt. Satellitenbilder zeigen im Zeitraffer, wie Glutfelder, größer als Ortschaften, mit dem Wind größer werden; wie sie erst kleine Rauchwirbel über die angrenzenden Gebiete schicken, bis diese immer weiter werden und schließlich zu einer Decke. Einer Decke aus Rauch, die sich über die gesamte Westküste legt, bis man gar nicht mehr weiß, wo der Rauch des einen Feuers aufhört und der eines anderen anfängt.
Drei Kilometer vor dem Etappenziel in Lyon startet Søren Kragh Andersen den Angriff, der den Sieg entscheiden wird. Er fährt, fährt sich frei und hat genug Kraftreserven, um das Tempo bis zum Schluß alleine durchzuhalten; hat sogar noch genug Kraft, hinter der Ziellinie die Arme in die Luft zu strecken und seine Leistung zu feiern. Meine Beine kribbeln, wollen rennen, schnell, bis sie nicht mehr können. Ich kann nicht mehr sitzen und gehe stattdessen im Raum auf und ab. Der Jubel. Selbst von der reduzierten Zahl des Pandemiepublikums klingt er enorm. Mein Blick fällt aus dem Fenster, hinter dem der Rauch die Aussicht auf die leere Straße trübt.
Sonntag
Wir sind früh wach. Wir tragen den Luftfilter ins Wohnzimmer und schalten ihn ein, dann starten wir den Live-Stream für die fünfzehnte Etappe der Tour de France. Während wir frühstücken, bestreiten die Fahrer die zweite Bergwertung, eine schattige Strecke. Fokussiert rasen sie danach waghalsig die Landstraße herunter. Fast spüre ich den Wind im schweißnassen Nacken, wie die müden Beine sich erholen, während am Rand Zuschauer, Bäume, Höfe vorbeiziehen. Die Abfahrt ist schneller vorbei, als den Fahrern vermutlich lieb ist, denn ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Am Bildschirmrand wird eine Grafik mit dem Anstieg zum Grand Colombier angezeigt. 17,4 Kilometer, mit Steigungen von bis zu zwölf Prozent. Es gibt keinen Schatten mehr, die Serpentinen liegen offen in der erbarmungslosen Sonne. Am Ende kämpft sich Tadej Pogačar knapp vor Primož Roglič ins Ziel.
Wieder prüfen wir, wie sich die Brände entwickelt haben. Sie sind ein kleines Stückchen weiter in Richtung der Vororte Portlands gewandert. Ich stelle mir die Einsatzkräfte vor, die der Hitze und dem Rauch in schwerer Schutzkleidung und mit wenig Pausen ausgesetzt sind, die an ihre Grenzen gehen, um diese Übermacht in allerkleinsten Schritten einzudämmen. Das Feuer müsste die halbe Stadt verschlingen, um uns zu erreichen. Für unseren Stadtteil gibt es keine Warnungen. Ich weiß das. Trotzdem bestehe ich darauf, eine go bag zu packen. Unsere Ausweise, wichtige Dokumente, ein Handyladegerät, Taschenlampe, der Schmuck meiner Großmutter, alles wandert in einen Rucksack, der nun neben der Tür steht. Auch wenn ich weiß, dass es sinnlos ist, tut es gut, irgendwas zu machen, einem Impuls zu folgen, nicht nur zu warten. Es fühlt sich an wie ein Vorsprung vor einer Situation, die nicht wahrscheinlich ist und trotzdem bedrohlich aus den Nachrichten zu uns kommt: dass Menschen im Ernstfall zu spät losfahren, dass sie im Stau stehen und nicht vorankommen, während die Brände sie einholen.
Das Packen ist schnell erledigt. Dann liegt der Tag wieder weit vor uns, konzentriert auf den Luftfilter in unserem Wohnzimmer. Ich setze meine Kopfhörer auf, weil ich eine Pause von seinem Brummen brauche und checke wieder, ob sich der Wind bald drehen soll. Noch sehen die Meteorologen keine Anzeichen dafür. Nun befrage ich doch das Internet, wie lange es bei minimaler Zufuhr dauert, bis der Sauerstoffgehalt in einer Wohnung zu niedrig ist.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at