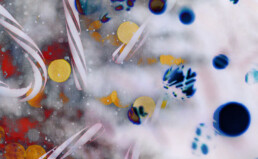freiTEXT | Carolina Reichl
Die Verteilung des Glücks
Du drückst das Gesicht in das Kopfkissen und heulst. Du hast die Nachprüfung nicht geschafft und musst das erste Jahr wiederholen. Ich sitze neben dir und streichle dir über den Rücken.
„Ich wäre gerne wie Katrin“, sagst du. „Ihr gelingt immer alles, ohne dass sie sich dafür anstrengen muss. Das ist unfair.“
Ich nicke. Es ist kein Geheimnis, dass das Glück in unserer Familie ungleich verteilt ist. Während du dich mit Mathe, Pickeln und den dummen Sprüchen deiner Mitschüler quälst, schreibt Katrin gute Noten, sieht gut aus und ist beliebt. Sie hat ein lautes, heiteres Lachen und ist umgeben von Menschen, die genauso lachen. Wenn man Katrin sieht, hat man das Gefühl, leben ist einfach, glücklich sein etwas, das jeder auf die Reihe kriegen sollte.
Ich beneide sie, weil sie nichts zu bedrücken scheint.
*
Unsere Mutter hält Katrin die Zigaretten vors Gesicht.
„Du bist erst vierzehn! Versprich mir, dass du das nie wieder machst!“, brüllt sie. Katrin schaut schuldbewusst zu Boden. Mutter dreht sich zu uns.
„Und ihr, ihr fangt erst gar nicht damit an!“
„Versprochen“, sagen wir im Einklang.
Wir gehen in Katrins Zimmer. Sobald die Tür zu ist, zündet sie sich eine neue Zigarette an. Sie schwört uns, dass sie damit nie aufhören wird. Sie liebt Camel Blue. Schon als Kind fand sie die Verpackung toll, wegen der blauen Farbe und des Kamels. Du nimmst ihr die Packung aus der Hand und liest ihr die Warnhinweise vor.
Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen.
Raucher sterben früher.
„Hast du nicht Angst?“, fragst du.
„Wovor?“
„Dass du auch Krebs bekommst.“
Sie schüttelt den Kopf.
„Daran denk ich nicht.“
Wir sitzen auf deinem Bett und schauen aus dem Fenster. Es dämmert. Wir sehen, wie Katrin das Haus verlässt und sich eine Zigarette anzündet. Sie ist die Erstgeborene und das unangefochtene Lieblingskind unserer Mutter. Sie verzeiht Katrin alles, auch dass sie sie immer wieder beim Rauchen erwischt.
„Es wäre schön, wenn wir noch einen Vater hätten, der könnte dann dich oder mich bevorzugen“, sage ich. Du seufzst.
„Weißt du noch, wie er war?“
Du schweigst. Dann: „Schwer zu sagen. Er war damals schon viel im Krankenhaus.“
Du warst fünf, als er starb, ich vier, Katrin sieben. Sie müsste bestimmt die ein oder andere brauchbare Erinnerung an ihn haben, doch ich traue mich nicht, sie zu fragen.
Sie spricht nie über ihn.
Würde ich sie fragen, ob sie sich an ihn erinnern kann, bevor er krank wurde, würde sie vermutlich mit den Schultern zucken und sagen: „Was bringt das schon?“
*
Katrin sitzt mit großen Augenringen beim Frühstück. Ihre Haare riechen stark nach Rauch. Es wundert mich, dass unsere Mutter nichts dazu sagt.
Ich flüstere ihr zu: „Du stinkst.“
Sie gibt mir einen Tritt.
„Au!“, schreie ich.
„Ist was?“, fragt unsere Mutter. Ich schüttle den Kopf.
Ich frage mich, ob sie nicht merkt, dass Katrin sich in der Nacht regelmäßig rausschleicht oder ob sie es nicht merken will. Auf Katrins Unterarmen sind verwischte Stempelreste und Armbänder von den Klubs zu sehen, an denen sie am Vorabend war. Wir sitzen noch bei Tisch, da setzt Katrin sich ihre Kopfhörer auf. Sie dreht auf die oberste Lautstärke. Ich glaube, Katrin braucht den Lärm. In der Stille wird sie nervös. Erst ein Lärmpegel, der es einem unmöglich macht, sich noch auf irgendwas zu konzentrieren, lässt sie innerlich ruhig werden.
Du klopfst an meine Tür.
„Darf ich reinkommen?“, fragst du. Ich nicke. Du setzt dich auf mein Bett.
„Ich mach mir Sorgen um Katrin.“
Du verstehst nicht, wieso sie sich ständig wegschleicht. Du bist mittlerweile 16, du dürftest am Wochenende fortgehen, aber das machst du nicht. Du magst den Lärm, die grellen Lichter und das Gedränge nicht und am allerwenigsten magst du die Vorstellung, die Kontrolle zu verlieren und am nächsten Tag so verkatert wie Katrin zu sein, dass man nichts anderes machen kann, als im Bett zu liegen, als wäre man krank.
Du zögerst, ehe du hinzufügst: „Man sagt so Sachen über Katrin.“
„Was für Sachen?“
Dass sie am meisten Shots trinken kann und bei Partys als erste kotzt. Dass ihre Brüste geil sind und dass ihre Brüste ohne BH gar nicht so geil sind. Dass jeder auf sie steht und dass sie nichts für was Ernsthaftes ist, weil sie sich am Schulklo fingern lässt.
„Glaubst du, das stimmt?“, fragst du. Wir überlegen hin und her.
Wahrscheinlich nur Gerüchte, sagen wir uns dann.
Irgendwann hört das schon wieder auf.
*
Katrin geht nach Wien studieren und ihre Geschichten erreichen uns noch immer.
Als sie das nächste Mal nach Hause kommt, sprichst du sie darauf an.
„Ist doch egal“, sagt Katrin. Sie macht, worauf sie Lust hat und jeder, der darüber ein schlechtes Wort verliert, ist neidisch. Stolz zeigt sie dir Fotos, mit wem sie gerade schreibt.
„Wie lange willst du noch so weitermachen?“, fragst du. „Hast du nicht das Gefühl, dass es reicht? Willst du dir nicht irgendwann einen Freund suchen?“
„Nein“, sagt Katrin. „Und Kinder will ich auch nicht. Ich bleib lieber allein.“
Du verdrehst die Augen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass man ohne Kinder glücklich wird. Du willst zwei, vielleicht sogar drei.
Sie zündet sich eine Camel an und äschert dir vor die Füße.
„Du machst dich damit nur kaputt“, sagst du.
*
Wir kommen zum Mittagessen. Du bist gerade in deine erste eigene Wohnung gezogen.
„Schön hast du’s“, sagen wir. Du wohnst allein. Es gibt Frittatensuppe und Schnitzel. Nach der Hauptspeise sagst du, dass etwas in dir wächst. Du versuchst wiederzugeben, was die Ärzte gesagt haben. Am Montag wirst du mit der Chemo anfangen. Du weißt es schon länger, du wolltest uns nicht beunruhigen.
Ich frage nach Metastasen.
Du sagst: „Nein.“
Dann: „Doch.“
Ich drücke meine Lippen gegen die Faust, ersticke den Schrei mit offenem Mund. Katrin weint in deinen Armen. Du streichelst ihr über den Rücken. Die ganze Trauer, die eigentlich deinen Körper erschüttern sollte, scheint in Katrins gewichen zu sein. Ich denke: Es hätte sie treffen sollen.
Als Katrin aufgehört hat zu weinen, sehe ich genau, wie sie sich zusammenreißen muss, um sich nicht vor deinen Augen eine Zigarette anzuzünden.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
18 | Carolina Reichl
Die Wunschlosen
Du sagst, es ist spät. Ich schaue auf die Uhr, die du mir vor Jahren geschenkt hast, auf der Innenseite hast du mir was eingravieren lassen. Numquam retro. Niemals zurück.
Es ist nachts, zwei Uhr einundzwanzig. Meine Augen sind ausgetrocknet, zu lange habe ich auf den Bildschirm geschaut. Fünf Stunden, 39 Minuten, um genau zu sein.
Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, darauf zu achten, wie viel Zeit ich für was brauche. Sechs Stunden Schlaf, 43 Minuten im Bad (morgens und abends zusammen), zehn Stunden in der Arbeit. Die restliche Zeit kümmere ich mich um deinen Kater Morli, in der Hoffnung, dass er sich irgendwann von mir berühren lässt, und gehe zu deinem Grab. Mindestens zweimal die Woche pflege ich es. Die Leute sollen schon von der Ferne sehen, dass dein Grab am schönsten ist, damit sie merken, dass du wichtig bist.
Ansonsten habe ich keine Hobbys, ich mache den Haushalt und bereite meine Patientengespräche vor.
Ich bin effizient.
Wenn ich mich entspanne, fühle ich mich faul.
Nur wenn ich nach Hotels schaue, kann es passieren, dass ich mich für Stunden verliere. Ich plane eine Weltreise, darunter ein zweiwöchiger Aufenthalt in Peru. Ich recherchiere nach den besten Unterkünften, Ausflügen, Lokaltipps und Reiserouten, bis ich so erschöpft bin, dass ich nicht mehr kann. Ich schließe den Laptop, ich bin voller Adrenalin. Ich stelle mir vor, wie das wohl sein wird. Peru, Island, Litauen, Japan, Indonesien, Australien, Hawaii, L.A., New York. Wissend, dass keiner von diesen Urlauben jemals für mich stattfinden wird.
Aber warum, du würdest doch gerne verreisen, sagst du. Es hätte nichts geändert, wenn du bei mir geblieben wärst.
Mein Handy vibriert.
Unsere ältere Schwester Katrin schreibt, ob ich nächsten Samstag zu ihr komme.
Wegen Weihnachten.
Ich seufze.
Schön wieder ein Jahr vergangen.
Katrin hält den Gedanken nicht aus, dass ich den 24. Dezember alleine verbringe oder so wie vor zwei Jahren den ganzen Tag an deinem Grab stehe. Zu groß das schlechte Gewissen. Beim Weihnachtsfest selbst will sie mich aber nicht dabei haben, nicht dass ich die Stimmung runterziehe, ich soll am Vormittag kommen.
„Till ist mit den Kindern einen Baum aussuchen“, sagt sie. Sie öffnet einen Prosecco. Wie eine Sanduhr bei einem Saunadurchgang markiert die Flasche unser gemeinsames Zeitfenster, das anzeigt, wie lange ich noch durchhalten muss, bis ich wieder verschwinden kann.
Ich schenke ihr eine Orchidee, Pralinen und ein Buch, das sie vermutlich niemals lesen wird. Sie sagt, das wäre nicht nötig gewesen. Es ist nicht leicht, jemanden zu beschenken, der schon alles hat.
„Für dich“, sagt sie und hält mir einen Reisegutschein entgegen. Letztes Jahr Wizz Air, dieses Jahr Tui. Ich bedanke mich, doch ich greife ihn nicht an.
„Freust du dich nicht?“, fragt sie.
„Doch. Ich kann ihn nur nicht annehmen.“
„Warum nicht?“
„Du weißt doch, dass ich Morli nicht alleine lassen kann.“
„Er kann bei mir bleiben.“
„Die Kinder würden ihn stressen. Außerdem muss ich auf meine Patienten schauen. Mir wäre nicht wohl dabei, ein Wochenende nicht erreichbar zu sein.“
„Du arbeitest zu viel.“
Sie hat recht, meinst du. Ich schüttle den Kopf.
„Wann warst du das letzte Mal auf Urlaub?“
Ich zucke mit den Schultern, als wüsste ich es nicht. Es sind drei Jahre, elf Monate und zwei Tage, seitdem du tot bist.
„Hast du kein Fernweh?“
„Ich glaub, ich brauch das Reisen nicht mehr“, sage ich.
„Blödsinn!“, ruft Katrin. „Mit ihr wolltest du noch eine Weltreise machen! Du warst immer so gern unterwegs und jetzt dreht sich alles nur noch um deine Psychopraxis!“
Katrin hält nichts von Psychotherapie. Sie glaubt, dass das Geldabzocke ist, dass die Leute nur an ihren Profit denken, wenn sie sich am Leid der anderen bereichern. Sie findet, mit seinen Problemen muss jeder selbst fertig werden; es bringt nichts, seine Sorgen immer wieder durchzukauen. Man muss weitermachen, sich auf das Gute konzentrieren, dann wird das schon.
„Und sonst?“, fragt Katrin. „Hast du irgendwas vor? Irgendwelche Pläne für die Feiertage?“
Ich schüttle den Kopf.
„Ich bin wunschlos.“
„Aber glücklich bist du nicht.“
Katrin trinkt den Prosecco aus und spricht mit ernster Stimme weiter: „Ich mach mir Sorgen um dich.“
Sie will wissen, was mich hier hält.
Ob es wegen dir ist?
Warum ich nicht loslassen kann?
Ihre Lippen bewegen sich weiter, aber ich höre nichts. Ich sehe deinen ausgetrockneten Mund, Katrin, wie sie dir den Speichel weg tupft. Ich sehe mich dir winken, euch sagen, ich hätte einen Notfall, einer Patientin geht es nicht gut. Ich verlasse das Krankenhaus, steige in ein Taxi und fahre zum Flughafen, ohne Gepäck buche ich dort den nächstbesten Flug, es geht nach Athen. Ich steige in den Flieger, ich komme an, ich lasse mich in einen Klub bringen, ich trinke, bis ich nicht mehr gerade stehen kann. Ich unterhalte mich, ich lache, ich tanze, ich mache alles, was du nicht mehr machen kannst. Ich habe Spaß, ich denke nicht an dich.
„Geht’s dir gut?“, fragt Katrin.
Mein Gesicht ist nass und salzig. Meine Haut glüht. Ich dachte, ich würde um dich trauern und dann würde es mir besser gehen, doch stattdessen bekomme ich jedes Jahr einen neuen Reisegutschein, den ich verfallen lasse und anstatt dem Rauschen der Wellen höre ich immer wieder die dröhnende Partymusik des Klubs und Katrin, die mich am nächsten Morgen anruft und sagt, du wärst friedlich eingeschlafen.
„Was ist?“
Ich kann nicht antworten, nicht denken, ich habe das Gefühl zu zerfallen, ich falle –
„Du warst sicher zehn Minuten weg.“
Katrin sagt, dass ich zu viel alleine bin und mehr auf mich schauen muss. Sie hätte mich mehrmals gerüttelt und meinen Namen geschrien, ich wäre am Boden gelegen und nicht ansprechbar gewesen.
Ich soll mir die Feiertage nehmen und mich entspannen, meinst du.
Ihr übertreibt.
Nach den Feiertagen gehe ich wie gewohnt zur Arbeit.
Numquam retro.
.
Carolina Reichl
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Carolina Reichl
FIASKO
Es ist Freitag und wie jeden Freitag gehen wir aus, weil man das so macht, wenn man sechzehn ist. Ich frage mich, wann ich das letzte Mal nüchtern etwas mit meinen Freunden unternommen habe. Ich erinnere mich nicht. Seitdem wir fortgehen dürfen, machen wir nichts anderes mehr.
Wir stehen in einem Kreis auf der Tanzfläche. Die Musik dröhnt in einer Lautstärke, die uns beinahe das Trommelfell platzen lässt; sie macht es fast unmöglich, einander zu verstehen. Hannah ist das schönste Mädchen im Raum, sie begrüßt mich mit einem Kuss.
„Kommt der Alex auch?“, brüllt sie.
„Der kann nicht.“
Ich weiß, dass sie sich über seine Abwesenheit freut. Normalerweise ist Alex immer da, wo ich bin. Sie mag Alex nicht. Sie sagt, er ist ein Angeber und Mitläufer.
„Warum war er die Woche eigentlich nicht in der Schule?“
„Weiß nicht.“
„Wie, du weißt es nicht? Er ist doch dein bester Freund.“
„Ich weiß es aber nicht“, antworte ich, so wie ich es ihm versprochen habe.
Außer mir haben alle Spaß. Hannah tanzt und lacht mit ihren Freundinnen, worüber, weiß ich nicht. Ich würde das auch gerne können, einfach so über alles und nichts lachen können. Ich versuche, mit Hannah zu tanzen, doch immer kommt eine Freundin dazwischen, die ihr etwas erzählen muss und sie von mir wegzieht. Ich fühle mich überflüssig, unsichtbar, als wäre ich Luft. Nur die Ellbogen, die mir die anderen in meinen Körper rammen, erinnern mich daran, dass ich existiere, mit Armen, Beinen, Bauch, Herz, Kopf, Arsch.
Ich schaue auf mein Handy. Alex hat mich zweimal angerufen und mir drei Nachrichten geschrieben.
Wie geht’s?
Können wir heute noch telefonieren?
Oder morgen? Ich brauch wen zum Reden.
Ich drücke die Nachrichten weg. Alex will nur über seine Probleme sprechen, dabei ist er schon bei einem Therapeuten, ich verstehe nicht, warum ich da zusätzlich herhalten muss. Mich zieht das nur runter. So weit, dass ich nicht weiß, ob ich mich von dort wieder aufraffen kann. Ich habe nicht vor, ihm zu antworten.
Ich bestelle eine Runde Tequila. Ich will so viel trinken, bis ich die Kontrolle verliere, nicht mehr klar denken kann und Alex vergesse. Hannah trinkt mit. Einer ihrer Freunde setzt aus.
Ich frage ihn: „Wieso?“
„Ich hab genug“, sagt er.
Ich verdrehe die Augen, stelle ihn als Langweiler hin, sage mit lallender Stimme: „Bist du schwul oder was?“
Die anderen lachen, Hannah verdreht die Augen, das kackt mich an. Sie soll mich lustig finden, ich will der lustigste Typ sein, mit dem sie je zusammen war.
Vor zwei Wochen habe ich ihr zum ersten Mal ich liebe dich gesagt. Sie hat es erwidert. Ich hab es danach nicht mehr gesagt. Sie auch nicht.
Der Barkeeper nimmt nur die Mädels dran. In ihren kurzen, weit ausgeschnittenen Kleidern beugen sie sich zu ihm, sie lernen gerade, auf Stöckelschuhen zu gehen, sie sind gerade mal halb so alt wie er.
„Kannst du mir auch was bestellen?“, frage ich die Blonde, die ein bisschen so aussieht wie Hannah, nur mit längeren Haaren und einen halben Kopf größer.
„Klar“, sagt sie und lächelt. Da sind wir auch schon im Gespräch. Im normalen Leben, also nüchtern und unter Tags, würde das nie passieren. Da redet man keine fremden Menschen an, egal wie durstig man ist oder wie dringend man etwas braucht. Doch in der Nacht gelten andere Regeln. Da spricht jeder mit jedem, da gibt es keine Grenzen.
Ich mache einen Witz. Sie lacht.
Ihre Hand liegt auf der Theke, gar nicht so weit weg von meiner. Ich könnte sie berühren, wenn ich meine Finger weit genug ausstrecke. Ich überlege sie zu küssen, um herauszufinden, ob ich noch Chancen beim anderen Geschlecht habe. Nur für den Fall, dass Hannah sich eines Tages nicht mehr für mich interessiert.
Plötzlich greift mich jemand von hinten an. Ich zucke zusammen.
Es sind Moritz und Alina, Freunde. Moritz drückt mich an sich heran und klopft mir zweimal auf die Schulter. Kaum macht er einen Schritt zurück, steigt mir ein süßlich chemischer Duft in die Nase. Alina packt meinen Nacken, zieht sich zu mir hoch und gibt mir einen Kuss auf die Wangen, links, rechts.
Wir sind jetzt in diesem Alter, wo wir uns zur Begrüßung nicht mehr Winken können. Seitdem wir in der Tanzschule sind, fassen wir uns alle mehr an, so als würde uns das zu besseren Freunden machen. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht zumindest vorher fragen können, ob man das will.
„Hannah sucht dich“, sagt Moritz. Ich nicke der Blonden zu, wir entfernen uns, verlieren uns aus den Augen, wahrscheinlich für immer.
Hannah und ich sind auf dem Heimweg, sind zehn Meter vom FIASKO entfernt. So heißt die Bar, die der Grund ist, warum es Alex schlecht geht. Das FIASKO ist klein, stinkt nach Kotze und Putzmittel. Leute in meinem Alter gehen da nicht hin. Da sitzen nur ein paar alte Alkoholiker, denken sie, und das stimmt auch.
Ich muss Hannahs Hand loslassen. Ich versuche, ruhig zu bleiben.
„Ist was?“
„Alles gut“, sage ich, als wäre das eine normale Bar, die mir nichts bedeutet, so wie jedem normalen Jugendlichen auch. Alex wäre da nicht reingegangen, hätte ich es nicht vorgeschlagen.
Es ist drei Uhr morgens, als ich die Tür aufsperre. Meine Eltern lassen mich kommen und gehen, als wäre ich ein Erwachsener, der selbst für alles Verantwortung übernehmen kann. Dabei bin ich erst sechzehn und sollten sich Eltern nicht immer um ihre Kinder Sorgen machen müssen?
Du musst sagen, wenn dich etwas stört, haben sie früher gesagt.
Wir können über alles reden.
Wir sind immer für dich da.
Doch sie schlafen.
Hannah kriegt ein T-Shirt von mir. Ohne Zähne zu putzen, legen wir uns ins Bett. In der Dunkelheit beginne ich sie zu küssen.
„Ich will schlafen“, sagt sie. Ich will die Zurückweisung nicht hinnehmen, bekomme Panik, dass etwas zwischen uns nicht mehr stimmt. Wir sind doch noch zu jung, um es nicht zu tun, weil wir müde sind, also küsse ich sie weiter. Sie versucht, meine Hand von ihrer Unterhose zu drücken, doch es ist nur ein leichter Widerstand und irgendwie erregt mich das auch. Ich bin stärker, die Gewissheit erleichtert mich. Ich presse meinen Körper gegen ihren. Sie weiß, dass sie mitmachen muss. Je länger sie sich ziert, desto länger wird es dauern. Also macht sie mit. Kurz verzieht sie das Gesicht, als würde ich ihr wehtun. Ich glaube nicht, dass Hannah weiß, was Schmerzen sind.
Nachdem ich gekommen bin, nehme ich sie in den Arm. Sie liegt auf dem Rücken und starrt nach oben an die Decke. Sie schmiegt sich nicht zu mir. Wahrscheinlich denkt sie jetzt, dass ich ein Arschloch bin und wahrscheinlich hat sie damit auch recht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich verlässt. Ich versuche, sie zum Lachen zu bringen, sie reagiert nicht und dann höre ich mich sagen: „Ich sag dir, warum Alex nicht in der Schule war. Aber du musst versprechen, dass du es niemandem erzählst.“
Sie dreht sich zu mir.
„Er darf wirklich nicht wissen, dass ich dir das gesagt hab.“
„Ich sag nichts.“
Sie schaut mich mit ihren großen blauen Augen an, mit denen sie Alex immer verächtlich angesehen hat, wenn ihr sein großes Gerede auf die Nerven ging, und wahrscheinlich wird sie ihn jetzt nie wieder so ansehen, weil sie dann immer daran denken wird, was Alex doch eigentlich für ein armseliger Typ ist.
„Wir haben uns letzten Mittwoch aus dem Haus geschlichen. Wir sind in so eine Bar und haben literweise Whiskey Cola getrunken. Da war so ein Typ, der hat uns auf alles eingeladen.“
Ich habe Angst, dass sie meine immer dünner gewordene Stimme richtig deuten kann und erkennt, wo die Geschichte einen Fehler hat. Aber einmal angefangen, gibt es kein Zurück.
„Die Bar hat um zwei Uhr zugemacht. Der Typ hat gemeint, wir sollen noch zu ihm kommen, weiter Party machen. Der war sicher schon vierzig oder so. Ich bin sofort nach Hause, Alex ist mitgegangen. Sie haben noch Wein getrunken und plötzlich haben sich seine Beine taub angefühlt. Er wollte gehen, konnte sich aber nicht mehr richtig bewegen. Der Typ hat ihn aufs Bett geworfen ... Den Rest kannst du dir denken.“
„Dann hat er Alex...“
„Ja.“
Meine Beine zittern. Sie schweigt.
„Hat er ihn angezeigt?“, fragt sie dann.
„Nein. Er kann nicht.“
„Wie, er kann nicht?“
„Na, weil er sich schämt.“
„Scham hin oder her, der Typ gehört angezeigt, sonst lauft der weiter rum und macht das vielleicht wieder.“
„Das ist nicht so einfach.“
Schweigen.
„Er kann froh sein, dass er dich hat. Der braucht jetzt ganz dringend wen, mit dem er darüber reden kann. So was darf man nicht verdrängen, sonst holt einen das irgendwann ein.“
Ich gebe ihr recht. Sie schmiegt sich zu mir. Ich werde ihr nie erzählen, dass ich nicht direkt nach dem FIASKO nach Hause gegangen bin. Ich schaffte es erst später so wie Alex auch.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Carolina Reichl
Herr Pechmann
Ich beginne und beende meine Stunden auf die Minute genau. Nur mit Herrn Pechmann überziehe ich immer. Er hat einen schönen Mund und eine angenehme, tiefe Stimme, der man gerne zuhört.
„Ich glaube, ich bringe Unglück“, sagt er. „Wenn ich jemanden mag, dann wird die Person schwer krank oder hat einen Unfall und stirbt. Das war bei meinen Eltern so, bei meiner letzten Freundin und bei drei Arbeitskollegen, mit denen ich mich gut verstanden habe. Ich will nicht, dass das wieder passiert. Darum habe ich mich von allen abgekapselt. Manchmal vergehen Monate, ohne dass ich mit jemandem spreche.“ Herr Pechmann beginnt zu weinen. Er ist ungefähr in meinem Alter und ein wenig abgemagert, wodurch seine markanten Wangenknochen schön zur Geltung kommen.
„Ich hätte gerne Freunde. Zumindest einen – aber was, wenn dann wieder etwas Schlimmes passiert?“
Frau Hammer ist meine nächste Patientin. Sie ist Anfang zwanzig und geht in Wahrheit nur in Therapie, weil das gerade alle ihre Freundinnen machen. Sie hat eine nazistische Persönlichkeit, aber keine richtigen Probleme. Sie erzählt mir von Männern, die sie wollen, aber die sie nicht will. Dass sie Wirtschaft nur studiert, weil ihre Eltern das wollen. Dass sie am liebsten nach Bali auswandern und Yogalehrerin werden würde.
Ich lasse sie reden. In Gedanken bin ich bei Herrn Pechmann. Er ist seit sechs Wochen mein Patient. Schritt für Schritt zeigt er mir mehr von seinen Narben und was sich darunter verbirgt.
Würde ich daran glauben, dass es Seelenverwandte gibt, dann wäre Herr Pechmann meiner. Ich verstehe ihn. Auch ich lasse seit Jahren niemanden an mich heran, um nicht enttäuscht zu werden.
„Er macht die Tür nicht zu, wenn er aufs Klo geht. Ich glaube, ich werde mich nicht mehr bei ihm melden“, sagt Frau Hammer. Ich nicke.
Herr Pechmann sagte vorhin, dass Mittwoch der schönste Tag der Woche für ihn ist, weil er da zu mir kommen kann. Er spürt die besondere Verbindung, die zwischen uns ist.
„Es gibt da eine Frau, mit der ich gerne ausgehen würde“, sagt er bei der nächsten Sitzung. „Aber ich trau mich nicht, sie zu fragen.“
Mir wird heiß, ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen.
„Warum nicht?“
„Vielleicht sagt sie nein.“
„Vielleicht sagt sie auch ja.“
„Ich will nicht zurückgewiesen werden.“
„Ich glaube nicht, dass sie das tun würde.“
„Dann ist es offensichtlich, wen ich meine?“
Ich nicke.
„Und Sie glauben, dass ich bei Mia eine Chance habe?“
Ich sehe ihn irritiert an.
„Ich meine die Patientin nach mir.“
„Frau Hammer?“, frage ich und erschrecke mich selbst über meine schrille Stimme. Er nickt.
„Wir unterhalten uns hin und wieder im Wartezimmer.“
Ich kenne Frau Hammer gut genug, um zu wissen, dass sie sich nicht für ihn interessieren wird. Sie ist viel zu wählerisch.
„Versuchen Sie’s doch einfach.“ Ein gebrochenes Herz ist immer ein guter Gesprächsstoff.
Wir sprechen alles im Detail durch. Zwischen uns gibt es keinen Filter, durch den seine Worte gezogen werden. Er sagt mir gerade aus dem Bauch heraus, was er denkt. Ich bin die Einzige, mit der er so spricht, die Einzige, die sehen kann, wie kaputt er wirklich ist. Mia weiß nichts von seiner Einsamkeit und seinen Verlustängsten. Wüsste sie davon, hätte sie sich nicht mit ihm getroffen.
„Zum Schluss hab ich sie geküsst“, sagt er und blickt daraufhin zu Boden. „Zu mehr war ich nicht bereit.“
Ich atme erleichtert auf, sage, er soll sich nicht unter Druck setzen.
Ich bin mir sicher, dass sie bald das Interesse verlieren wird, so wie sonst auch. Dennoch gebe ich ihm eine Reihe von schlechten Ratschlägen.
„Ich glaube, ich mag ihn“, sagt Mia zwei Wochen später.
„Und es gibt nichts, was Sie an ihm stört?“, frage ich.
Sie schüttelt den Kopf.
„Auch nicht der Altersunterschied?“
„Nein.“
„Und seine introvertierte Art?“
„Nein.“
„Gut“, sage ich. Dann frage ich, wie es auf der Uni läuft. Geht so, sagt sie. Sie hat Stress, weil sie eine wichtige Prüfung nicht bestanden hat.
Ich verschreibe ihr Medikamente mit starken Nebenwirkungen. Dazu gehören Gewichtszunahme und Depression. Niemand mag jemanden, der dick und schlecht gelaunt ist.
Herr Pechmann sagt mir, wie toll ich bin. Ohne mich hätte er sich nie mit Mia getroffen.
Er sagt: „Ich war schon lange nicht mehr so glücklich.“
Und dann: „Ich möchte die Therapie beenden.“
Ich denke: Jetzt dreht er durch.
Ich schnappe nach Luft, strenge mich an, die Fassung zu bewahren. Er ist krank, er weiß nicht, was er sagt.
„Ich kann die Therapie doch beenden, oder?“
Ich merke, wie ich schneller atme. Das ist die Panik, die in mir hochkriecht. Ich blinzle, hoffe, dass er die Tränen in meinen Augen nicht bemerkt.
„Selbstverständlich, Sie sind freiwillig hier.“
Unfassbar, wie schnell man den Verstand verliert, wenn es einem gut geht.
Frau Hammer hat ein wenig zugenommen. Trotzdem ist sie eine junge, hübsche Frau. Sie begreift gar nicht, wie gut es ihr geht. Denn obwohl sie jetzt einfach mit Herrn Pechmann glücklich sein könnte, sagt sie: „Ich fühle mich in letzter Zeit nicht gut.“
Da sage ich: „Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Sie sind seit drei Jahren bei mir und wir machen keine Fortschritte. Es ist besser, Sie suchen sich eine neue Therapeutin.“
Damit hat sie nicht gerechnet.
„Vielleicht brauche ich mehr Medikamente?“
Ich sage, ihre Medikamente wären schon stark genug.
Sie will fragt, was sie hat, Depression, Borderline oder vielleicht noch etwas Schlimmeres.
„Ich weiß es nicht“, sage ich und schicke sie vor die Tür.
Ich wollte nicht, dass es soweit kommt. Aber ganz unfroh bin ich nicht.
Herr Pechmann schluchzt. Ich verstehe nicht alles, was er sagt. Ich höre nur Krankenhaus und zu viele Tabletten. Sie ist nicht gestorben, aber fast.
Ich setze mich neben ihn und lege meine Hand auf seine.
„Haben Sie Mia schon besucht?“
Er schüttelt den Kopf.
„Das ist meine Schuld. Ich halte mich lieber von ihr fern, damit ihr nicht noch was passiert.“
Ich stimme ihm zu. Dann vereinbaren wir die nächste Sitzung.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
22 | Carolina Reichl
Die Geburt Schatzibinkis
Rückblickend bezeichnet meine Mutter die Geschehnisse als ein Wunder.
Den ganzen Advent war sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Mein Vater hatte ihr Ende November angekündigt, dass er dieses Jahr mit seiner neuen Freundin Weihnachten feiern würde. Er glaubte, dass auch sie eine Affäre hätte.
Meine Mutter zog allein in die erstbeste Wohnung, die sie fand.
Am 24. Dezember half ich ihr beim Übersiedeln. Wir bestellten Pizza bei einem Türken auf Mjam. Zum Kochen fühlte sie sich nicht im Stande. Sie heulte nach der dritten Flasche Weißwein. Sie verstand nicht, wie es soweit kommen konnte. 26 Jahre hatte sie ihre Bedürfnisse denen meines Vaters untergeordnet.
Wir öffneten einen Zweigelt. Betrunken schliefen wir vor dem Fernseher ein.
.
Am nächsten Morgen saß meine Mutter neben mir und strahlte über das ganze Gesicht. Vor uns auf dem Boden ein Katzenjunges mit zerzaustem Fell, das sich über einen Teller Schinkenwürfel beugte.
„Das ist Moritz“, sagte sie. Mich hätte sie auch Moritz genannt, wenn ich ein Junge geworden wäre. „Ich war um 5:00 schon wach und hab den Müll rausgetragen. Da hab ich ein Miauen gehört. Jemand hat den Kleinen einfach in der Mülltonne ausgesetzt, kannst du dir das vorstellen? Wie lang er da wohl schon gewesen ist. Ein Wunder, dass er noch lebt.“ So hatte sie ihn empfangen, unbefleckt, aber verdreckt.
.
Bereits nach wenigen Tagen wurde aus Moritz Morli beziehungsweise Schatzibinki. Morli benutzte sie, um über ihn zu sprechen; Schatzibinki in der direkten Anrede. Seither hat für meine Mutter eine neue Zeitrechnung begonnen. Wenn sie von einem Ereignis berichtet, das vor der Trennung geschehen ist, dann sagt sie nicht: Vor der Trennung, sondern: Vor Morli.
Anfangs fand ich es gut, dass sie Morli behalten hatte. Er lenkte sie von meinem Vater ab und bewahrte sie davor, alleine zu sein. Doch dann begann sie, um 4:00 Uhr morgens aufzustehen, weil er Frühstück wollte. Sie hörte auf, auf Urlaub zu fahren, weil sich irgendjemand um Morli kümmern musste und ihrer Meinung nach konnte das nur sie; vor anderen hatte Morli Angst. Sie verzichtete sogar auf ihre Maniküre, auf die seit Jahrzehnten schwor, nur um ihm das teuerste Futter und Leckerlis in allen Formen zu kaufen. Mit Sticks, Pudding und Bites ringt sie um seine Aufmerksamkeit. Manchmal kauft sie ihm auch Neuburger. Den liebt er. Sie selbst mag Leberkäse nicht.
Ich sage oft: „Du verwöhnst ihn zu sehr.“
Sie meint, ich müsse das verstehen. Wenn er fraß, wäre er glücklich. Recht viel mehr gäbe es in seinem 40m2 Universum nicht.
Selbst als sich herausstellte, dass sie eine Katzenhaarallergie hatte, beschloss sie, ihn nicht herzugeben, sondern lieber Tabletten zu nehmen. Es wäre ja nur ein leichtes Kratzen im Hals und ein bisschen Husten, sagte sie.
„Es ist nicht immer einfach, aber das Gute ist, ich kann mich auf ihn verlassen. Er wird immer bei mir bleiben.“ Dann fügte sie hinzu, es sei vorherbestimmt gewesen, dass sie einander gefunden hatten.
„Wer sollte das bestimmen?“, fragte ich. Darauf antwortete sie nicht. Sie meinte nur, es könne kein Zufall sein, dass sie ihn ausgerechnet an Weihnachten gefunden hatte.
.
Am 24.12.2019 sprach sie zum ersten Mal von Morli dem Retter. Er hätte sie vor der Verzweiflung bewahrt und von ihrer Trauer erlöst. Sie hob ihr Glas und trank auf ihn.
Aber Morli ist kein Erlöser. Er ist verfressen.
.
Wenn ich meine Mutter besuche, überlege ich, die Wohnungstür offen zu lassen, damit das geliebte Schatzibinki in die Freiheit läuft und sie ihre zurückbekommt.
Vielleicht hätte ich die Einschränkungen verstanden, die meine Mutter für Morli hinnahm, wenn Morli ein Hund gewesen wäre. Hunde erwidern Zuneigung bedingungslos. Morlis Liebe ist an den Futternapf geknüpft.
Bevor er sein Fressen bekommt, ist er am zutraulichsten. Sobald er hört, wie das Schälchen geöffnet wird, schwattelt er in die Küche. Ich staune jedes Mal, wie dick er geworden ist. Sein Bauch schaukelt so heftig von links nach rechts, dass er alle Muskeln anspannen muss, damit es ihn nicht aus der Bahn wirft.
Dann schmiegt er sich um die Beine meiner Mutter, zuerst mit dem Kopf, dann mit dem ganzen Körper. Streicheln, hochheben, abbusseln, das lässt er alles zu, schnurrt dabei sogar und manchmal schleckt er ihr auch über die Wange.
Sobald er aufgegessen hat, ist sein liebes Getue vorbei. Versucht meine Mutter ihn zu berühren, streckt er die Krallen aus und beißt ihr mit voller Wucht in die Hand. Seine Reaktionen sind unergründlich.
Meine Mutter schreit nicht, auch nicht wenn der Kratzer tief ist und blutet. Sie ist ihm niemals böse. Sie sagt dann, sie wäre selbst schuld, sie hätte ihn nicht anfassen dürfen. Nach dem Essen mag er das nicht.
Auf ihrer Hand sind so viele Narben, dass ich sie gar nicht mehr zählen kann.
.
Ich frage mich, ob Katzen ein Bewusstsein dafür haben, wenn sie über einen Menschen Macht verfügen. Und wenn ja, ob es ihnen Spaß macht.
.
Eines Tages öffne ich die Tür und stelle eine frischgeöffnete Packung Neuburger ins Treppenhaus.
„Komm“, flüstere ich. Morli sitzt am Gang und beobachtet mich, wie ich ihm seinen Weg nach draußen deute.
Ich lehne mich gegen die Wand, sodass er problemlos an mir vorbeilaufen kann. Meine Mutter kriegt von alldem nichts mit. Wir haben uns bereits verabschiedet, sie steht in der Küche und räumt auf.
„Es war ein Versehen“, würde ich ihr sagen. „Er war so schnell, ich unkonzentriert. Es tut mir leid.“ Sie würde weinen, mich beschimpfen, aber irgendwann würde sie mir verzeihen.
Ich bin verwundert, dass Morli sich nicht gleich in Bewegung setzt.
„Komm schon, ich weiß, wie sehr du den liebst“, sage ich noch einmal und hebe eine Scheibe hoch, tanze damit vor seinem Gesicht. Er wird gleich zubeißen, denke ich.
Gelassen sieht er mich an, schließt die Augen und öffnet sie wieder.
Einige Minuten stehen wir so da. Dann wird es mir zu blöd.
Ich trete über die Schwelle, packe den Leberkäse wieder ein und nicke ihm zu. Dann schließe ich die Tür.
Er bleibt bei meiner Mutter, so wie sie es prophezeit hat.
.
Carolina Reichl
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Carolina Reichl
Unausgesprochenes
Ich hasste es, Peter zu mögen. Ich war nicht gut mit diesem Gefühlszeug, mir fehlte die Übung. Denn obwohl ich bereits Mitte zwanzig war, war ich erst zweimal verliebt gewesen. Das erste Mal in Hugh Grant, als ich Schokolade zum Frühstück gesehen hatte, da war ich vielleicht zehn gewesen. Ich konnte nicht verstehen, warum Bridget Jones nicht mit ihm zusammen sein wollte, freute mich aber auch darüber, denn das musste ja bedeuten, dass er noch zu haben war. Also schrieb ich ihm Liebesbriefe, auf die er natürlich nie antwortete. Irgendwann begriff ich, dass er als Schauspieler bzw. Filmcharakter unerreichbar für mich war. Ich musste wohl jemanden im wahren Leben kennenlernen, der meine Gefühle erwidern konnte. Doch das war genauso schwierig. Beim zweiten Mal verliebte ich mich nämlich in einen älteren Mitschüler. Wir schrieben uns und trafen uns nach der Schule. Er erklärte mir, dass er mich mochte, aber niemand von uns wissen durfte, weil sonst alle blöd reden würden, da er schon 18 war und ich erst 14. Ich glaubte ihm, doch rückblickend weiß ich, dass er nur mit mir schlafen wollte.
Seitdem hatte ich nur One-Night-Stands gehabt. Betrunken und bedeutungslos. Das war nicht meine Definition von Glück, doch es war in Ordnung. Ich hätte ewig so weitermachen können, bis ich Peter vor vier Monaten bei einer Party kennenlernte. Es lief ganz gut zwischen uns, aber ich wünschte mir trotzdem, ich würde ihn weniger mögen, denn ihn mögen, ließ mich blöde Dinge tun. Wie zum Beispiel ihn zu mir nachhause einzuladen.
Wir waren gerade noch in einem Club gewesen und hatten gegen vier Uhr beschlossen, uns auf den Heimweg zu machen. Normalerweise fuhren wir dann zu ihm, doch dieses Mal schlug ich vor, zu mir zu fahren und ehe ich meinen Vorschlag zurückziehen konnte, saßen wir auch schon im Taxi.
Wir gingen die Stufen hinauf in den zweiten Stock. Seine Schritte kamen mir so laut vor, dass ich ihn am liebsten gebeten hätte, auf Zehenspitzen zu gehen, doch das hätte er bestimmt eigenartig gefunden. Dann standen wir vor meiner Tür. Ich versuchte, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen, doch meine Hände zitterte so sehr, dass ich das Schlüsselloch mehrmals verfehlte.
Es war das erste Mal, dass ich jemanden mitnahm. Ich fand immer eine gute Ausrede, warum es bei mir nicht ging: Kaputte Heizung, seit Wochen nicht geputzt, Durchfall – mir war nichts zu blöd, Hauptsache sie kamen nicht. Jemanden in meine Wohnung zu lassen war für mich nämlich eines der intimsten Dinge, die man machen konnte. Wie die Wohnung eingerichtet war, verriet einfach alles über mich.
Ein gutes Beispiel war die Küche. Meine Mutter hatte sie für mich ausgesucht, nachdem sie die Wohnung für mich gekauft hatte. „Du brauchst etwas Ordentliches“, hatte sie gesagt. Die Küche war groß und viel zu teuer dafür, dass ich nicht kochen konnte. Aber meine Mutter hatte darauf bestanden. Nun hatte ich einen sündhaft teuren Kühlschrank, der bis auf Butter und ein paar Weinflaschen vollkommen leer war.
Endlich hatte ich die Haustüre aufgesperrt. „Komm rein“, sagte ich, was überflüssig war, da Peter bereits mit einem Fuß in meinem Vorzimmer stand. Ich beobachtete ihn ganz genau, weil ich so Angst hatte, dass er eine der vollgestopften Lade aufmachen könnte. Hannah hatte das einmal gemacht und war ganz verwundert gewesen, wie unordentlich ich war. Prinzipiell fand ich Ordnung gut, ich schaffte es nur nie, sie zu halten. Darum stopfte ich alles brutal in die Laden, was blöd herumlag.
„Wow, du liest ja ziemlich viel“, sagte Peter und blieb vor dem Bücherregal stehen. Am liebsten hätte ich ihn am Arm gepackt und weggezogen. Zwischen den Thrillern und Romanen standen Lebensratgeber wie „The Secret – Die Kraft guter Gedanken“, „The Power of Imperfection“ und „Verletzlichkeit macht stark“. Ich schämte mich alleine schon für die kitschigen Titel und betete, dass sie ihm nicht auffielen.
„Da geht’s ins Schlafzimmer“, sagte ich und führte ihn in das zweite Zimmer. Hier waren alle Möbel aus weißem Holz. Ich mochte das, es sah friedlich aus.
Da fiel mein Blick auf Tschatscha. Ich griff nach ihm, um ihn unter einem Polster zu verstecken. Doch ich war zu langsam.
„Der sieht ja mitgenommen aus.“
„Ja, das ist Tschatscha. Meine Mutter musste ihn bestimmt hundert Mal nähen, weil ich als Kind ständig auf ihn rumgekaut hab.“ Tschatscha war mein erstes Kuscheltier gewesen. Er lag in meinem Bett, weil er mich an die Zeit erinnerte, in der meine Eltern noch ineinander verliebt gewesen waren. Sie waren nun seit sechs Jahren geschieden.
„Tschatscha?“
„Das war das Einzige, was ich damals sagen konnte.“
Er lächelte mir zu, dann küssten wir uns und wir schliefen miteinander – zumindest so gut es in unserem betrunkenen Zustand ging. Mir war ein bisschen schlecht und ich war nicht richtig feucht, aber dafür konnte er nichts, das war immer so, wenn ich zu viel Alkohol getrunken hatte.
Danach nahm er mich in den Arm und wir schauten an die Decke. Es war nun ganz ruhig. Ich fühlte mich geborgen und hätte auf der Stelle einschlafen können.
„Hattest du eigentlich was mit jemand anderem, seitdem wir uns treffen?“
„Nein“, antwortete ich sofort und verschwieg das eine Mal, als ich mit dem erstbesten Typen geschlafen hatte, der mich im Club angequatscht hatte. Das war kurz nach unserem ersten Date passiert, weil ich mir beweisen wollte, dass ich Peter gar nicht so sehr mochte. Reine Stressreaktion, es war nicht toll gewesen und ich war auch nicht stolz darauf.
Er atmete erleichtert aus.
„Du?“, fragte ich ihn.
„Nein.“ Ich glaubte ihm. Peter hatte mir von Anfang an gesagt, dass er noch nie einen One-Night-Stand gehabt hatte und dass ihn das auch nicht interessierte. Er war eher der Beziehungstyp.
„Hätte dich das gestört?“, fragte ich. Er atmete tief und schwer aus, was mir gut gefiel. Das wirkte irgendwie so, als würde es ihm schwer fallen, sich das einzugestehen, weil ihm wirklich etwas an mir lag.
„Naja, schon. Aber wir haben ja nie darüber geredet, ob es in Ordnung wäre, jemand anderen zu treffen oder nicht.“
„Stimmt. Von mir aus können wir das gerne lassen, ich muss nichts mit jemand anderem haben“, sagte ich und bereute es sofort, weil Peter mich jetzt für eine Klette halten könnte. Doch er lächelte mich an und sagte: „Von mir aus gerne.“ Ich atmete erleichtert aus und lächelte zurück.
„Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass wir ein Paar sind – ich hoffe, das ist für dich in Ordnung?“
„Klar“, sagte ich sofort, obwohl ich am liebsten nein gesagt hätte.
„Es tut mir leid, dass ich damit so herausplatze –aber ich hatte so etwas noch nie und ich will dich nicht enttäuschen. Du weißt ja, dass ich normalerweise von einer Beziehung in die nächste schlittere.“
Ich versuchte weiterhin zu lächeln, aber ehrlich gesagt hätte ich in diesem Moment lieber mein Bewusstsein verloren, als diesen Stich in meinem Herzen zu spüren. Ich hätte ihn gerne gefragt, was genau ich falsch gemacht hatte, dass er nicht ausreichend Gefühle für mich entwickelt hatte und was die anderen Frauen vor mir, mit denen er ja zusammen gewesen war, richtig gemacht hatten. Doch wer weiß, ob ich die Antwort ertragen hätte.
„Mit dir ist alles so schön unkompliziert und ungezwungen, das finde ich gut. Ich mag dich – aber mehr als das kann ich dir gerade nicht geben. Vielleicht ändert sich das irgendwann, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht und ich will dir nichts versprechen, was ich nicht halten kann. So jetzt fühl ich mich wie ein Arsch.“ Mein erster Gedanke war, dass er sich nicht schlecht fühlen sollte. Er konnte gar nichts dafür, dass er keine Gefühle hatte und ich schon. Darum sagte ich: „Musst du nicht. Ich versteh das, du hast dich ja gerade erst von deiner Freundin getrennt. Ist doch klar, dass du da nichts Ernstes willst und ich will auch nicht mit dir zusammen sein.“
Er gab mir einen Kuss auf den Mund. Am liebsten hätte ich losgeheult.
„Dann ist das für dich in Ordnung, wenn das zwischen uns so unverbindlich bleibt?“
„Klar.“
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at