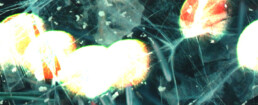3 | Angela Ahlborn
Spurensuche
Jost atmet tief durch. Jetzt nur nichts sagen, es hat keinen Sinn, es würde die Situation nur verschlimmern. Er meidet den Blick seiner Mutter; zu oft hat er sie in dieser resignierten Abwehrhaltung gesehen, tapfer ausharrend, mit Tränen in den Augen. Die Stimme seines Vaters schwillt an, jedes ausgespieene Wort ist ein Treffer. Wo lauert die unbändige Wut, die unberechenbar wie aus dem Nichts immer wieder aufflackert? Hatte sie stets in seinem Vater gebrodelt, nur gedeckelt und gut versteckt? Die Wesensveränderung sei der Krankheit geschuldet, beteuern die Ärzte. Jost will das glauben, bei jedem einzelnen Zornesausbruch seines Vaters gibt er sich größte Mühe.
Ihn quält wie so häufig die Frage, ob man hätte achtsamer sein müssen. Als sein Vater begann zu verschwinden, hatte es kaum jemand bemerkt, im Rückblick erscheinen ihm die Vorboten schmerzhaft deutlich. Vor Jahren schon verstand sein Vater bei einem Weihnachtsfestessen den bei solchen Gelegenheiten ständig erzählten Familienwitz nicht mehr. Mit merkwürdig großen Augen erklärte er Josts Schwester, ihn noch nie gehört zu haben. Er sorgte mit dieser Aussage für ein kurzes erschrecktes Innehalten der fröhlichen Gesellschaft. Josts Mutter lachte die Beklommenheit weg. Einige Wochen später fand Jost beschmutzte Unterwäsche seines Vaters, versteckt an den unmöglichsten Stellen. Seine Mutter schmunzelte auch darüber und riet ihm, sich nicht zu sorgen, der Vater sei nun auch nicht mehr der Jüngste, da passiere so etwas und es sei ihm sicherlich peinlich.
Mit den Jahren ließ das Lachen in Josts Elternhaus nach. Sämtliche Versuche, die Mutter auf den Zustand des Vaters anzusprechen, wurden von ihr boykottiert. Die zunehmende Vergesslichkeit ihres Mannes sowie seine sich plötzlich entwickelnden Eifersuchtsanfälle entschuldigte sie mit seinem Alter. Josts Vorstoß, einen Neurologen zu konsultieren, wurde mit groben Unflätigkeiten kommentiert; nie zuvor hatte er seinen Vater solche Worte sagen hören. Wie ein Tuch legte sich die Sorge vor drohendem Unheil auf die Familie, Frohsinn und Unbekümmertheit wurden herausgefiltert.
Demenz. Der Zustand des Vaters hatte jetzt einen Namen. Kompromisslos und nicht diskutierbar. Erstmalig ausgesprochen und als weitere Diagnose in den Entlassungspapieren schriftlich festgehalten. Sein Vater hatte mehrere Tage wegen einer Niereninsuffizienz im Krankenhaus verbracht. Der Damm war gebrochen, Josts Mutter konnte sich alles von der Seele reden, sie war befreit vom Druck, die Situation zu verharmlosen. Gleichzeitig zwang sie der Befund, sich von der Illusion einer normalen Alterserscheinung zu verabschieden. Jost konnte das Ausmaß ihrer Einsamkeit nur erahnen. Der Vater war von allem unberührt. Niemand traute sich, das Thema anzusprechen, zu groß war die Furcht vor einem erneuten Wutausbruch, den letztlich seine Mutter mehrere Tage auszubaden hätte.
Die Krankheit war launisch; es gab hellere Tage, in denen man sich der Hoffnung hingeben konnte, der Verlauf wäre eventuell zu stoppen oder würde sich gar bessern. Als die Diagnose endlich feststand, kam fast so etwas wie Euphorie bei Jost auf. Er hoffte, nun könne man handeln, Ärzte um Medikamente und Therapien bitten, Ratschläge von Betroffenen einholen, einen Pflegedienst hinzuziehen. Die Erkenntnis über die Unheilbarkeit einer Demenz traf ihn schwer. Auch der Rat, das Wohlbefinden des Betroffenen zu fördern, stellte keine Entlastung dar; sein Vater wehrte sich gegen jede noch so kleine Hilfeleistung, da er keine Krankheitseinsicht empfand.
Jost vermisste seinen Vater schmerzlich. Die ausführlichen Gespräche zwischen ihnen gehörten der Vergangenheit an, jedwede Logik erreichte den Vater nicht mehr. Von dem ehemals klugen und belesenen Feingeist schien nur noch die optische Hülle existent zu sein. Immer wieder suchte Jost seinen Vater in dem so vertrauten, doch meist ausdruckslosen Gesicht. Tatsächlich fand er ihn manchmal ganz weit in der Vergangenheit; dort waren sie beide sicher, es war fast wie früher, die Rollen klar definiert, Vater und Sohn. Viele Ereignisse aus der Kindheit und Jugend waren noch abrufbar und belebten die sonst so leere Miene des alten Mannes. Jost hatte noch nie zuvor den Wunsch verspürt, etwas schriftlich festzuhalten, aber jetzt gab er dem Bedürfnis nach, jedes Detail ihrer Beziehung aufzuschreiben, bevor sein Vater sich gänzlich in sich zurückziehen würde.
Ihm war die Sinnlosigkeit der Frage bewusst, ob die Veränderung des Vaters ausschließlich auf die Demenz zurückzuführen war oder die damit verbundene fehlende Impulskontrolle seinen wahren Charakter zum Vorschein brachte. Jost hatte sich schon immer an der Dominanz und Selbstgerechtigkeit seines Vaters gerieben, jedoch gingen diese Eigenarten vor der Krankheit nie über ein erträgliches Maß hinaus. Etwas in ihm flehte danach, den Vater aus der Verantwortung zu ziehen, wenn dieser wieder einmal seine Mutter mit wüsten Beschimpfungen und haltlosen Eifersuchtstiraden quälte. In diesen immer häufiger vorkommenden Situationen besaß Jost nicht den Abstand, die verbalen Gewaltexzesse seines Vaters mit dem dementiellen Syndrom zu entschuldigen, sondern sah einen bösartigen Menschen, der eine nicht auszuhaltende Belastung für seine Mutter darstellte. Im Anschluss empfand er Scham und versuchte, sein Verhältnis zum Vater neu zu definieren, was ihm jedoch nicht wirklich gelang. Hatte er früher seine Bindung zu ihm ohne Zögern mit Liebe und Zuneigung assoziiert, war da jetzt ein verwirrendes Vakuum, das er gerne mit mehr als pflichtbewusster Sorge befüllt hätte. Und er fürchtete sich vor der Erinnerung an seinen Vater: Würde er ihn später nur noch als den Menschen sehen, der er in seinen letzten Jahren gewesen war?
Jost schreckt auf, ein klirrendes Geräusch unterbricht die zornigen Beschimpfungen. Sein Vater hat eine Tasse nach seiner Mutter geworfen. Er unterstellt ihr einen zu freundlichen Umgang mit dem Pflegehelfer. Die Mutter weint leise, der Vater erhebt sich, Jost steht bereit, sich schützend vor die Mutter zu stellen, doch sein Vater geht stumm in den Garten. Hilflos nimmt Jost seine Mutter in den Arm, versucht zu trösten. Noch als er die Scherben auffegt, ist er von Wut erfüllt.
„Kannst du nach ihm schauen, Jost?“, bittet seine Mutter. „Ist wohl besser, wenn du das tust.“
Mit dem Gefühl, der Situation nicht mehr gewachsen zu sein, geht Jost auf den Rücken seines Vaters zu. In Erwartung einer wie immer sinnlosen Auseinandersetzung setzt er sich neben ihn auf die Gartenbank. Ohne ihn anzuschauen greift der alte Mann nach seiner Hand.
„Ich weiß nicht, was los ist, Junge, irgendwas stimmt nicht in meinem Kopf“, weint er leise. Fest umschließt Jost die Hand seines Vaters.
.
Angela Ahlborn
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
freiTEXT | Angela Ahlborn
Es war gut
„Mama, was ist das für ein Wort?“
„Oh, Jule, nicht schon wieder! Wir müssen gleich los!“
„Mama, sag‘ mir, wie das Wort heißt!“
„Jule, hör‘ auf damit! Ich hab‘ keine Zeit!“
Ich schloss das Album und legte es in eine der Kisten mit der Aufschrift „behalten“. An solche und ähnliche Dialoge hatte ich mich erinnert, als ich die Fotos aus meiner Vorschulzeit sah. Ich wollte so gerne lesen lernen, doch meine Mutter fand mich anstrengend und dieser Wunsch für ein Kind meines Alters war in ihren Augen nicht normal. Ich sollte lieber mit der Puppe spielen, in die man oben Wasser goss, das unten als Pipi wieder heraus kam oder als Tränen über die runden Wangen kullerten. Die war sehr teuer gewesen und ich war das einzige Kind in unserer Umgebung, die solch ein Spielzeug besaß. Meine Mutter hatte an der Puppe bestimmt mehr Freude als ich, schon um den Anderen zu zeigen, was sie als alleinstehende Frau ihrer Tochter bieten konnte.
„Die Anderen“ waren wichtig, das begriff ich ziemlich schnell. Sie waren die Instanz, vor der ich mit meinen Taten bzw. Nichttaten zu bestehen hatte. Meine Mutter war sehr auf Außenwirkung bedacht; schrieb ich in der Schule eine Fünf, durfte das keiner erfahren, bei einer Eins hingegen ging sie damit regelrecht hausieren, was sie in den ersten sechs Schuljahren auch ausgiebig tat; die Jahre danach muss sie oft sehr erschöpft gewesen sein von all den aberwitzigen Geschichten, die sie über mich verbreitete, um die für sie enttäuschende Realität zu vertuschen.
Schönheit war für meine Mutter das Wichtigste. Als ich schon jenseits der Vierzig war, schien es für sie das Größte, wenn jemand sie fragte, „ist deine Tochter immer noch so hübsch?“ Davon konnte sie eine sehr lange Zeit zehren und – was noch viel wichtiger war – es allen Freunden und Bekannten erzählen, ob sie es hören wollten oder nicht. Dabei störte es sie nicht im geringsten, wenn ich dabei war, im Gegenteil, im günstigsten Fall nickte sie mir aufmunternd zu, im schlechtesten tätschelte sie mir die Wange, während ich mich am liebsten aufgelöst hätte. Wenn wir unter Menschen waren, raunte sie mir manchmal zu, „guck mal, Jule, dieses arme Menschenkind da hinten mit DER Nase im Gesicht“, (wo sonst, Mama?) oder „XY ist ja hässlich wie die Nacht, aber trotzdem nett!“ Übrigens glaubte sie nur zu raunen, die Leute neben uns hörten jedes Wort.
Intelligent sollte ich natürlich auch sein, aber nicht zu sehr. Frauen durften nicht schlauer sein als ihre Männer, solche Ehen waren sehr gefährdet. Ich wollte sie immer mal fragen, ob es diesen Idealstatus zwischen ihr und meinem Vater auch gegeben hätte, aber ich traute mich nicht. Sie konnte nur begrenzt über sich selbst lachen und war zudem auch recht launenhaft; ich wusste nie genau ihre Stimmungslagen einzuschätzen. Außerdem waren in ihren Augen alle zu intelligenten Frauen graue Mäuse, die plump gekleidet und vereinsamt immerzu mit einem Buch in der Hand anzutreffen waren, der Haushalt um sie herum in einem miserablen Zustand. Somit bissen meine Lehrer in der Unterstufe bei ihr auf Granit mit ihrem Rat, mich eine Klasse überspringen zu lassen.
Und einen guten Beruf sollte ich mal haben, allerdings einen, bei dem man auch Haushalt und Garten im Topzustand halten sowie genügend Zeit für den Gatten und die Kinder aufbringen konnte. Somit war eine berufliche Karriere ausgeschlossen; die Frauen in Führungspositionen würden am Ende ihres Lebens ganz alleine da stehen.
Ich hatte somit klar gesteckte Ziele vor Augen mit diesen drei umrissenen Aufgaben. Natürlich gab es meinerseits immer mal wieder kleine aufmüpfige Revolten wie z.B. meine Punkerzeit, doch letztendlich hielten diese Phasen selten lange an, da ich sie nicht aus Überzeugung lebte, sondern nur Ausdruck meines Widerstands waren.
In meiner Studentenzeit meinte ich, alle drei Punkte erledigt zu haben: Ich hatte durch Zufall das Glück, als Model für einen berühmten Modedesigner zu laufen, sah viel von der Welt und verdiente viel Geld. Ich dachte, meine Mutter würde vor Stolz schier überschnappen, doch weit gefehlt! Ihr war der Job zu unstet und sie betete zu Gott, ich möge mich auf keinen Fall in einen Mann aus der Modewelt verlieben; die waren alle chi-chi und keine richtigen Männer. Was sie aber trotzdem nicht davon abhielt, der Welt von ihrer Tochter, dem Model zu erzählen. Als ich später einen Rechtsanwalt heiratete, war wieder alles in Ordnung.
Das war ganz nach ihrem Geschmack, denn sie verdiente ihren Lebensunterhalt als Rechtsanwaltsgehilfin und verehrte ihren Chef, für den sie zusätzliche Arbeit mit nach Hause nahm, die sie abends nach den Haushaltspflichten erledigte. Ich habe mich ständig gefragt, woher sie diese unglaubliche Energie nahm, die sie bis in hohe Alter begleitete. Sie muss Ende Siebzig gewesen sein, als ich sie anrief und lange darauf warten musste, ihre Stimme zu hören. Nur so als Floskel fragte ich sie, woher ich sie denn geholt hätte. Die Antwort entsetzte mich: Sie würde die Flurwand streichen und hätte erst vom selbstgebauten Gerüst klettern müssen, das sich über die drei Etagen zog. Auf den Maler hätte sie nicht warten wollen und mich mochte sie auch nicht belästigen; die Wahrheit war, dass ich es ihr sowieso nie gut genug gemacht hätte.
Ich habe nie einen tatkräftigeren Menschen erlebt als meine Mutter. Diese Eigenschaft erwies sich gleichermaßen als störend wie auch nützlich. Bei wie vielen meiner Umzüge hatte sie geschleppt, gestrichen, genäht und geputzt! Sie hatte ein einziges Mal geschwächelt beim Tod meines Vaters, als ich noch klein war. Da hatte sie nach Aussagen meiner Tante mehrere Tage nur auf ihrem Bett gesessen und geweint. Aber die ihr angeborene Tatkraft setzte sich durch, denn eines Morgens schüttelte sie ihre Trauer ab wie ein Hund Wasser aus seinem Fell und stellte sich den veränderten Lebensumständen. Andererseits konnte sie mich mit ihrer Tatkraft gelegentlich überrollen, da ihr das Feingefühl und die Geduld fehlten, die diese Charaktereigenschaft optimiert hätten.
Sie erzählte oft und gern, wie schwer sie es damals als alleinerziehende Mutter gehabt hätte, nicht einen Deut mit heute zu vergleichen! Die jungen Frauen heutzutage hätten ja keinen blassen Schimmer! Wie sie sich hat abrackern müssen für die paar Kröten, von der gesellschaftlichen Akzeptanz mal ganz zu schweigen!
Diese Geschichte brachte sie aus zwei Gründen zu Gehör, einmal natürlich, um Bewunderung zu bekommen, in fröhlichem Ton erzählt, was auch immer zum gewünschten Ziel führte, zum zweiten, um mich demütig und dankbar zu stimmen, wenn ich sie wegen irgendetwas kritisierte, dann allerdings in jammerndem und anklagendem Singsang. Ich wollte ihre Lebensleistung auch keinesfalls kleinreden, aber ich glaubte ihr nicht. Sie hatte es aus dem einfachen Grund nicht so schwer, wie sie es gern schilderte, weil sie solch ein unglaublich kraftvoller Mensch war! Der sein Leben mit links meisterte, ob nun mit oder ohne Mann. Meine Mutter schien mir immer „unkaputtbar“.
Es gab zwei Gemütszustände in ihrem Leben, die mindestens so stark waren wie ihre Tatkraft: Ihre Liebe zu mir und ihre Angst vor Krebs. Letzteres zwang sie regelmäßig in die Knie und sie schaffte es leider nicht, diese unbegründete Furcht vor mir zu verstecken, so dass ich schon als kleines Kind davon überzeugt war, in nicht allzu weiter Ferne Vollwaise zu werden. Das war grausam und als ich alt genug war, um ihre Hypochondrie erkennen zu können, war ich einerseits unfassbar erleichtert, andererseits hasste ich sie dafür.
Ihre Liebe zu mir war wie eine Naturgewalt, ein Vulkanausbruch. Nicht selten sprang sie unvermittelt bei Tisch auf, um auf mich zuzustürzen und mich in den Arm zu nehmen, zu küssen und zu beteuern, wie lieb sie mich habe. Meist brachte ich nur ein schales „ich dich auch“ heraus, als Kind wie als Erwachsene; sie verwirrte mich damit, aber etwas in mir genoss es auch. Und sie konnte wunderbar trösten. Beispielsweise als ich mich von meinem Rechtsanwalt getrennt hatte und selbst todtraurig darüber war, stand sie vor meiner Tür und wusch mir erst mal den Kopf, wieso ich das sichere Nest verlassen hätte, es sei doch nirgends überall Sonnenschein etc. … Hatte ich die Standpauke erst einmal überstanden, begann das Paradies: Sie steckte mich ins Bett, orderte Schlaf an, bekochte mich, las mir vor und wiegte mich wie ein Baby. Nach angemessener Zeit hieß es dann, „Jule, das Leben geht weiter, pack es an!“ In solchen Momenten fand ich sie wunderbar.
Jetzt stand ich in ihrem Haus und ich hatte mich davor gefürchtet, weil ich wusste, dieses Mal würde es das letzte Mal sein. Es tat weh zu sehen, wie die Möbel verschwanden, die Räume kahler wurden, ihre Sachen in Kisten wanderten. Furcht vor den Erinnerungen, den schlechten wie den guten, Angst nicht verzeihen zu können oder zusammenzubrechen.
Bei alledem machte sich trotzdem eine Erkenntnis in mir breit: Das Leben mit meiner Mutter war gut gewesen. Es war gut, Mama. Und das hätte ich dir gerne noch sagen wollen.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at