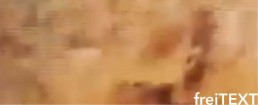freiTEXT | Sara Hauser
Der Springer
Ein Mann zog sich einen Spezialanzug an, stieg in einen Heißluftballon und fuhr damit in den Himmel hinauf bis er die Erde nur noch als kleine Kugel sehen konnte.
Dann bekam er Heimweh und sprang aus dem Korb.
Er verfehlte die Erde nur knapp.
Sara Hauser
bereits erschienen in ]trash[pool Nr.6
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Peter Berg
Spieglein, Spieglein
Weshalb ich jenes Foto gelöscht habe, wollte mein Freund Christian wissen, eines der Bilder von unserem letzten Auftritt. Und ich wusste nicht so Recht, was ich darauf antworten sollte. Außer dass, mit zunehmendem Alter, sich der Sinn für Ästhetik weiterentwickelt. Anderenfalls nämlich müsste ich zugeben, dass ich wohl immer hässlicher werde.
Erst neulich habe ich mein Spiegelbild dabei ertappt, wie es näher und näher rückte, so als würde es mich kaum erkennen, als würde es sich wünschen, wir hätten nicht viel gemeinsam. Diese Falten, und diese Augenringe! Und Peter? Wieso hast du eigentlich so eine große Nase? Na weil… Damit ich besser… Nee, keine Ahnung. Ich bin olfaktorisch blind!
„Quatsch,“ sagte mein Freund Christian, „du bist überhaupt nicht hässlich. Jedenfalls nicht direkt. Du bist nur eitel!“
Ich hoffe, er hat Recht. Ich hoffe, ich bin niemand, den nicht mal eine Mutter lieben kann. Der Vorteil der Eitelkeit ist jedoch: Man sucht die Fehler nicht bei anderen.
Deshalb dachte ich vor einiger Zeit, es läge vor allem an meiner Figur. Da mein Sinn für Ästhetik mir jedoch den Kauf einer Jogginghose verbietet, hatte ich stattdessen eine Personenwaage gekauft. Extra große Ziffern und ausgelegt für 180 Kilo. Das sollte genügen, selbst in schweren Zeiten, meint man doch. Allerdings: Die Waage erzielte kaum einen Effekt, ich wurde nicht dünner. Nicht, bis ich die Hauslatschen weg ließ, …nur wenig erniedrigend. Später dann Sweatshirt, Hose, Unterwäsche.
Als ich dann noch zu diskutieren begann, jedes Mal, wenn ich nackt vom Klo kam, vielleicht war es auch schon mehr so eine Art Wimmern: „Komm schon, wenigstens eine Kommastelle!“, habe ich die Waage zurückgegeben.
Man merkt es wahrscheinlich kaum, doch einer der Nachteile der Eitelkeit ist ein leichter Hang zum Selbstmitleid. Ich glaube aber inzwischen auch nicht mehr, dass die Figur eine so große Rolle spielt. Ich meine: Vielleicht ist es ja weniger das Gewicht als das Gesicht. Nur um ganz sicher zu gehen, hatte ich vor einiger Zeit begonnen, mir einen Bart stehen zu lassen. Manche Frauen lieben das, habe ich gehört. Mutter offenbar nicht. Sie erschrak und wollte ihren Sohn nicht einmal umarmen. Wo meine Mutter jedoch nur Faulheit vermutet, fürchtete Vater eine Art Sinneswandel. Ob ich zum Islam konvertiert sei, wollte er wissen. Nun ja, wenigstens die Katze verhielt sich wie immer und fauchte mich an.
Tiere allerdings haben es in dieser Beziehung auch sehr einfach, denn egal ob sie nun pummelig sind oder ein wenig zerzaust: Sie sind eigentlich immer niedlich. Und auch fotogen! Zumindest, wenn es nach meinem Freund Christian geht, dessen Urlaubsbilder stets auch eine kleine Kollektion plattgefahrener Vögel enthalten.
Und ich bin überzeugt, dass Tiere ahnen, wie sie wirken. Vielleicht sind sie nicht unbedingt eitel, sie mögen sich aber selbst, so viel steht fest. Mein fetter Wellensittich etwa, zu albern: Sobald man ihm einen Spiegel vorhielt, begann er zu tänzeln und irgendwelchen Kauderwelsch zu brabbeln.
Beneidenswert, wenn man so unbefangen sein kann, wenn man keinen Sinn für Ästhetik zu haben braucht. Gelegentlich aber hat man selbst auch solche Tage. Das sind jene, an denen man sich zufällig in den Schaufensterscheiben bemerkt, und man sagt zu sich selbst: „He, siehst aber gut aus heute! Die Hose macht doch nicht so fett.“
Dabei wird man vielleicht auch ein wenig übermütig und probiert mal eine neue Gangart aus. Zu albern! Denn hinter einem dieser Schaufenster, an denen man gerade vorbei schlurft, ist ein Café. Gäste hören plötzlich auf, an ihren Getränken zu nippen: War das nicht eben Peter Berg? Sah aus als würde tänzeln und irgendwelchen Kauderwelsch brabbeln.
Wie auch immer. Mein Freund Christian hatte schon am nächsten Tag ein neues Foto hochgeladen. Eines, das mich mit einer pochenden Ader am Hals zeigt, mit Falten auf der Stirn und mit Augenringen. Aber Leute mochten es. Und vielleicht hat er Recht. Vielleicht bin ich ja nur eitel. Damit gleichwohl bin ich nicht allein.
Denn was passierte, als ich die Waage zurück bringen wollte? Zunächst nicht viel: „Umtausch ausgeschlossen!“ Aber die sei kaputt, behauptete ich vor den skeptischen Augen der Verkäuferin.
„Blödsinn.“
„Hier bitte,“ sagte ich, „testen Sie!“
Als dann die extra großen Ziffern zu leuchten und ihre beiden Kolleginnen zu kichern begannen, erhielt ich mein Geld zurück.
„Sie haben völlig Recht, die ist offenbar kaputt!“
Peter Berg
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Roman Wallat
Nancy
Ich tippele auf dem Bürgersteig herum. Allein die Tatsache, von ihr abgeholt zu werden, versetzt mich in Neugierde. Wir wollen zu dritt irgendwohin, mit noch anderen Leuten was machen. Abends `n Bierchen, vielleicht an den See. Ich kenne ihre Freundin.
Sie kommt vorbeigerauscht in diesem roten, alten Volvo. Ich sehe ihr Gesicht, edel, sehr edel, öffne die Autotür und springe hinten in den Wagen hinein. Sie fährt los, und ich weiß nicht, vielleicht haben wir keinen Redestoff, keinen Ansatz, vielleicht ist es aber auch etwas anderes, etwas komplett Entgegengesetztes, wir sind nur ein paar Straßenzüge unterwegs, ein paar vergilbte Häuser, da kommt sie auf die Idee, die Kassette in den Player zurückzudrücken, und ehe ich so richtig schnalle, was hier gerade abgeht, kommt mir von vorn brettlaut Nirvana entgegengedröhnt. Das macht mich nervös. Das elektrisiert mich! Bisher hatte ich diese Dame unter French-Pop abgelegt. Ich meine, ich kenne sie... - vom Sehen!
Ich kurbele das Seitenfenster herunter. Ein Windzug, das Grün der Sommerbäume, Sonne und Schatten im Wechselspiel, ein paar bunt-berockte Mädels auf ihrem Weg ins Kino. Die Luft ist noch warm, es wird wohl keinen Regen mehr geben. Ich blicke nach vorn - und sehe ihre Beine von der Seite. Edel verpackt in eine grüne Lederhose, sehr coole Beine, dazu dieser killende Gesang von Cobain, der sowieso der totale Hammer ist, immer mehr mein Spaß-Bruder...
Ein neuer Song von diesen drei Strand-Typen aus Seattle, diesen natural born Marokkanern, diesen Song-Anarchisten und plötzlich verwischt alles, die Welt vibriert, draußen ist es heiß, brüllend heiß, das ist für sich gut, es gibt auch nichts mehr zu erreichen, alles quasi in cosmischer balance, die junge Dame da vorn ist vielleicht außer Reichweite, aber das ist alles egal, totally equality, ich habe Lust, mir jetzt sofort ein Bierchen zu köpfen oder auf dem Rücksitz herumzuhüpfen wie ein Verrückter - scheiße, ich komme mir vor wie ein willkommener Außenstehender. Und blicke mal wieder nach vorn. Schwarze Haare, blasse, lange Wangen, geschwungener roter Mund. Eine Französin. Und was macht sie? Sie summt mit den Jungs mit. Elegant, dunkel, schön und sexy. Ich werde wieder unruhiger.
Wir kommen an einer Ampel vorbei, sie fragt mich, ob mir die Musik gefällt, ich sage ja, klar. Ihr Haarspray liegt in der Luft. Wir kurven weiter durch den Sommerabend. Dann kommen wir zu der Wohnung unserer Freundin.
Das war's dann erst mal.
Roman Wallat
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Jörn Birkholz
Mit den Augen meines Bruders
Seine Wohnung roch wie immer muffelig. Ich ging, oder kämpfte mich durch die Zimmer. Überall lagen Sachen herum, zumeist Bücher, Zeitschriften oder Papier, dazwischen Geschirr mit eingetrockneten Essensresten. Knapp zwanzig Jahre hatte er hier gehaust. In dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im fünften Stock eines Sozialbaus. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr besucht, die Kinder auch nicht. Er hatte seine Nichten bestimmt seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. So hatte er nicht mal mehr mitbekommen was für verwöhnte, gelangweilte und Smartphone abhängige Teenager sie inzwischen geworden waren. Und trotzdem konnten sie mich jederzeit um den Finger wickeln. Ein Vater kann eben nicht aus seiner Haut. Es war alles Monikas Schuld; irgendjemandem muss man ja schließlich die Schuld geben. Monika wollte nicht mehr, dass er uns besuchte, und ihn besuchen wollte sie schon gar nicht. Sie war nie besonders gut mit meinem Bruder zurechtgekommen, besonders nicht in den letzten Jahren, in denen er sich immer mehr zurückgezogen hatte. Die Grillparty vor sechs Jahren – das letzte Mal, als er bei uns gewesen war – wäre beinahe in einer Katastrophe geendet. Nicht nur, dass er beim Feuermachen beinahe die Terrasse abgefackelt hätte, er hatte die Mädchen später auch noch erfolgreich zum Weintrinken animiert, und dabei waren die beiden damals gerade mal sechs Jahre alt gewesen. Zoé übergab sich die ganze Nacht über, und wir (hauptsächlich Monika!) hatten sogar überlegt, den Notarzt zu rufen.
Dein Bruder betritt unser Haus nie mehr, schrie Monika außer sich. Ich musste es ihr versprechen, was nicht so schwierig war, denn Moritz verlangte es nicht danach wiederzukommen. Er fand meine Töchter gewöhnlich, und Monika hielt er für kalt und begrenzt. Er brauchte es mir nicht mal zu sagen. Ich sah’s an seinem Blick. Der Blick sagte alles, und er verletzte mich. Dieser Blick verletzte mich deshalb so sehr, weil ich wusste, dass Moritz nicht ganz falsch lag. Und leider lag er sehr selten falsch. Außer in seinem eigenen Leben. Für mich war es immer ein Rätsel geblieben, wieso er aus seinem Potential nichts gemacht hatte, außer dieser dämlichen Schreiberei, die ihm in knapp dreißig Jahren wahrscheinlich weniger als tausend Euro eingebracht hatte.
Werd doch Journalist, wenn’s mit deinen Texten nicht so richtig läuft, schlug ich ihm einmal vor.
Er lachte bloß und sah mich mitleidig an, obwohl doch eigentlich ich ihn so hätte anschauen sollen.
Was bringen dir deine vier Buchveröffentlichungen, wenn die Dinger kaum ein Mensch liest, provozierte ich ihn weiter. Wie zum Teufel willst du davon leben?
Wieder lächelte er bloß nachsichtig und entgegnete, und das in keineswegs herablassendem Ton:
Bruder, es würde mich ehrlich freuen, wenn du leben würdest, und wenn’s nur mal einen Tag lang wäre.
Seine Überheblichkeit – die gar keine Überheblichkeit war, was ich aber erst kürzlich begriffen hatte – machte mich rasend.
Dann leb doch wie ein Penner, bellte ich weiter, inmitten all deiner Bücher und Zeitschriften, wenn dich das glücklich macht, bitte, aber lass uns in Frieden.
Um ehrlich zu sein, ließ er uns in Frieden. Nie hätte er uns belästigt, oder um irgendwas gebeten, er kam zurecht, wenn es sein musste, aß er eben mal zwei Tage kaum etwas. Ständig stand er im Konflikt mit dem Jobcenter, das ihm in stumpfer Regelmäßigkeit Maßnahmen wie Pizzakurier, Straßenkehrer oder Zeitungsausträger aufzwingen wollte, worauf mein Bruder seinem Fallmanager jedes Mal ins Gesicht lachte, oder ihn mit Eichmann verglich, was ihm, neben den Sanktionen, auch noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung eingebracht hatte.
Ich musste mir eingestehen, dass ich meinen Bruder gar nicht aus Schuldgefühl besuchte, sondern nur darum, weil es mir damals unangenehm war, einen jüngeren Bruder zu haben (ich war ein Jahr älter als er), der wie ein Aussteiger oder Penner lebte. Schließlich wohnten wir in einer Kleinstadt, jeder kannte jeden. Monika hatte sich mehrfach wütend bei mir beschwert, dass sie beim Einkaufen oder beim Friseur darauf angesprochen worden war, dass mein Bruder mal wieder betrunken singend durch die Einkaufspassage oder über den Marktplatz getorkelt war. Dabei war er kein Alkoholiker, er trank wahrscheinlich sogar deutlich weniger als jedes durchschnittliche Mitglied im Schützenverein. Nur wenn, dann lebte er es aus, und die Menschen, die ihn dabei beobachteten scherten ihn einen Dreck. Gelegentlich musste ich ihn auch bei der Polizei abholen, wenn sie ihn mal wieder irgendwo aufgelesen hatten. Widerstandslos hatte er sich dann immer abführen lassen, und brav die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Monika war jedes Mal vollkommen außer sich gewesen, und verbat mir zukünftig ihn da raus zu holen, was ich natürlich doch wieder tat und was dann meist einen heftigen Streit mit ihr nach sich zog. Aber was sollte ich machen, er war schließlich mein Bruder. Im Stillen bewunderte ich ihn, obwohl ich niemals so hätte leben können. Schon gar nicht ohne Frau, auch wenn ich letztendlich nur so ein schlichtes Exemplar wie Monika ergattert hatte. Er hatte ja immerhin ein paar Jahre seine Sophie gehabt – wenigstens das. Die beiden waren unzertrennlich gewesen und das nicht mal auf unangenehme Weise. Bis sie schließlich einer Hirnhautentzündung erlag - aufgrund eines lächerlichen Zeckenbisses! Danach waren Frauen für ihn kein Thema mehr gewesen. Aber auch Monika hatte ihre guten Seiten; sie mochte Sex, wenn auch heutzutage nicht mehr so stark, wie, bevor die Kinder kamen. Aber Sex ist ja nun einmal das zentrale Bindeglied einer Ehe, da wird mir keiner was anderes erzählen. Und derjenige, der das tut, belügt sich selbst. Mir war schon damals klar geworden, dass ich das, was Moritz und Sophie miteinander verband - diese Art von Intensität - mit Monika niemals würde erreichen können. Aber was soll’s, und was lohnt es sich darüber nachzugrübeln; Sophie war jetzt bereits seit neun oder sogar zehn Jahren unter der Erde, und Monika erfreute sich noch immer bester Gesundheit. Selbiges galt für ihre Hirnhaut, denn Zeckenbisse hatte sie in den letzten Jahren unzählige gehabt. Kein Wunder, so viel wie sie immer in unserem Garten herumwuselte.
Schreibst du eigentlich auch Lyrik hatte ich ihn einmal gefragt.
Bist du wahnsinnig, so tief würd ich niemals sinken, hatte er lachend geantwortet.
Mir war es im Grunde ganz gleich, was er schrieb. Auch Monika hatte sich nie für die schriftstellerischen Ergüsse meines Bruders interessiert. Dazu war ich mir sicher, dass sie sie abgelehnt hätte, obgleich ich zugeben muss, dass auch ich mir nicht sicher war, ob sie mir gefielen. Sie waren mitunter sehr derb, wenn auch teilweise witzig und oft mit feinen Beobachtungen gespickt, aber was versteh ich schon von Literatur.
Zu glauben, Literatur zu verstehen oder eben nicht, ist lächerlich, sagte er einmal. Jeder glaubt sie ohnehin nur aus seiner eigenen begrenzten Glasblase heraus zu begreifen. Müßig sich darüber den Kopf zu zerbrechen, also lass es am besten.
Ich ließ es. Und auf meine Frage wie viele Exemplare er von seinen Romanen verkauft hatte, entgegnete er auch immer nur dasselbe.
Keine Ahnung, frag meinen Verlag.
Das war unser Running Gag, wenn ich ihn besuchte und das fragte. Sein Verlag war vor einigen Jahren in Konkurs gegangen. Sie hatten ihn sogar um die letzten fälligen Tantiemen beschissen, aber Moritz war das vollkommen egal. Geschriebene Bücher gehörten für ihn ohnehin zur Vergangenheit, genau wie das Frühstück, über das sich am Abend auch kein Mensch mehr Gedanken macht. Selbiges galt für den Abverkauf seiner Bücher. Es war ihm Scheißegal. Ich konnte es manchmal selbst kaum glauben. In seiner Wohnung lagen auch dutzende, mitunter total verstaubte Literaturzeitschriften herum - mit so hochtrabenden Namen wie „Perspektive“, „Am Erker“, „Akzente“, „Das gefrorene Meer“, oder „Sinn und Form“ in denen er mal etwas veröffentlicht hatte. Nachdem ich erfahren hatte, dass fast keine davon ihren Autoren auch nur einen Cent bezahlt, und man lediglich ein oder zwei dämliche Freiexemplare bekommt, hätte ich die Teile am liebsten in den Müll geworfen.
Mach doch, wenn du willst, hatte mein Bruder mich immer wieder ermuntert, aber dafür war ich dann doch zu faul.
Es gibt sowieso zu viele Zeitschriften, fügte er noch hinzu, genau, wie es zu viele Autoren, Banker, Anwälte und dämliche Politiker gibt, und die meisten davon sind genauso nutzlos und überflüssig wie ich es bin.
Warum machst du es dann?
Ich wüsste nicht was ich sonst machen sollte, antwortete er trocken, es schirmt mich ab gegen den Schwachsinn und die Borniertheit da draußen.
Gott ist das staubig hier, dachte ich, als ich weiter durch seine Wohnung latschte. Abermals nahm ich mir willkürlich einen seiner Texte zur Hand, die überall in der Wohnung verstreut herumlagen. Einige handschriftlich, einige am Computer geschrieben. Die Handschriftlichen konnte ich kaum entziffern, und die in den Computer gehämmerten erschlossen sich mir nicht immer. Vielleicht waren es unvollendete Entwürfe, aber womöglich war ich jetzt einfach nicht in der Stimmung seine Arbeiten zu lesen.
Mein Bruder fehlte mir, obwohl ich ihn vor dem Unfall seit knapp einem Jahr nicht mehr gesehen hatte. Es hatte mir immer genügt zu wissen, dass er da war. Was mach ich bloß mit seinem ganzen Kram? Seinen Verlag gab es ja nicht mehr, wem sollte ich es dann schicken, einem anderen Verlag, und wenn ja, welchem? Oder es vielleicht doch alles in ein paar Kartons stopfen und erstmal bei uns im Keller lagern - Monika würde sich freuen - oder einfach alles wegschmeißen. Dieser Idiot! Konnte er nicht besser aufpassen, wenn er über die Straße latscht. Heißt es nicht, Betrunkene und Kinder haben einen Schutzengel. Im Grunde war Moritz doch sogar beides, aber wo zum Teufel war sein verdammter Schutzpatron gewesen, der ihn sicher hätte auf die andere Straßenseite bringen müssen. War wohl nix. Man konnte ihn nicht mal mehr identifizieren, nachdem der Laster über ihn gebrettert war. Nur noch ein Haufen Autorenmatsch war übrig. In diesem Zustand konnte er Sophie im Himmel wohl kaum unter die Augen treten. Sie würde sich mächtig erschrecken. Was denke ich hier eigentlich für einen Unsinn? Verdammt mein Bruder fehlt mir.
Ich schlenderte weiter durch die Wohnung. Gott, ist die Luft hier staubig, meine Nasennebenhöhlen drehten schon durch. Ich holte mein Taschentuch raus. Scheiße, heute ist Mittwoch. Zoé muss ja zur Nachhilfe. Morgen ist die Klassenarbeit. Wenn ich sie da zu spät hinbringe, macht Monika mir wieder die Hölle heiß. Was soll’s, sonst findet sie einen anderen Grund, Gründe findet sie ja immer. Ich will noch ein bisschen hierbleiben, auch wenn die stickige Luft hier kaum auszuhalten ist. Vielleicht sollte ich endlich mal ein Fenster aufmachen. Egal, ich muss sowieso gleich los, bin eh schon viel zu spät. Er fehlt mir, der verdammte Mistkerl, und doch hätte ich niemals mit ihm tauschen wollen, oder vielleicht doch - vielleicht wenigstens mal für einen Tag.
Jörn Birkholz
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT Spezial | Elvira Santos
Ostergeschichte
In allen Farben präsentierten sich die Schokoladenostereier in dem winzigen Schaufenster des Ladens von Dona Maria: blau, rosa, rot, weiß, lila, grün, gelb, nur nicht schwarz. Die schönsten waren so riesig, dass das kleine dunkelhäutige Mädchen sie nicht in einer Hand halten konnte. Die kleinen Eier aber waren so groß wie das Hühnerei, das sie morgens noch ganz warm aus dem Stall geholt hatte. Es schmeckte gut, vor allem als Spiegelei mit einem Dotter, der so glänzte wie die Mittagssonne.
Das kleine Mädchen lachte das große in Gelb eingepackte Ei im Schaufenster an, wo sie auf dem Rückweg von der Schule vorbeikam. Morgens um sieben, wenn sie zur Schule ging, waren die Ostereier hinter einem Rollladen versteckt. Wenn der Unterricht beendet war, rannte das Mädchen aus der Schule, damit sie mehr Zeit hatte, ihr Osterei zu betrachten, bevor das Geschäft zur Mittagspause schloss. Die alte Ladenbesitzerin mit dem strengen Gesicht fragte nicht, ob das Mädchen etwas wollte. Von draußen konnte niemand die Eier stehlen, denn sie standen hinter einem Glasfenster, so dass nur Dona Maria sie mit ihrer großen Hand erreichen konnte. Das Mädchen ging weiter. Die Mutter wartete auf sie, um ihr ein Spiegelei zu braten.
„Hast du wieder vor dem Schaufenster gestanden?“ Das Mädchen ließ sich auf den Küchenstuhl fallen und nickte. Die Mutter stellte einen Teller vor sie auf den Tisch. Der Dampf von Reis und schwarzen Bohnen stieg ihr ins Gesicht. Die Pfanne mit dem heißen Fett stand auf dem Herd. Die Mutter nahm ein Ei aus einem Korb der wie ein Huhn geformt war. Da rief das Mädchen: „Nein, Mama! Bitte nicht!“ „Was? Willst du heute kein Spiegelei?“ „Doch, aber ich könnte stattdessen jeden Tag ein Ei verkaufen. Es sind noch drei Wochen bis Ostern.“ „Ja, aber mit dem Geld könntest du gerade einmal ein Ei so groß wie eine Kirsche kaufen.“ Die Mutter hielt das Ei in der Hand. „Wem willst du es denn verkaufen?“ Das Mädchen ließ den Kopf sinken.
Am folgenden Tag holte das Mädchen ein Ei aus dem Stall, wickelte es sorgfältig in Brotpapier und nahm es in ihrem Ranzen mit zur Schule. Als es zur Pause schellte, wartete sie, bis ihre Mittschüler fort waren. Dann ging sie zum Lehrertisch und blieb stehen. Die Lehrerin saß dort und schrieb konzentriert im Klassenbuch. Nachdem sie das Buch geschlossen hatte, berührte das Mädchen die linke Hand der Frau, legte das ausgepackte Ei hinein und blieb wortlos stehen. „Ah! Meine Liebe!“, sagte die Lehrerin und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Eilig lief das Mädchen hinaus. So geschah es jeden Tag in der Pause. Das Mädchen blieb sitzen und wartete, bis alle Mitschüler den Raum verlassen hatten, holte ein Ei aus ihrem Ranzen, ging zum Lehrertisch, blieb stehen und hielt es der Lehrerin wortlos hin.
Am Mittwoch vor Ostern bekam die Lehrerin das letzte Ei. Wie immer bedankte sie sich mit einem Kuss auf die Wange, und das Mädchen verschwand still in die Pause.
Nach der Schule blieb sie wieder am Ostereierfenster stehen. Es standen nur noch ganz wenige Eier dort, aber ihr gelbes Schokoladenei glänzte wie die Sonne.
„Hast du schon das Geld für dein Osterei?“ „Nein, Mama. Meine Lehrerin hat mir noch nichts bezahlt.“ Sanft klopfte ihr die Mutter auf die Brust. Aus dem Teller stieg der Dampf von Reis und schwarzen Bohnen dem Mädchen ins Gesicht. Sie aß schweigend.
Am Ostersonntag Morgen, als das Mädchen die Küche betrat, stand ein großes eiförmiges Gebilde, glänzend wie die Sonne, auf dem Tisch. Die Ananasblätter schauten aus der Verpackung heraus.
Am ersten Schultag nach Ostern, als die Kinder in die Pause gingen, blieb das Mädchen sitzen. Die Lehrerin schrieb etwas ins Klassenbuch. Dann holte sie unter ihrem Tisch eine große Papiertüte hervor, lief zu dem Mädchen und überreichte sie ihr. Das Mädchen musste aufstehen, um das Köpfchen in die Tüte stecken zu können. Sie entnahm ihr ein in Gelb eingepacktes Schokoladenei. Es war so groß wie eine Ananas.
Elvira Santos
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Friedrich Bastian
Tag der Toten
Die Musiker drücken sich aneinander, um eine Gruppe Passanten vorbeizulassen. Der Pfad, auf dem sie stehen, ist schmal, eigentlich zu schmal, aber es gibt keine andere Möglichkeit, keinen anderen Platz, der es ihnen erlaubt ihre Lieder vorzutragen. Sie versuchen sich nicht von der Enge beirren zu lassen, die Passanten geben sich Mühe, nicht gegen sie zu stoßen. Trotzdem ist es schwer auf so kleinem Raum zu spielen. Hin und wieder treffen Ellbogen aufeinander, werden Entschuldigungen gehaucht und verlegene Blicke getauscht. Die Trompeten hätten gern mehr Freiheit, ebenso die dickbäuchige Gitarre mit ihren großzügigen Rundungen. Die Musiker erdulden die Unannehmlichkeiten, indem sie die Augen schließen oder in die Ferne schauen, während sie ihre Instrumente spielen. Sie geben sich Mühe, die Enge nicht zu bemerken, sie nicht zu sehen. Gemeinsam mit der Musik fliegen ihre Blicke Über die Köpfe der Leute, nur ihre Körper lassen sie zurück in der Menge. Auf diese Art ist es leichter, so können sie besser in die Lieder eintauchen und das Gedränge ignorieren. Nur der Sänger hat mehr Platz, an ihn trauen sich die Leute nicht so nah heran. Er muss seine Arme bewegen können, wenn es dramatisch wird, muss einen Schritt vor oder zurück machen können, wenn ihn die Emotionen Übermannen. Darin will ihn niemand stören.
Der Fluss der Passanten nimmt kein Ende, es wimmelt um die Musiker wie in einem Ameisenhaufen, es kommen immer mehr Besucher und niemand scheint zu gehen. Die meisten verbringen den gesamten Nachmittag und Abend hier, bringen ausreichend Verpflegung mit. Manch einer trägt einen ausklappbaren Hocker unter dem Arm.
Die Trompeten erklingen. Mehrere Leute drehen sich nach ihnen um. Sie sind laut und schrill, Übertönen die anderen Instrumente, den Lärm der angrenzenden Straße und das Gerede der Massen.
An diesem Tag sitzen die Vögel weder auf den Mauern noch in den Bäumen. Sie warten auf den kahlen Feldern, bis es ruhiger wird und sie zurückkehren können. Die Bäume stehen starr und dürr dabei, ihre Äste leer. Der Wind mag sie nicht schaukeln oder beugen, er lässt sie ungestört zusehen. Außerdem fürchtet er sich ein bisschen, wagt es nicht, sich in das Durcheinander einzumischen oder die Leute wegzutragen.
Die Menschen liegen sich in den Armen, klopfen sich auf die Schultern, drücken sich aneinander. Gemeinsam erinnern sie sich, graben alte Geschichten hervor, um sie noch einmal zu erleben mit denen, die darin vorkommen. Noch einmal zusammen sein. Noch einmal das Vergangene mit dem traurigen Jetzt vertauschen. Mut sprechen sie einander zu, jemand macht einen Witz, weil mit Spaß alles leichter zu ertragen ist. So mischt sich Lachen in die Trauer. Schön und schaurig ist die Welt auf dem Friedhof.
Der Sänger gibt den Ton an, mit fester Stimme und großer Brust singt er Über die Mühen der Hinterbliebenen. Wie sie ihren Alltag neu besorgen, versuchen das leere Haus zu füllen und beim Essen einen Teller weniger auf den Tisch stellen. Wie sie die Toten nicht vergessen und doch vergessen müssen. Es schmerzt, trotzdem geht es weiter. Seine Stimme gibt Hoffnung, ihre Kraft hält für einen Moment alles zusammen und lässt die Leute aufatmen. Ein alter Mann kann sich im Gedränge nicht auf seinen Gehstock stützen, er verliert das Gleichgewicht und stößt gegen die dickbäuchige Gitarre. Schrille Töne mischen sich unter die Musik, aber sogleich helfen zwei hochgewachsene, junge Burschen dem Alten, ziehen ihn in ihre Mitte, weg von den Musikern und ihren Instrumenten, entschuldigen sich mit einem Grinsen und einem Lob für die Lieder, die bestens zum Tag der Toten passen.
Die Hände meiner Schwägerin greifen mich bei der Häfte, wollen mich zu der Musik bewegen. Sie möchte tanzen oder eine Polonaise anfangen. Das überrascht mich, starr wie ein Stein bleibe ich stehen und schaue sie an. Das habe ich nicht erwartet. Es scheint mir der falsche Ort, die falsche Situation für einen Tanz zu sein. Verwundert blicke ich in ihr hübsches Gesicht. Ihre Augen sind rot, glasig. Sie hat viel geweint, ist erschöpft vom Singen und den vielen Umarmungen, die nicht aufhören wollen und mit jedem Mal schwerer werden. Ihr Blick verrät Müdigkeit, aber sie gibt sich Mühe, zieht den Mund breit und hoch zum Grinsen. Keine Traurigkeit, keine Erschöpfung. Zwischen fröhlich und traurig kann man wählen oder es zumindest versuchen. Sie lacht kurz auf, greift in einen Rucksack, der auf dem Boden steht, und holt eine neue Flasche hervor. Ich lache auch.
Mehr Tequila!, Auf unseren Großvater!, Auf unsere Großmutter!, ruft sie und stößt ein Glas hinunter, dann legt sie einen Arm um mich, dreht ihr Gesicht weg von ihrem Mann, der zu uns hinüberschaut. Ich halte ihr mein Glas vor und sie fällt es mit Tequila auf. Sie hat schon zu viel getrunken, aber heute trinken alle zu viel. Wer nicht trinkt, hat kein Herz. Man kann nur zu wenig, aber nicht zu viel trinken. Auf dem Boden zwischen den Gräbern liegen die leeren Flaschen. Noch einen Schluck! Auch die Toten wollen trinken, auch sie freuen sich, dass wir alle zusammenkommen.
Kräftig ertönen die Stimmen der Mariachi-Musiker. Sie ziehen die Worte bis zur Unkenntlichkeit lang, im nächsten Moment können sie reißen und alle Umstehenden niederbrechen. Das Kreischen eines Hahns ist von jenseits zu hören, von der anderen Seite der Friedhofsmauer. Am Grab neben uns weint, schluchzt eine Großfamilie. Insgesamt vierzehn Personen. Jeder stellt Blumen und Kerzen auf das Grab, damit es schön leuchtet. Der weiße Stein ragt hervor, ruhig und standhaft inmitten der grellen Farben und Töne.
Mein Vater Pedro Páramo trank viel und schlug meine Mutter, flüstert meine Schwägerin in mein Ohr. Ihr Mann schaut noch immer zu uns hinüber, drückt die Augen zusammen und verzieht den Mund. Sie umarmt mich. Ich habe ihn trotzdem geliebt und vermisse ihn schrecklich, sagt sie und legt ihren Kopf auf meine Schulter.
Die Trompeten krachen erneut durch die Luft. Die Mariachis schreien auf, wir fallen ein. Für einen Moment vibriert die Luft in der Lunge zusammen mit der Luft über den Gräbern. Sie ist kalt, schmerzt und belebt. Ein Stechen in der Brust drängt hinaus, die Geige zieht es lang, die Trompeten ziehen es fort. Es werden Blumen in die Luft geworfen, die Blumen der Toten, ihre Blüten brechen in der Luft auseinander, gehen gelb orange auf uns nieder.
Sei nicht so ernst, nimm noch einen Schluck und bring nächstes Mal deine Verwandten mit, wir wollen mit ihnen singen und feiern. Der Tequila brennt in mir, in meinem Mund und Hals, in meinem leeren Magen und leerem Kopf. Warm und matt ist er. Ich schaue mich um, will sehen, wer mir zuredet. Aber niemand beachtet mich, niemand spricht mit mir. Mir ist schwindelig, deshalb atme ich kräftig ein und aus, versuche an nichts zu denken. Mein Magen knurrt. Nimm die Hand von meiner Tochter, sie ist verheiratet, sagt er, oder ich bringe dich um.
Die dickbäuchige Gitarre setzt ein, gesellt sich zu den Trompeten und versucht etwas Ruhe zu verbreiten, versucht die Wogen der Aufregung zu glätten, aber die Stimme des Sängers überschlägt sich im Angesicht der Trauer und macht alle Bemühungen der Gitarre zunichte. Mit ungestümer Hingabe wirft der Sänger die Arme in die Höhe, lässt sie wie Luftschlangen umherfliegen. Seine Augen sind geschlossen, sein Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse. Mit den Armen will er die Welt umarmen oder befreien. Dabei schlägt er einer dicken Frau ins Gesicht, die zu nah bei ihm steht und sich nicht vor ihm in Acht nimmt. Die Dicke ist wütend, will sich beschweren, will den Sänger anschreien und an seinem glänzenden Anzug ziehen, aber niemand beachtet sie und so wird sie im Strom der Menge einfach hinweg getragen.
Feuerwerk mit viel Krawall und Rauch donnert über uns und für einen Moment hört man die Mariachis nicht, man zuckt zusammen und schaut um sich. Die Mütter, Töchter, Witwen heulen wie Verrückte, die Männer jammern und trinken, als müssten sie sich in die Gräber legen und dürften sich nie wieder gehen lassen. Der Wind ist noch stiller als zuvor, erschrocken wie ein kleines Kind.
Friedrich Bastian
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Ronya Othmann
دكرت , دكرت
die unschärfen im beton, wozu wir fähig wären wenn, - ich fühle mich schuldig im anbetracht der sonne vier uhr nachmittags. die bruchkanten in dieser stadt nicht sehen, morgen, übermorgen. aufschreiben, damit ich es nicht vergesse, wenn es darauf ankommt. was weißt du schon von gesalzenen sonnenblumenkernen, von diesem staub.
dieser körnige sand fünfhundert kilometer weiter. den salzgehalt des wassers messen. da hat aber einer viel geweint. die militärhubschrauber stündlich. vögel im sinkflug. wie lange wir gelaufen sind. ich kann gar nicht sagen. unter der sonne solche albernheiten. die grenze ist nicht weit. nur eine schusslänge entfernt. woran mich das erinnert. die hügel wie festungen, berge, aber brüchig. ich habe kein wort für die schraffuren am himmel, für das was sie bezeichnen.
Ronya Othmann
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Elvira Santos
Senhor Valdemars Laden
Rio de Janeiro - Anfang der 1970 er Jahre
Es geschah am Freitagnachmittag. Meine Kolleginnen, die viel älter als ich waren, standen vor dem Laden im Kreis und unterhielten sich. Sie konnten sehr laut sein, wenn sie über Männer redeten. Senhor Valdemar zählte das Geld in der Kasse am Ende des Ladens. Eine Reihe von Warentischen teilte den engen Laden in zwei lange Gänge. Ich stand am Warentisch in der Mitte und sortierte Stofftiere und Puppen in Miniaturgröße.
Mama hatte mir diesen Ferienjob besorgt. Sie hatte Senhor Valdemar gefragt, ob er mich in seinem Laden brauchen könnte. „Bringen Sie das Mädchen her.“ Sie war zu Fuß nach Hause geeilt, um mich zu holen. Eine Stunde später hatten wir schwitzend vor ihm gestanden.
„Wie heißt du, Mädchen?“
Ich hatte meinen Vornamen genannt, und er hatte das Gespräch nur mit Mama fortgesetzt.
Mama hatte über ihr ganzes Gesicht gestrahlt, als wir den Laden verlassen hatten, und das hatte mich glücklich gemacht. Wir hatten den Heimweg angetreten.
„Vielleicht kannst du die ganzen Schulferien lang dort arbeiten.“
Eine Woche vor Weihnachten begannen die Sommerferien, die bis Mitte März dauerten. Ich würde drei Monate arbeiten und Geld verdienen, um meine Familie zu unterstützen.
„Mama, wie viel werde ich verdienen?“
„Wer weiß, vielleicht einen Mindestlohn.“
Die Sonne hatte um diese Mittagsstunde gnadenlos auf meinem Kopf gebrannt, und ich hatte im Schatten der Pinienbäume einer Fabrik eine kurze Pause eingelegt, kurz bevor man in unsere Straße einbog. Mama war weitergegangen. „Soll ich Senhor Valdemar morgen fragen, Mama?“
Sie hatte abrupt innegehalten und sich zu mir umgedreht. Auf ihrer Stirn hatten sich Falten gebildet. Ihre kleinen braunen Augen, die wie Mandeln aussahen, waren groß geworden. „Auf keinen Fall!“
„Und warum nicht?“
„Weil du sonst den Eindruck erweckst, dass du nur am Geld interessiert bist.“
„Ja.“ Wir waren weitergegangen. „Mama, jeder im Laden ist weiß.“
„Deshalb musst du als Schwarze ein Vorbild sein.“
Ich kehrte gerade an den Warentisch zurück, als zwei Frauen mit zwei Kindern den Laden betraten.
Die Kinder liefen wild in Senhor Valdemars Richtung. Er schien sie weder zu sehen noch zu hören. Er zählte das Geld. Sie nahmen kleine Autos von einem Tisch, spielten damit auf dem Boden und ließen sie dort liegen. Danach durchwühlten sie einen Tisch mit kleinen Dekos aus Porzellan. Die beiden Frauen, die vermutlich ihre Mütter waren, gingen bis zum Ende des Gangs, wo sich die Kinder aufhielten, ohne auf sie zu achten. Ich beobachtete die vier. Ihr weißen Kinder seid doch verwöhnt, dachte ich. Dann hoben die Frauen ein gefaltetes Wäschestück nach dem anderen vom Tisch auf und ließen es wieder fallen. Dabei lachten sie mich an. Etwas stimmt hier nicht. Ich muss euch meine Anwesenheit zeigen. „Kann ich Ihnen helfen?“ fragte ich. Lächelnd lehnte sie ab, wobei ihre braunen Haare sich bewegten. Dann nahm eine von ihnen ein kleines Höschen von einem Tisch, das ihrem Sohn passen könnte, und schloss es in ihre Hand, während sie mich anschaute und lächelte. Was hatte sie vor? Was soll ich jetzt tun? Sie machte mir Angst, aber ich musste sie zurückhalten. Mit meinem Notizblock in der Hand tat ich einen entschlossenen Schritt in ihre Richtung und fragte:
„Soll ich Ihnen eine Quittung schreiben?“ Ich hörte, wie meine Sopranstimme zitterte.
„Nein, Danke!“
Mit strahlendem Lächeln öffnete sie die Hand, winkte mir mit dem Höschen zu, schloss sie wieder darum, und die beiden Frauen verließen den Laden. Die Kinder folgten ihnen. Meine Kolleginnen plauderten und lachten laut, und Senhor Valdemar zählte sein Geld an der Kasse.
Wie konnte ich so etwas dulden? Wie konnte ich diese Frauen einfach gehen lassen? Sie schienen ihrer Sache so sicher zu sein, als ob sie damit Erfahrung hätten. Sie könnten mich an meinem Feierabend im Dunkeln überraschen und mir weh tun, wenn ich etwas gegen sie unternähme. Hätte ich es gemeldet, dann hätte der Chef denken können, dass ich mit den Frauen zusammenarbeite. Aber wo blieb meine Ehrlichkeit?
Als der Laden sich wieder füllte, arbeitete ich unkonzentriert. Bei einer Kundin, die einen Meter Wachstuch brauchte, schnitt ich nur einen halben Meter ab. Während der letzten Arbeitsstunden sammelte ich Mut, um mit Senhor Valdemar zum Feierabend über den Diebstahl zu reden. Wo sollte ich anfangen? Senhor Valdemar, ich war Zeugin eines Diebstahls. Was für ein Diebstahl, Mädchen? Ein Höschen. Nein, wie albern! Vielleicht sollte ich lieber unserem Priester unter vier Augen davon erzählen.
Gegen halb sieben fing ich an wie immer, wenn ich keine Kunden bediente, die Warentische für den Feierabend aufzuräumen. Ab und zu schaute ich zitternd auf eine große Uhr, die hinter Senhor Valdemar an der Wand hing. Als der letzte Kunde gegangen war, warf Senhor Valdemar einen Blick über seine Lesebrille hinweg durch den Laden und verkündete: „Feierabend!”
Hintereinander gingen meine Kolleginnen und ich neben der Kasse an ihm vorbei und erreichten eine kleine Tür, die zum Hinterhof führte. Ich war die letzte. Wir holten unsere Handtaschen aus einem alten Schrank, der in einer offenen Nische stand, und kamen durch die kleine Tür zurück in den Laden. Ich ließ meine Kolleginnen vor mir gehen. „Guten Abend, Senhor Valdemar! Bis morgen!“, sagte jede. Er antwortete trocken. Ich blieb stehen, blickte zu Boden und sagte leise: „Senhor Valdemar ...“ Mit einer Handbewegung unterbrach er mich: „Ab Montag brauche ich dich nicht mehr. “
„Guten Abend, Senhor Valdemar!“, sagte ich. „Bis Morgen!“
Auf dem Heimweg überlegte ich, wie ich Mama von dem Diebstahl berichten sollte. Wie würde sie auf meine Entlassung reagieren? Für den Diebstahl fühlte ich mich verantwortlich, aber wegen der Entlassung ärgerte ich mich über Senhor Valdemar. Wenn er mir zumindest einen Grund genannt hätte ... Aber das hatte er nicht getan. „Ab Montag brauche ich dich nicht mehr.“
Ich würde Mama nur von der Entlassung erzählen und abwarten, bis ich mein Arbeitsheft zurückbekäme. Dann würde ich sehen, was er dort eingetragen hatte.
In der Küche nahm ich den Henkelmann aus meiner Handtasche und legte ihn ins Spülbecken. Mama kam zu mir: „Wie war dein Arbeitstag?“
Ich zwang mich, ihr in die Augen zu schauen. „Alles war normal, Mama.“
„Was ist denn heute passiert?“
„Senhor Valdemar braucht mich nur noch bis morgen.“
Sie schloss die Augen, hob den Kopf zur Decke und sagte: „Jesus, du weißt alles.“
Am Samstag um acht Uhr, als ich den Laden betrat, wollte ich sofort mit Senhor Valdemar über den Diebstahl reden, denn ich glaubte, dass meine Entlassung damit zu tun hatte. „Guten Morgen, Senhor Valdemar“, sagte ich mit meiner großen Handtasche über der Schulter. Aber schon als er antwortete, ohne mich anzublicken, verlor ich den Mut. Während des Vormittags beobachtete ich meine Kolleginnen, ob sie mir gegenüber misstrauisch waren, konnte jedoch keine Veränderung feststellen, wenn ich mit ihnen über die Arbeit sprach, denn etwas Anderes hatten wir nicht zu reden.
„Du kannst in die Mittagspause gehen,“ sagte Senhor Valdemar. „Iss und arbeite sofort weiter!“
Ich eilte durch die Hintertür zum Hof. In der offenen Nische holte ich meinen Henkelmann mit einer Gabel aus der Handtasche und setzte mich auf einen Hocker, um zu essen. Ich öffnete den Henkelmann, stach die Gabel ins Essen und fischte ein Stück Fleisch heraus. Mir fiel ein, dass Mama beim Abendessen kein Fleisch auf ihrem Teller gehabt hatte.
Zurück im Laden entschloss ich mich, den Wert des Höschens von meinem Lohn abzuziehen. Dann brauche ich mich nicht mehr schuldig zu fühlen.
Wie meine Kolleginnen stand ich am Feierabend in der Schlange vor der Kasse, um meinen Wochenlohn abzuholen. Ich unterschrieb im Buch und bekam einen weißen Briefumschlag von Senhor Valdemar. Nachdem ich den Inhalt überprüft hatte, stand für mich fest, dass ich weder mit ihm über den Diebstahl sprechen noch den Betrag von meinem Lohn abziehen würde. Ich verabschiedete mich einfach: „Guten Abend, Senhor Valdemar!“
Als ich nach Hause kam, ging ich in die Küche, wo Mama stand, öffnete meine große Handtasche und, bevor ich den Henkelmann herausholte, nahm ich den weißen Umschlag und übergab ihn Mama. Sie schloss die Augen, hob den Kopf, streckte die Hand mit dem Umschlag gen Himmel und sagte: „Danke, Herr!“
An einem Sonntag morgen gingen wir zu Fuß in die Kirche und kamen an Senhor Valdemars Laden vorbei. Er wollte gerade in sein rotes Auto steigen. Armaturenbrett und Sitze waren mit beigem Leder überzogen. Er trug einen dunklen Anzug und eine Krawatte und hielt eine große Bibel in der Hand. Als er uns sah, sagte er zu Mama: „Das Mädchen kann morgen um acht wieder anfangen.“
„Vielen Dank, Senhor Valdemar! “ entgegnete sie mit strahlendem Gesicht, und wir gingen weiter zu unserer Kirche.
Elvira Santos
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Nicolai Busch
Die unter Schutz Geflogenen
Wir sind gar nicht mehr da, aber auch noch nicht ganz tot. Nein, Moment, falsch, hier steht: Jemand habe bestätigt, wir seien nicht zu finden und daher mutmaßlich nicht mehr am Leben. Das ist ein Unterschied! Was? Nein, sagen Sie? Na, also hören Sie mal! Es ist doch etwas Anderes, ob man noch lebt oder von vornherein tot ist! Es ist doch nicht das Gleiche, wenn man flieht und dabei stirbt oder flieht und danach stirbt oder fliegt und mutmaßlich stirbt oder mutmaßlich lebt, wobei man ständig gesucht wird. Manche fliehen durchs Meer und sterben im Meer und werden weder gesucht noch gefunden im Meer und andere fliegen und sterben im Meer, aber eben nicht gleich, sondern erst, wenn wir sie wirklich nicht mehr finden im Meer. Ja, am Leben hängen wir natürlich alle, aber manche hängen vielleicht etwas mehr dran, an denen hängen wir vielleicht etwas mehr und in deren Suche hängen wir uns dann eben auch mehr rein. Also einen großen Fang der Gleichheit und Gerechtigkeit kann ich da jetzt eigentlich nicht erkennen, liebe Menschenfischer, die ihr entscheidet, wer herausgefischt wird und wer nicht. Und das obwohl sich im Tod doch sonst immer alle so einig sind. Aber der meeresgrundlegende Unterschied zwischen einem Toten und einem Toten liegt vielleicht einfach darin, dass man nach den Geflogenen sucht, während man die Geflohenen leider immer erst findet, wenn sie schon tot sind oder sie erst gar nicht finden will, weil man eben rein gar nichts an ihnen findet, nicht? Da sucht man ewig nach sich selbst und dann findet man doch immer nur den Andern, der dann aber meistens keinen Pass hat und sich nicht ausweisen kann und das obwohl er doch schon längst Vollwaise ist. Also für mich war das immer ganz verschieden zueinander, wenn auch recht ähnlich. Auf der einen Seite eben das Leben, das immer da ist, oder eben da, wo’s niemand bemerkt, auf der anderen Seite der Tod, der nur da ist, wenn wir es sagen oder, wenn wir ihn sehen wollen. Naja und dazwischen eben von Beidem ein bisschen, was wir Zeit nennen, solange wir sie haben. Manche haben gar keine und für andere vergeht sie eben wie im Flug, wenn man denn fliegt. Ganz anders im Boot, wo sie eben wie im Boot vergeht und plötzlich einfach stehen bleibt, während alle anderen sitzend sinken, ohne dass jemand den Sinkflug eingeleitet hätte, worüber man vielleicht mal in einem Sinktank, äh, ich meine in einem Thinktank, diskutieren könnte, damit sich nie irgendwas ändert. Ach, Sie denken gar nicht? Und geflogen sind Sie auch noch nie? Müssen Sie mal! Also beides, fliegen und denken. Aber am besten erst denken und dann fliegen. Oder erst fliegen und dann gar nicht mehr denken müssen. Probieren Sie’s mal! Letztlich ist es doch ein und dasselbe: Ganz viel Bewegung, die man macht, ohne sie selbst zu machen und Distanzen, die so klein werden, bis sie und Sie verschwinden. Ein echtes Ereignis, wenn auch keins stattfindet! Von A nach B und dazwischen: Nichts. Macht aber gar nichts, denn das vergeht schließlich auch. Erst ist man am Boden und dann hebt man ab und dann ist man manchmal am Boden zerstört. Oder im Meer. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Hereinspaziert, angeschnallt und los geht’s! Jeder Zug gewinnt, aber eben nicht jeder Flieger und erst recht kein Boot. Ich wähle ein A und möchte lösen: Anemone. Und der drei Jahre gesuchte chinesische Herr in der Business Class mit dem Weinglas in der Hand wählt danach ein B und löst sich auf: Buckelwal. Herzlichen Glückwunsch zum Trostpreis von zweihundert neununddreißig Komma null, null und ein paar Zerquetschten inklusive der größten Rettungsaktion in der Geschichte der Luftfahrt. Sie können sich den Preis irgendwo westlich von Australien abholen. Tatsächlich waren erst im April zweitausendfünfzehn vor Italien ganze achthundert im Jackpot und obwohl wir wissen, wo Italien liegt und wer da vor Italien liegt, hat die erstmal keiner geknackt. Also den Rekord hat erst einmal keiner geknackt, nicht mal versucht hat das am Anfang jemand, nicht mal gesucht hat die am Anfang jemand, aber gezahlt haben die trotzdem, ohne was zu gewinnen. Ganz nach dem Sprichwort: Kein Glück im Spiel und auch keins im Ableben und auch keins danach. Das ist schade, aber entschädigt wird eben nur, wenn man fliegt und dabei stirbt. Naja und jetzt fliegen halt andere drauf, anstatt beim Kentern drauf zu gehen. Und wer drauf fliegt, der kann sich immerhin geborgen fühlen, auch wenn er es vielleicht nie wird. Also von gleicher Liebe und Trauer für alle kann hier eigentlich keine Rede sein. Wenn jemand ersäuft, hat das ja überhaupt in den wenigsten Fällen mit Liebe zu tun und wie die Titanic sah dieses Schlepperboot vor Italien, wenn Sie mich fragen, nun eigentlich auch nicht aus, die Boeing dagegen schon eher. Und ich spreche hier nicht von der Zeitschrift, sondern von dem Film, wobei es mit der Ironie der Massenschicksale natürlich auch nicht allzu weit her ist. Zu welcher Masse Sie, werter Leser, jetzt genau gehören, lässt sich nur herausfinden, indem sie ertrinken und spätestens da hört die Satire dann eben auch schon wieder auf, nicht? Also bei aller Liebe, aber lustig kann man das nicht finden, wenn zwei oder achthundert sich weder suchen noch finden. Liebe Anna, ich schreibe diesen Brief, denn ich fühle mich seit langer Zeit schon nicht mehr gefunden und erst recht nicht geborgen bei Dir. Wie kommt es, dass sich unsere Frequenz ständig verschiebt? Ich frage mich, ob nicht ein Flug daran etwas ändern könnte. Unsere Liebe soll ein Großraumjet ohne Sauerstoffmangel und unsere Sehnsucht nacheinander wie ein Tauchroboter sein. Bitte unterschreibe hier für eine gemeinsame Zukunft in trockenen Tüchern oder hier, damit alles ins Wasser fällt. In Liebe, fest glaubend an unsere Allianz und hoffentlich bis zur Landung, dein Reiseversicherungsberater. Naja, bei irgendwem muss man ja mal landen und wer ein Leben lang sucht, wird wahrscheinlich keins finden in Peking und noch weniger im Mittelmeer. Aber suchen kann man ja mal, solang es sich rentiert. Nach Gründen und Antworten suchen können Sie ja mal, weshalb eine stabile Aktie minus zweihundert neununddreißig Toten plus tausendsiebenundvierzig Tage gleich fünfundsechzig Millionen ergibt und eine humanitäre Katastrophe minus achthundert gleich null Komma null. Für wen sich das am Ende rechnet, können Ihnen die Subtrahierten und deren Bootsgesellschaft jetzt leider nicht mehr sagen, da müssen Sie schon die Fluggesellschaft oder die gegründete Interessengesellschaft fragen, deren Interessen eben mehr interessieren als die der Afrikaner. Die müssten das auf dem Schirm haben, auch wenn der Flieger vom Radar schon längst verschwunden ist. Die müssten das unter dem Finanzschirm haben, der die Hinterbliebenen beschirmt und die Airline abschirmt, bevor man sie verstaatlicht. Wenn Sie heute noch anrufen, lieber Leser, erfahren Sie, ob auch Ihnen eins dieser Geldschirmchen zusteht. Profitieren Sie jetzt von unserer großen Crowdfunding-Aktion! Ob auch Ihre Crowd gefunded wird, erfahren Sie nach der Auszählung und Auserwählung der Auserwählten durch die Ungerechten in den Gerichten. Naja, manchmal greift die Police eben und manchmal kommt sie erst gar nicht. In Italien ist sie jedenfalls gar nicht erst gekommen. In Italien hätte man ein ungeahntes Comeback von achthundert Toten sicher nicht mit Musik gefeiert. Da können noch so viele ertrinken, einen Klassiker werden die nie landen. Dafür fehlt denen nämlich die Landeerlaubnis und erst recht die Bordkarten, die ja überhaupt immer als erstes über Bord gehen. Und was über Bord, also über die Reling, das ist weg, aus, vorbei, verschwunden, ganz sicher, aber eben längst nicht in Sicherheit. Wobei in Frankreich mal einer gesagt hat, dass überhaupt nichts wirklich verschwindet, auch wenn es schon längst nicht mehr da ist. Alles, was fort ist, infiltriert unser Leben in kleinen Dosen, die Sie übrigens heute noch sehen können, wenn Sie der Dosenfutterspur von Lampedusa nach Lybien folgen. Oh, danke für den Tipp, aber das ist mir dann, glaube ich, doch zu weit. Verzeihen Sie, aber ich kann hier im Westen das Böse nirgendwo entdecken, obwohl es doch irgendwo sein muss. Wo so viele gute Menschen sind, die sich miteinander gut fühlen und gemeinsam regelmäßig abheben, muss doch irgendwo das Böse sein. Könnten Sie mir vielleicht sagen, für wann das Sterben im Westen heute angesetzt ist? Ach, Sie sagen, das findet hier gar nicht mehr statt? Und wenn überhaupt, dann nur noch als Folge technischen oder menschlichen Versagens, das dann aber durch viel Geld kompensiert werden kann? Hör mal, Schatz, der Mann sagt, wir müssen den nächsten Terroranschlag abwarten oder in den Kongo oder nach Syrien, wenn wir das Böse erleben wollen. Schaust du mal bitte schnell, ob es noch Flüge gibt? Achtung, Achtung, meine lieben Damen und Herren, hier spricht jetzt ausnahmsweise Ihr Autor. Ich freue mich, dass Sie mir Ihr Vertrauen geschenkt haben und begrüße Sie recht herzlich im Text. Unter uns sehen Sie die endlosen Weiten des Kapitals, zu dem Sie hoffentlich selbst gehören. Wenn Sie jetzt mal ganz nach rechts schauen, sehen Sie das kleine Steuerparadies und dicht daneben, direkt unter den brennenden Turbinen, quasi außerhalb der Erzählung, ein gelbes Schlauchboot mit Tauchfunktion, von dem aus ich in diesem Moment, unter uneingeschränkter psychischer Gesundheit zu Ihnen spreche. Fakt ist, dass sich unter der Ladung unserer Maschine Lithiumbatterien befanden, die in den Frachtpapieren als entzündlich gekennzeichnet waren, was sich soeben bestätigt hat. Die Stimmung im Text ist aufgrund der Batterien derzeit etwas aufgeladen und da kann es eben leicht passieren, dass ich als Schreiber, wenn auch nicht als Flugschreiber, explodiere. Wenn Sie also bisher geglaubt haben, der Autor sei nicht zu belasten, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass es mir nach wie vor schwerfällt, ein Katastrophenszenario vorzustellen, das garkeinen Faktor menschlicher Intervention beinhaltet. Lieber Leser, gestatten, dieser Faktor bin ich und bin ich eben doch nicht. Wer oder was auch immer dieses Ich ist, mir ist es jedenfalls nicht bekannt. Sollte Ihnen durch diesen Text ganz bewusst etwas zustoßen, können Sie dagegen rechtlich leider gar nichts unternehmen. Ein Unternehmen, also zum Beispiel eine Fluggesellschaft, das juristische Dienstleistungen anbietet, wird sich Ihnen aber wohl trotzdem anbieten, solange Sie es zahlen können. Manchmal liest man etwas und stößt sich daran und trägt eine Beule davon. Die Lösung wäre also, entweder den Kopf einzuziehen oder sich an die Schmerzen zu gewöhnen. Wir sitzen nun einmal alle im selben Boot, wobei manche von Ihnen natürlich im Flieger sitzen und deshalb mehr Recht auf ein Grab abseits des Meeres haben als andere. Den Grund hierfür versucht dieser Text in diesen Momenten unter Hochdruck zu finden, wenn auch ohne Erfolg. Dabei kann es passieren, dass der Druck zwischen den Worten so groß wird, dass der Zweifel Funken sprüht und wir notfalls auf die Schlauchboote umsteigen müssen. Also von einem Druckabfall an Bord kann hier wirklich keine Rede sein. Überhaupt ist so ein Zweifel wie eine Tragfläche, die es ganz plötzlich mehr oder weniger dramatisch zerreißt, während man sich eigentlich noch getragen fühlt. Und trotzdem reisen und fliegen die meisten, anstatt im Wasser zu gründeln. Trotzdem fliegen die meisten und stecken den Kopf in die Luft, wo sie am dünnsten ist, nur damit man wo war, während man war und damit man mal da war ohne zu sein. Weil in Kuala Lumpur waren die Damen und Herren ja noch da, obwohl die in Peking später nicht mehr da waren. Also wenn Sie das Auftauchen eines Körpers in einem Video einer Kamera als Dasein definieren, das Aufblähen desselben im Wasser dagegen als sein Ende, waren die Gäste in Malaysia noch deutlich da, sind dann aber nach dem Auftauchen (weiß Neptun wo) vollständig abgetaucht. Alle zuletzt empfangenen Satellitensignale deuten auf einen steilen, ausgelassenen, aber kontrollierten Absturz der Fluggäste bis in die frühen Morgenstunden. Werter Leser, hier noch ein Tipp: Entschlüsseln Sie weiter eifrig die Signale, aber suchen Sie vorher nach den richtigen. Es ist in der Vergangenheit immer wieder zur Verdrehung von Fakten und Messwerten gekommen, auch im moralischen Bereich. Einfach wird es nicht werden, aber Sie können es ja mal ausprobieren. Entschuldigen Sie bitte, ich habe viel Geld für diesen Tauchkurs bezahlt und jetzt ist das Wasser ganz trüb. Wir sehen ja gar nichts, obwohl es doch hieß, die Sicht sei eindeutig. Wie soll man denn so etwas finden, wenn man nichts sieht? Was soll man denn suchen, wenn eh alles gleich ist? Wie soll man denn auffallen, wenn einem nie etwas auffällt? Naja, versuchen Sie’s halt wenigstens mal! Aber suchen Sie nicht zu lange. Ein ganzes Leben, das wäre nun wirklich zu lang. Davon haben wir hier sowieso schon viel zu viele. Aber drei Jahre, die geben wir Ihnen, wenn Sie denn fliegen statt fliehen, bevor wir Sie aufgeben.
Nicolai Busch
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
Respektlos entstellt und doch nicht zum Verschwinden gebracht wurden: Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen, ein bisschen Derrida, Baudrillard und ganz viel Wikipedia.
freiTEXT | Flamingo
Domažlice
ein traum von der bettlägrigkeit meiner mutter führt mich über hefeknödeln nach domazlice. fahrend: mein großvater mit rotem, großen kopf und schnapsporen auf seiner haut vom pokerspielen in den 1970er-jahren. im kassettenradio ist der böhmerwald und das land in dem die wiege stand und für diese kapelle mein anderer, cholerischer großvater eine kurze zeit gespielt hat. immer wieder fährt der große, runde opa in die tschechei, mit dem roten ford sierra und kauft hefeknödeln, schokooblaten und uhren. er schaut sich auf dem chinesenmarkt um und bringt von dort manchmal decken und plastikschoner für die autos seiner angehörigen. ich sitze vorne, oma muss hinten sitzen, denn ich bin das prinzchen und darf die kassette drehen. auf ernst mosch gleiten wir in den osten und an der grenze muss man halten, wo wir gefragt werden und mein opa mit seinem tschechischen nachnamen keine probleme hat, kurzfristig sogar stolz ist. doch wenn man ihn fragt, ob er ein tscheche sei, wird er ausfällig. ähnlich ausfällig wird er beim autofahren: ausgehauter hund, ausgehauter. dicke nudel, dicke. fette sau. im hotel krone in der ortsmitte von domazlice essen wir billiges schweinegulasch und braten mit hefeknödeln und ich kaufe süßes sirup in den läden und golatschen und weiche semmeln. es gibt andere zahnpasta als bei uns und kristallvasen, die den leuten dort gefallen. meine mutter ist bettlägrig zuhause, ich bin froh, dass ich laufen kann und bekomme eine weitere golatsche, die mich dickes kind noch dicker macht. ich darf nicht auf bordsteinen balancieren, mein opa hasst das und nennt mich: dummer esel, dummer. wenn jemand sagt, ich sei dick, droht ihm mein opa mit schlägen, sein kopf wird noch röter und er platzt fast auf. nur wenige jahre später sitzt er bei sehr großer hitze im stadtpark, fühlt sich seltsam und ist bald nicht mehr da. von der schule holt mich nun niemand mehr ab, jeden tag, und ich fahre viel seltener in die tschechei. nur noch mit meinem vater, der mich gängelt, der mich für ein dickes kind hält, für einen schwulen, kleinen versager und der mir zwar golatschen kauft, aber lieber eine kleine als drei große und in dessen auto ständig mike and the mechanics und peter maffay laufen und dessen weißer ford escort mit einem blauen, einem dunkelblauen und einem roten streifen laut bei 160 über die autobahn kracht, die schallmauer meiner kindheit im schwitzbauchweh erstickt, die eigentlich wissenschaftlich reisekrankheit genannt wird. zuhause liegt meine mutter, wenn sie nicht beim zahnarzt ist und gehasst wird, dann hat sie schmerzen. wenn ich keine angst vor der nacht habe, kann ich einschlafen. manchmal gehe ich noch dorthin wo mich mein opa von der schule abgeholt hat und warte und denke wir fahren in die tschechei zu den golatschen, wo sein nachname der dritthäufigste im land ist und er aber kein tscheche. mein zuhause, das ist die grenzkontrolle und das kurze stehen und warten und angsthaben ob nicht doch etwas passiert.
Flamingo
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at