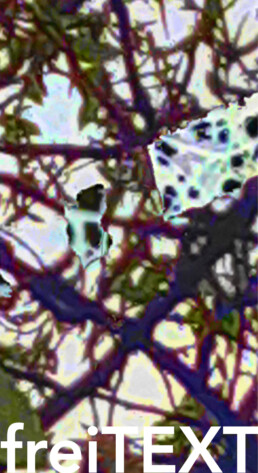freiTEXT | Moritz Pohl
Wieder ein Tag
Ich werde von der ins Schloss fallenden Wohnungstür geweckt. Die Sonne bohrt ihre Finger durch die Schlitze des Rollladens. Ich drehe mich zur Wand. Das Kissen liegt nicht richtig. Ich drücke es ein, bausche es auf, falte es zusammen, doch es bringt alles nichts, ich finde keine bequeme Position. Kein Wunder, nach all den Monaten.
Als ich mich aufrichte, schießt es mir in die Lendenwirbelsäule. Mein Körper schmerzt seit fünfundzwanzig Jahren. Mal ist es der Nacken, mal ist es die Schulter, mal sind es die Handgelenke, mal sind es die Knie. Irgendwas ist immer. Schmerz ist auch Präsenz. Schmerz ist Jetzt. Jedenfalls rede ich mir das mittlerweile ein. Ich steige in meine alte Jogginghose aus Fußballvereinstagen. Seit fünfundzwanzig Jahren besitze ich sie. Vielleicht ist sie der Grund für meine Schmerzen.
Ich gehe pinkeln. Auf dem Rückweg greife ich mir eine Wollmütze aus dem Bücherregal und ziehe sie an. Dann schlüpfe ich ein kariertes Flanellhemd. Ich sehe jetzt aus wie ein Bauer beim morgendlichen Abmelken. Fehlen nur noch die Gummistiefel.
Während ich auf den Wasserkocher warte, denke ich, dass ich nur ins Bett will, mich ausruhen, Kraft sammeln. Aber ich komme ja gerade erst aus dem Bett, das geht also nicht. Die Öle im Kaffee bilden hellbraune Bläschen.
Auf dem Laptop rufe ich Youtube auf. Ich klicke ein Video an, das die Frage abhandelt, wer einen Kampf gewinnen würde, ein Gorilla oder ein Grizzlybär. Anschließend google ich, ob ein Gorilla noch stärker werden könnte, wenn er Gewichte stemmen würde.
Beim zweiten Kaffee fällt mir ein, dass ich später einen Termin habe, sogar einen wichtigen. Ich muss zur Universitätspsychiatrie, um meine Krankschreibung verlängern zu lassen. Ich lasse mich wieder vom Algorithmus davontragen, tiefer und tiefer in eine Welt, die es nicht gibt. Und weil es sie nicht gibt, spendet sie Geborgenheit. Ich schaue mir die brutalsten Knockouts von einer Mixed-Martial-Arts-Ikone an, die aussieht wie eine grobschlächtige Version von Tom Selleck; ich schaue mir an, wie ein norwegischer Kletterer mit einem schwedischen Strongman seine Griffkraft vergleicht, indem die beiden unhandliche, schwere Dinge hochheben; ich schaue mir an, warum ein ehemaliger Nazi-Rocker denkt, dass ein ehemaliger Drogendealer ein Lügner ist; ich schaue mir an, ob ein Bodybuilder nach Ansicht eines anderen Bodybuilders in einer Mega-Off-Season mit zu viel Stoff seine Gesundheit zerstört hat.
Immer zeigt mir die Seitenleiste neue Videos an, immer gibt es neuen Content, der mir selbst niemals in den Sinn gekommen wäre und der mich reizt. Ich klicke auf alles, öffne immer weitere Videos in immer weiteren Browser-Fenstern zur Vorsorge, zum Spätergucken. Bald lasse ich die Videos mit anderthalbfacher Geschwindigkeit laufen.
Dann kommt ein harter Cut. Ich schalte den Laptop ab und mache mir ein Müsli mit Proteinmilch. Mit der frisch gefüllten Schüssel setze ich mich vor den Fernseher und schaue die Küchenschlacht. Moderator des Tages ist Alexander Kumptner, lese ich im Guide des Smart-TV nach, ein Österreicher mit modischer Kurzhaarfrisur und Astralkörper, wie ich auf Instagram sehe.
Während im Fernsehen die Lachsfilets in den Pfannen brutzeln und aufgeregte Normalos beflissen in ihren Töpfen rühren, bleibe ich in der Timeline hängen und schaue mir einen Inder an, der verkrüppelte Beine hat, aber einen Oberkörper wie Herkules. Er spricht schnell einige unverständliche Worte in die Kamera und verzieht dann sein Gesicht zu einer Fratze, während er seine Arme hochreißt und den Arni macht.
Ich swype herunter, ein animierter Shrimp saugt seinen eigenen Schwanz ein, kriecht aber sogleich wieder aus sich selbst heraus, eine in Endlosschleife ablaufende Illusion, die gut einhundertvierzigtausend Menschen gefallen hat und knapp zwanzigtausend Mal weitergeschickt wurde. Auf einer anderen Kachel singt Elvis Presley in ein Hörnchen mit Eisbällchen, wieder woanders klärt mich eine Illustration darüber auf, dass ich schon mein ganzes Leben lang falsch gehe.
Auf einem Comic-Bild ist ein grimmiger Wolf abgebildet, hinter seinen Rippen hängt Gedärmen gleich ein Lamm mit geschlossenen Augen. Dieses Lamm symbolisiert die Freundlichkeit, die wir alle wie einen Parasit in uns tragen, denn Freundlichkeit ist schlecht, weil sie uns schwächt. So steht es in der Bildunterschrift, und in den Kommentaren wird das Bild als Meisterwerk gefeiert und für seine Schönheit gelobt. Andere Kommentatoren sehen Palästina durch das Lamm symbolisiert.
Ich klicke den Handyscreen schwarz und widme mich wieder der Küchenschlacht, wo sich mittlerweile der Juror die einzelnen Bestandteile des Wettbewerbsgerichts einer Teilnehmerin in den Mund schiebt. Die Kamera zoomt drauf und ich sehe seinen Kiefer das Essen zerkauen. Es muss schon kalt sein, aber es schmeckt ihm vorzüglich, so sagt er, die Sauce vielleicht ein wenig dilllastig, aber das sei keine Kritik. Ich stelle die Müslischüssel auf die Spülmaschine und gehe scheißen. Es ist jetzt Viertel vor zwei und mir fällt nichts mehr ein. Ich beschließe, zur Psychiatrie zu laufen, um Zeit totzuschlagen.
***
Das alternative Areal am Flussufer ist noch im Winterschlaf, die Bretterbuden und Wellblechhütten sind vernagelt. Unten am Wasser steht ein dunkelhäutiger Typ auf dem Absatz der Ufermauer. Ich rieche seinen Joint und frage mich, was ihn wohl dorthin verschlagen hat. Je näher ich der Brücke komme, desto mehr schwillt der Lärm der Autobahn an, die auf der unteren Ebene des Bauwerks über den Fluss führt. Auf unserer Seite ist die Brücke nicht lärmschützend, denn wir wohnen bei der Industrie und den Asis.
Zwischen den Betonpfeilern der Brücke drücken sich ein paar Nachtjacken herum, nicht viele, es ist ja schließlich helllichter Tag. Naja, so helllicht, wie ein bewölkter Tag im Spätwinter sein kann. Zwei Kinder spielen am Basketballkorb, ihre Würfe sind linkisch und keiner trifft ins Metallnetz. Ein paar Meter weiter, kurz hinter der Brücke liegt ein Trainingspark. Obwohl es keine zehn Grad hat, trainieren dort zwei Männer mit nacktem Oberkörper. Sie machen artistische Übungen und ihre Muskeln zeichnen sich deutlich unter der Haut ab, zucken bei jeder Bewegung, alles sieht aus wie von Gott intendiert.
Als ich mich den Dealern nähere, die vor der Dusche für die Flussschwimmer stehen, nehme ich Haltung an. Ich schaue ihnen in die Augen und als sie leise „Shit“ flüstern, schüttle ich nur kaum merklich den Kopf. Schon sind sie hinter mir und ich meine, ihre verfolgenden Blicke zu spüren. Ich stelle mir vor, dass ich sie provoziert habe und sie mir jetzt nachgehen, um mir eine Eisenstange über den Kopf zu ziehen oder mir ein Messer in die Rippen zu rammen. Es kribbelt kurz im Nacken, dann bin ich sicher, dass sie stehen geblieben sind.
Da die Stadt so klein ist, treffe ich schon hundert Meter weiter nur noch auf Jogger in grellen Dresses, die sich dehnen, und auf Pärchen, die ihre Mittagspause im Freien verbringen. Das Grau der Brücke und unseres Viertels ist hier bereits unbekannt. Immerhin das Wasser des Flusses weiß um diese Farbe. Grau und rasch fließt es gen Norden, bis nach Rotterdam, wo es sich mit dem Salz mischen wird.
Bei der nächsten Brücke steige ich eine Wendeltreppe hoch und laufe über den sanften Bogen, dann, auf der anderen Seite, den Hügel hinauf bis zum alten Stadttor, wo ich mich links halte und auf eine garstige Ausfallstraße komme.
***
Auf den Fensterscheiben der Klinik sind Worte in bunten Lettern geschrieben. Es fehlt nicht viel, dann hätte der Eingangsbereich den Look von einem dieser modernen Kindergärten, wo die Kinder Namen haben, die ich nicht mal kenne. Aber vielleicht ist das auch alles gar nicht so weit voneinander weg, eine Psychiatrie und ein Kindergarten.
Vor dem Aufzug überlege ich, doch die Treppe zu nehmen, wegen der Kalorien und der Vermeidung von amerikanischer Faulheit, lasse es aber sein, denn von dem Marsch ist mir eh schon warm und ich spüre, dass meine Achseln durchgeschwitzt sind. Ich will meinen Körper nicht noch weiter auf Touren bringen, bevor ich gleich vor einer fremden Person sitze, die mich mustern wird.
Ich melde mich an und nehme Platz zwischen einer Handvoll Menschen mit versteinerten Gesichtern. Vor dem Fenster der Sprechstundenhilfen gerät ein glatzköpfiger Mann in Rage. Er erzählt von seinem Schicksal, irgendwas von Obdachlosigkeit und skandalösen Verhältnissen. Es klingt, als käme das von ganz weit drinnen, und weil das so ist, wird er von den Sprechstundenhilfen abgebügelt. Sie verweisen auf das anstehende Gespräch mit dem Arzt und schicken ihn zu uns, wo er den Blick durch die Runde schweifen lässt, auf den kleinsten Auslöser wartend, um seine Tirade fortzusetzen. Aber niemand interessiert sich für ihn und so nimmt der Mann schnaufend Platz auf einem der hellen Holzstühle, nun doch wieder auf sich selbst und seine Scheißlage zurückgeworfen, allein und hoffnungslos.
Es dauert lange, bis der jeweils Nächste an die Reihe kommt. Ich lasse mir für eins siebzig einen Kaffee aus der Maschine, ein seltsamer Betrag, der mich irgendwie stört. In einer älteren Ausgabe vom Spiegel lese ich einen dreizehn Seiten langen Artikel über eine Frau, die dachte, sie sei ein Mann. Doch ein paar Jahre nach der Geschlechtsangleichung hat sie festgestellt, dass anfangs alles doch korrekt gewesen war. Darum ist sie jetzt wieder eine Frau, nur eben eine mit einem sehr burschikosen Körper und einem künstlichen Penis. Sie macht unter anderem die Psychologen dafür verantwortlich, dass sie sich damals in jugendlicher Unwissenheit eingeredet hat, eine Transperson zu sein, und das zu lesen, erheitert mich, wo ich doch gerade in einer Psychiatrie sitze. Ich lege die Zeitschrift weg und ziehe mein Handy aus der Tasche. Ein Video mit zehn Millionen Aufrufen stellt mir den schnellsten Raucher der Welt vor und ich vergesse die Frau.
Als ich hereingebeten werde, muss ich mich erst einmal sammeln und mir klarmachen, dass es gerade ein ganz klein wenig um meine Existenz geht. Die Ärztin trägt eine babyblaue Gesichtsmaske, obwohl die Pandemie ja schon längst zu Spinnenweben im Hinterkopf geworden ist. Sie ruft im Computer meinen Fall auf und bitte mich dann, mein Anliegen zu schildern. Ich setze ihr die Sachlage auseinander, dass mich mein Arbeitgeber gefeuert, aber nicht freigestellt hat, und dass ich mich psychisch nicht mehr in der Lage sehe, noch bis zuletzt weiter für diese Firma zu arbeiten. Ich erzähle ihr davon, wie belastend die Arbeit schon vorher war, dass man mich jetzt ausgrenze, ja, mich mobbe, um mich loszuwerden und mein Gehalt einzusparen. Und während ich erzähle, denke ich, dass das alles gelogen ist, von mir frei erfunden, weil ich einfach nur keine Lust mehr habe, zur Arbeit zu gehen und ein fauler Taugenichts bin. Während dieser Gedanke weiter aufblinkt wie die Leuchtschrift im Fenster eines China-Imbisses, „OPEN“ … „OPEN“ …, gehe ich auf meine psychiatrisch-psychologische Vorgeschichte ein, auf die ganzen Berichte und sonstigen Unterlagen, die ich ja schon eingereicht hätte beim letzten Mal und die doch für sich sprechen würden, weil sie ja belegten, dass ich all die geschilderten Probleme schon lange vor der Kündigung hatte. Vor diesem Hintergrund sei es ja wohl klar, dass eine Kündigung, ein solcher Rauswurf mit Arschtritt zu einer Verschärfung meiner Lage und damit zu einer Verschlechterung meiner Gesundheit führte.
Die Ärztin hört mir geduldig zu. Als ich geendet habe, sagt sie, dass sie mich anders als ihre Kollegen, die mich zuvor beurteilt haben, nicht als krank einstufe, ich wirke zu aufgeräumt und nicht depressiv. Ich widerspreche ihr, doch merke selbst, dass sie gar nicht so falsch liegt. Wahrscheinlich wirke ich tatsächlich nicht depressiv, denn so fühle ich mich ja auch gar nicht. Aber krank fühle ich mich sehr wohl, zu krank jedenfalls, um einfach weiter zu funktionieren, zu krank, um mich in Meetings zu setzen und Tabellen zu pflegen, zu krank, um in jedem verdammten Kollegengespräch eine Rolle zu spielen und im Grunde ausschließlich Lügen von mir zu geben aus karrieretechnischen Gründen und aus sogenannter Höflichkeit.
Doch obwohl ich überzeugt davon bin, auf diese entscheidende Weise sehr wohl krank zu sein, oder sogar komplett untauglich für die zur Rede stehende Arbeit, weiß ich ad hoc nicht, wie ich ihr das alles klarmachen soll. Schlagartig wird mir bewusst, dass es das war − ich soll tatsächlich wieder zur Arbeit, zu diesen Arschlöchern, die mich belogen und ausgenutzt haben und die ich dafür und für noch viel mehr verachte. Und gehe ich nicht mehr hin, bleibe ich bei mir und meinen Gefühlen, wie es ja eigentlich allseits empfohlen wird, gerade von den Psychologen, dann werde ich noch einmal gefeuert, fristlos und selbstverschuldet dieses Mal, und damit bekomme ich dann kein Geld mehr, weder vom Arbeitgeber noch vom Arbeitsamt. Ich brauche aber Geld, denn jeder braucht Geld.
Um mein Schicksal vielleicht doch noch abzuwenden, starte ich einen zweiten Anlauf, versuche der Ärztin klarzumachen, dass ich wirklich, wirklich psychisch nicht in der Lage dazu bin, nur noch einen einzigen Tag bei dieser Firma zu verbringen. Aber sie bleibt hart und sagt, es tue ihr leid, sie könne mir nicht helfen. Da ist mir plötzlich alles egal und ich sage ihr laut in ihr maskiertes Gesicht, dass mich trotzdem nichts mehr zurück in dieses Büro bringt, niemals! Und während ich das ausspreche, weiß ich, dass es auch wahr ist. Ich werde dort nie wieder hingehen, Punkt!
Sie sagt, das sei meine Entscheidung, ich müsse natürlich dann mit den Konsequenzen leben. Und obwohl sie damit recht hat, will ich sie für diesen Hinweis ohrfeigen, denn in diesem Moment ist sie für mich nichts weiter als eine Systemhure, eine kleinliche, paternalistische, selbstgerechte Fotze, die von nichts eine Ahnung hat und mir nur weitere Steine in den Weg legt mit ihrer gottverdammten Korrektheit.
***
Ich verlasse die Psychiatrie mit einem sonderbaren Gefühl von Leichtigkeit. Bis ich meiner Freundin am Abend von der neuen Sachlage berichte, bin ich schwerelos. Für ein paar Stunden kann ich auf alles scheißen, auf die Gnaden der Psychiater, und auf die Gnaden des Arbeitsamtes, und auf die Gnaden meines Arbeitgebers sowieso. Alle können mich mal, ich bin ein freier Mann, solange ich meine Lage nicht weiterkommuniziere und sich lästige Fragen und Hinweise bezüglich der Zukunft einstellen, mit deren Eintreten ja immer zu rechnen ist.
Obwohl das Gespräch keine halbe Stunde gedauert hat, bin ich total erschöpft, darum muss ich jetzt schnell wieder Kraft finden. Und dafür gibt es nur einen Weg: Koffein und Kohlenhydrate, hauptsächlich Zucker, in rauen Mengen. Ich laufe Richtung Fluss, bis ich eine Bäckerei mit Sitzmöglichkeit finde, bestelle mir einen Kaffee, eine Brezel und ein Teilchen. Kaum sind Teller und Tasse leer, kommt kurz das totale Tief, so wie es immer kommt, wenn ich etwas esse. Und wie immer will ich nichts weiter als die Augen zu schließen und davonzudriften, will die Augen nie mehr öffnen, mich einfach nur fallenlassen und nie mehr zurückkommen. Aber wie immer drifte ich nirgendwohin, schon gar nicht für immer. Stattdessen zahle ich und laufe weiter, sodass die Prozesse meines Organismus, befeuert durch die Bewegung und den Sauerstoff in der Luft, wieder ordentlich anlaufen.
Ich bin nicht einmal drei Häuserblocks weit gekommen, da bin ich plötzlich energiegeladen und wach, viel wacher als am Morgen, und ich merke mit jedem Schritt, wie die Vorfreude darauf wächst, gleich mit brennenden Muskeln totes Gewicht zu bewegen, auch wenn das keiner von mir je verlangt hat.
***
Im Fitnessstudio ist niemand, nur die besenstieldünne Ein- und Aus-Check-Frau. Ich klappere meine Übungen ab und zwischen den Sätzen schlendere ich zwischen den Maschinen hindurch, zum Spiegel und zurück. Noch ein Schluck aus der mitgebrachten Plastikflasche, an der Getränkestation aufgefüllt mit uringelber Flüssigkeit, Geschmack Multivitamin, dann geht es weiter. Unter Ächzen ziehe und drücke ich weiß lackierte Hebel, alles ein himmelschreiendes Symbol für den Betrieb der Lebensmaschine, die genauso schwerfällig ins Leere läuft wie das alles hier. Mit jedem Hub nimmt meine Zucker- und Fatalismuseuphorie ab. Freiheit kostet. Sie kostet ein wenig Mut, ein wenig Konsequenz, ein bisschen mehr an Disziplin, vor allem aber kostet sie Geld. Der Preis der Freiheit ist im Wortsinne ein Preis. Damit mich alle Ämter und Institutionen ab sofort in Ruhe lassen, damit mich die Psychiater, das Arbeitsamt und mein Chef am Arsch lecken können, muss ich zahlen, und zwar mit meinem Erspartem. Ich überschlage meine Fixkosten. Das Geld wird schnell dahinschmelzen in diesem teuren Land. Die Freiheit, so teuer sie auch erkauft ist, sie hat bereits jetzt ein Verfallsdatum. Um dieses hinauszuzögern, muss ich ab sofort jede Ausgabe genau abwägen, dabei will meine Freundin doch ein Auto anschaffen und neue Möbel, damit wir endlich ein Leben führen, das unserem Alter und unserer Schicht entspricht. Und in den Sommerurlaub wollten wir auch. Das alles geht jetzt nicht mehr und das wird ihr gar nicht gefallen.
Nachdem ich fertig bin, gehe ich auf Zehenspitzen durch den Duschraum, in dem die Pfützen des Tages einen Ekelparkour gebildet haben. Und an der Decke hat sich schwarzer Schimmel breitgemacht, noch nicht dramatisch, aber eigentlich von einem Ausmaß, das Einschreiten nötig machen würde. Zwischen den Keimen und Sporen dusche ich heiß und trockne mich dann mit meinem rauen Mikrofasertuch ab, das ich hasse, weil es nicht über die Haut gleitet, sondern den Körper in einer störrischen, stockenden Art trocknet.
***
Ich schließe die schwere Holztür auf und gehe durch den Gang mit den Briefkästen in den Hinterhof. Der Geruch des Dönerladens, den wir unten im Erdgeschoss haben, schlägt mir entgegen. Auf der Terrasse vor der Ladenküche steht der Betreiber. Er wohnt im ersten Stock. Ich sage ihm hallo und frage ihn, wie es ihm geht, und wie immer sagt er: „Muss!“ und wie immer findet er das eine gewitzte Antwort. Und wie immer verstehe ich ihn gut, weil ich ja sehe, dass es für ihn tatsächlich immer nur muss mit dem Laden und den drei Kindern. Er fragt, wie es mir geht, ob ich viel Arbeit habe. Ich lüge ihn an und sage: „Ja, immer Arbeit!“ und er wiederholt: „Immer Arbeit, immer Arbeit!“ Er lacht mit herzlichem Galgenhumor und ich komme mir vor wie ein verschissener Simulant, aber schon auf der Treppe ist das Gefühl weg. Mir kommt seine Tochter entgegen, die kleine Elin, und ihr Bäuchlein ist noch runder geworden, scheint mir. Ihr lila T-Shirt mit der Giraffe spannt genauso wie ihre geblümten Leggins, und ich denke, dass sie bestimmt immer nur Döner isst, weil die Eltern ja keine Zeit haben, was Richtiges zu kochen.
Ich bin noch vor meiner Freundin zu Hause. Der Mixer kreischt ohrenbetäubend, als ich mir einen Proteindrink mit Bananen und Kreatin zubereite. Gerade als ich den Deckel abschraube, kommt sie, und das Erste, was sie sagt, ist, dass die Küche aussieht wie Sau. Ich sehe mich um und sie hat Recht, und ich verstehe ihren Ärger, in den sie sich sogleich weiter hineinredet, von wegen, ich habe doch den ganzen Tag Zeit. Ich finde ihn dann mit einem Schlag übertrieben, diesen Ärger, und belle zurück, sodass wir uns streiten, noch bevor sie abgelegt hat. Ich verziehe mich ins Wohnzimmer und schlürfe den Bananenshake vor dem Fernseher.
Sie kommt dazu und ich sehe sofort, dass ihr Ärger nicht abgeklungen ist. Im Gegenteil, sie fragt in einem Tonfall nach dem Abendessen, der schon klarmacht, dass sie weiß, dass ich nichts eingekauft und demnach auch nichts gekocht habe. Da es noch keine sieben ist, sehe ich das nicht als Problem an, und genau das sage ich ihr, aber sie ist nicht meiner Meinung und ich muss mir eine weitere Tirade über geregelte Mahlzeiten und ihre Verdauung anhören. Und wie als Gegenschlag, obwohl das unsinnig ist, erzähle ich ihr, dass ich nicht mehr krankgeschrieben bin und zurück zur Arbeit soll, was ich aber nicht tun werde. Sie ist kurz wie vom Donner gerührt und erfasst meine Worte nicht gleich, dann fragt sie nach und ich erörtere ihr die Situation genauer mit all ihren Folgen. Eine Weile ist sie still, dann rastet sie aus, nicht, weil ich ab sofort die Arbeit verweigern will, sondern, weil ich überhaupt gefeuert wurde, weil ich bisher bei jeder Stelle Probleme gemacht habe, ja, letztlich, weil ich so bin, wie ich bin.
Ich lasse sie all das sagen, bleibe einfach sitzen und trinke den Bananenshake, und als ihr auffällt, dass ich nicht reagiere, bricht sie in Tränen aus und wimmert „Ich kann nicht mehr, ich will mich trennen!“
Ich stehe auf und nehme sie in den Arm, komme ins Schwadronieren darüber, warum alles halb so wild ist und warum ich für nichts etwas kann, weil das System und so weiter, und irgendwann beruhigt sie sich, auch wenn ich nicht glaube, dass es wegen meiner Worte ist. Zur Aufmunterung und auch weil es jetzt wirklich langsam etwas spät fürs Einkaufen und Kochen ist, hole ich beim jugoslawischen Restaurant gegenüber Hamburger mit Pommes, denn die hat sie gerne.
Vor dem Fernseher essen wir die Burger, die eigentlich viel zu salzig sind und mit all der Sauce und den aufgeweichten Salatblättern im Grunde auch überhaupt nicht gut schmecken, was wir aber jedes Mal wieder vergessen. Wir reden wenig.
Als in der Serie, die wir schauen, jemand ein Bier bestellt, bekomme auch ich Lust auf Alkohol und kündige an, mir heute mal einen Drink zu machen, so als wäre das eine völlig spontane Idee, etwas, was ich mir heute ausnahmsweise mal gönne.
In der Küche betrachte ich das Sortiment Flaschen, das ich in den letzten Monaten zusammengekauft habe, es sind mittlerweile so viele, dass meine Freundin um die Stabilität des Regals besorgt ist. Und um mich natürlich. Ich überlege, ob das mit dem Drink wirklich eine gute Idee ist. Die Ärztin hat gesagt, es sei am wichtigsten, nicht jeden Tag zu trinken, und wenn es nur kleine Mengen sind, sondern immer mal ein, zwei Tage Pause zu machen. Ich bin mir sicher, dass ich vorgestern nichts getrunken habe, und ich freue mich, denn damit ist ja alles in Ordnung. Ich greife zum Four Roses, denn heute muss es nichts Besonderes sein, einfach ein Old Fashioned mit zwei Spritzern Angostura und anderthalb CL Zuckersirup, ein einfacher Drink für normale Tage.
Ich rühre den Whiskey dünner und kehre ins Wohnzimmer zurück, betont beschwingt, so als könnte ich die Stimmung einfach wegfedern. Sie wirft nur einen schnellen Blick auf mein Glas und spart sich den Kommentar für gleich auf, wenn ich mir den zweiten mixen werde.
***
Gegen elf geht sie sich bettfertig machen und ich bleibe sitzen, da ich weiß, dass die Müdigkeit noch lange nicht kommen wird. Bevor sie sich ins Schlafzimmer verabschiedet, nimmt sie mir noch ein paar Versprechungen ab, denn es müsse sich jetzt wirklich etwas ändern, und wie immer bin ich ganz Ohr und stimme allem zu.
Dann bin ich allein mit der Nacht und schaue eine Polit-Talkshow. Die Leute auf den Stühlen ernsthaft und ungebrochen reden zu hören, zu sehen, wie sie ganz diejenigen sind, die sie sind, jeder einzelne ein bestimmtes Individuum mit gefestigten Ansichten und Werten, macht mich fassungslos, denn ich selbst kann mir nicht vorstellen, auf so einem Stuhl zu sitzen und als bestimmter Mensch eine bestimmte Meinung zu haben.
Es wird erst eins und dann zwei und drei, und die Müdigkeit kommt nicht, zumindest nicht diejenige, die man Bettschwere nennt. Mein Kopf ist müde, aber das ist er immer, das ist ganz egal. Der Körper, die Nerven, sie müssen müde werden, und das ist das Problem.
Als ich es nicht mehr aushalte, allein in der Nacht zu sitzen, ohne Trost spendenden Ort für meine Gedanken, alles immer nur Vergangenheit und nie Zukunft, gehe ich leise ins Schlafzimmer und lege mich neben sie, doch auch hier kommt die Müdigkeit nicht. Als sie doch kommt und ich endlich wegdämmere, bekomme ich Harndrang und muss wieder aufstehen. Und danach ist sie wieder weg, die Müdigkeit, und ich schlafe erst gegen fünf richtig ein, wie so oft. Wieder ein Tag.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at