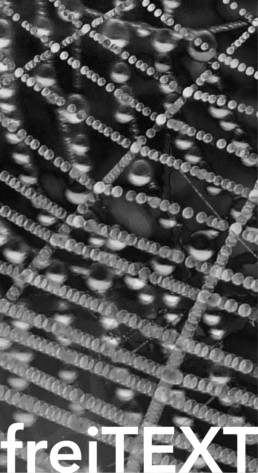mosaik39 - Kann mal jemand ein Foto machen?
mosaik39 - kann mal jemand ein Foto machen?
Frühling 2022
.
INTRO
Crunch Time kennen wir als Ausdruck seit kurzem, kennen wir als Gefühl scheinbar ewig. Irgendjemand hat mal gesagt, Erwachsensein heißt, jede Woche zu sagen: „Diese Woche ist stressig, aber nächste wird’s besser.“ Und so verkörpern wir – oder sagen wir sicherheitshalber: viele von uns – dieses Zerrbild von scheinbar Erwachsenen.
„Beim Schreiben trödle ich durch die Sprache. Ich nenne das nicht Arbeit und habe keine Projekte. Ich grabe und klopfe ein bisschen. Ohnehin ist alles second hand, also unter der Hand erworben. Ich habe mir das hier so zurechtgetrödelt.“ – Christian Leroy (S. 33).
Umso schöner, dass uns einige Texte in dieser Ausgabe wieder an die Langsamkeit erinnern. An die Gemächlichkeit, die Achtsamkeit – und daran, dass Lyrik gerne ineffizient ist, wie die Gedichtmaschine von Martin Dragosits zeigt (S.14):
„sie hudelt nicht
raunzt gerade so laut
dass wir sie nicht verstehen
oder ihre Geräusche
für liebenswürdig halten
[…]
öffnet sich
spuckt Worte aus
manchmal ganze Sätze
Und wir müssen schauen
was wir damit machen“
Das mosaik spuckt viele Worte aus, manchmal ganze Sätze. Und wir laden euch ein, zu flanieren, zu trödeln, zu entdecken. Vielleicht treffen wir einander auf dem Weg – und dann sagt womöglich wer zum Spaß: Kann mal jemand ein Foto machen?
euer mosaik
Inhalt
Versteckspiele
Res Sigusch – New York
Carmen Jaud – wer verlangt von den blättern
Bülent Kacan – Ach, Mensch, Aleph
Martin Dragosits – Die Gedichtmaschine I + II
Suchscheinwerfer
Sarah von Lüttichau – was wir nicht sagten
Jürgen de Bassmann – Dieses Haus gehört mir nicht
Martin Peichl – Was ist ein Gespenst
Lukas Arndt – Oslo-Bergen-Line
Isabella Feimer – hold data hostage
Lichtkanten
Tom Riebe – posse & protest
Tanja Gruber – Die Tyrannin
Nasima Razizadeh – Geheimzahl
Stephanie Mehnert – kalben
Christian Leroy – Zwecklos
Kunststrecke von Janina Kepczynski
BABEL – Übersetzungen
Die in BABEL versammelten Gedichte erzählen von Tod und Gewalt, von Verbrechen und Verlust, von Wut und Verzweiflung – in einer gleichwohl melancholischen Sprache der Erinnerung. Gerade in Tagen, in denen wir mit diesen Themen medial fortwährend konfrontiert sind, wo wir um Worte für das unausgesetzte Grauen des Krieges ringen, darf sich die Literatur und deren Lektüre solcher Erfahrung nicht verschließen.
Luis Varela – Lautaro / Lautaro (Spanisch)
Luis Varela – Flores frescas / Frische Blumen
Karl Parkinson – All The Swings Are Gone / Alle Schaukeln sind verschwunden (irisches Englisch)
[foejәtõ]
Don’t judge a book by its cover. Oder doch?
Sarah Oswald, Mitherausgeberin, Grafikdesignerin und Illustratorin des mosaik seit Stunde Null ist nicht die Einzige, die weiß, dass das innere und äußere Erscheinungsbild von Druckwerken wesentlich zum Genuss beiträgt. Darum haben wir zahlreiche Illustrator*innen, Gestalter*innen und Bücher-Macher*innen eingeladen, uns deren Zugang zum Gestalten von Literatur mitzuteilen – ein Schwerpunkt, dem wir schon sehr lange in der Zeitschrift Raum geben wollten!
Kreativraum mit Alexander Estis
.
.
>> Infos, Leseprobe und Bestellen
freiTEXT | Julia Knaß
Uns Gespenster (Ein Spiegelspiel)
(1)
Vielleicht hatte es etwas mit dem Wasser zu tun und dass ich nach Sternen tauchen wollte, im Fischteich. Sie war am Ufer gesessen, und hatte andere Wörter geformt. Ich dachte, wenn ich das wirklich will, dann hat der Laich Zacken. Meine Beine voller Schlamm, im Hintergrund der Wald und der Berghof. Und zwischen den Grashalmen hat etwas geraschelt. Hörst du es, hat sie geflüstert und mich erwartungsvoll angesehen.
Das Rascheln war kein Geräusch der Wiese, es kam aus einem anderen Leben, wurde immer lauter, bis es uns die Welt abschnitt, wir rannten vor ihm davon, dann, ich verlor Wassertropfen, sie einige Wörter, es hat beides verschlungen, ich weiß das, ohne dass ich hingesehen hätte.
In mein Tagebuch schrieb ich am Abend, das hätte nicht passieren dürfen. Was sie schrieb, weiß ich nicht, aber ich stelle mir vor, das hätte nicht passieren dürfen. Ich stelle mir vor, sie schrieb es mit meinen Tropfen so wie ich ihre Wörter verwendete. Danach haben wir nicht mehr darüber geredet. Ich habe einige Sterne gemalt und daruntergeschrieben: Froschlaich mit Zacken.
(2)
Vielleicht hatte es etwas mit Herkunft zu tun und dass sie nach Meeresrauschen im Wald Ausschau hielt. Sie hatte einen Stift und meinte, sie könne die Bäume damit umschreiben. Sie dachte, wenn sie das wirklich will, dann würde Sand aus den Ästen rieseln. Wir gingen durch eine Wüste zurück zum Hof und verwischten unsere Spuren selbst
An dem Abend hat niemand von uns etwas geschrieben, aber das Geräusch war zurückgekommen. Ich flüsterte, hörst du es, und sie nickte und verlor ihren Kopf dabei. Da wusste ich, dass ich nicht mehr davonlaufen konnte, vor ihm. Also stand ich auf und hielt meinen Kopf fest, während ich auf das Fenster zuging.
Aber als ich den Vorhang beiseiteschob, war da nur eine Wand. Ich habe geflüstert, es ist nichts, es ist wirklich nichts, und ihren Kopf vom Boden aufgehoben. Ich flüstere das noch immer, wenn ich abends allein im Bett liege, es ist nichts, es ist wirklich nichts mehr, es ist niemand. Und jedes zweite Mal glaube ich mir, dass es stimmt.
.
.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Knaß
Vergessene Orte
„Auf uns, hatte man ja vergessen, abgelegt, unser Tal, keine ordentlichen Straßen, hin, auf uns, da hat keiner geschaut, war allen egal, was mit uns passiert, wir waren ja nicht wichtig, früher, nichts haben wir gehabt, das können Sie sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, da bleibt die Jugend dann nicht, wenn es keine Arbeit gibt, auf uns, haben sie vergessen und dann ist er gekommen, da hat sich dann was geändert, da wurde dann endlich was für uns getan. Da hatten wir dann jemand, ihn, der auch auf uns gedacht hat, das darf man nicht vergessen, das muss man auch verstehen, dass das nicht alles so einfach war. So wie sie ihn jetzt schlecht reden, dass stimmt ja so alles nicht, das muss man doch auch sehen, dass er jemand war, der auf uns gedacht hat, das darf man wirklich nicht vergessen, das nicht“, aber sonst, ja, sonst soll man die Vergangenheit ruhen lassen, so sagt diese Talbewohnerin, die sich mit ihrer Wehklage an das Dirndl in dieser Geschichte wendet, also an unser Dirndl. Sie sagt ihm auch, unser Dirndl sei noch viel zu jung, um das zu verstehen, die ganze Geschichte. Aber nicht nur die Talbewohnerin, nein, wirklich alle in diesem Land sagen, dass man das jetzt endlich alles vergessen solle. Wollen selbst nicht vergessen werden, ja, aber die Vergangenheit, die soll man doch bitte in Frieden ruhen lassen, nicht? Die hat doch schon genug mitgemacht, die muss man doch jetzt nicht immer und immer wieder ausgraben. Aber wo, wo ruht sie denn, die Vergangenheit? Ja, wo haben wir sie denn, begraben? Wir wissen es doch eigentlich alle ganz genau, wo, alle wissen wir es ganz genau, weil wir jeden Tag darüber gehen, jeden Tag von neuem über die Leiche. Aber wir versuchen, das zu vergessen, versuchen, uns genauso zu vergessen, so wie die Orte vergessen sind, die Orte, die wir unsere Herkunft, unsere Heimat, unsere Ursache nennen müssen.
„Wo hat es dich hinverschlagen?“,
schreibt der Thomas dem Dirndl und es antwortet: „It’s kind of a funny story“, obwohl es das nicht ist und „in deine Heimat“, obwohl sie das für ihn ja doch nicht ist. Es ist jetzt dort, wo man noch immer mit Stolz darüber singt, wie man damals mit Blut die Grenze schrieb und er glaubt dem Dirndl zuerst nicht, weil er es dann doch so gut kennt und weiß, dass das nicht so vorgesehen war, nicht der Plan vom Dirndl: seine Heimat. „Was machst denn in Kärnten? Was machst du denn?“ und es erzählt ihm, dass es nicht so einfach war, nach dem Studium einen fixen Job zu finden und dass es sich einfach überall beworben hätte und so wäre es hier gelandet.
Früher oder später müssen wir darüber reden, warum das Dirndl ihm wieder geschrieben hat und über das Verhältnis der beiden zueinander. Tatsächlich ist es so, dass es hin und wieder an ihn gedacht hat und dass es dann wissen wollte, ob er das auch noch tut: an es denken. Das weiß es nun, weil er dem Dirndl nicht nur geantwortet hat, nein, er hat ihm sofort geantwortet und er hat es auch sofort gefragt, ob sie sich wiedersehen können, weil er zufällig bald in seine Heimat fahren würde. Das freut das Dirndl und es versucht, die Spinnweben und die Weberknechte aus seiner Wohnung zu entfernen, weil die sich ausbreiten, alles einnehmen, sobald es mal nicht hinschaut. Sonst versucht es nicht einmal mehr, dagegen anzukommen, gegen die klebrig gespannten Fäden, gegen den Staub, gegen den Dreck.
Hier bleibt nichts
unbemerkt. Als der Thomas mit seinem Wagen die Auffahrt hochfährt, kann unser Dirndl beobachten, wie sich die Vorhänge der Nachbarin bewegen, gleich wie sich die Vorhänge bewegen, wenn es in der Früh zur Arbeit fährt, wenn es am Abend von der Arbeit nach Hause kommt, wenn es im Winter Schnee schaufelt. Keinen Schritt kann es hier setzen, ohne dass es jemand weiß. Für unser Dirndl geht es ja noch, es ist nur aus einem fremden Bundesland gekommen. Es wird nur mit Blicken verfolgt, das wird es wohl aushalten, unser Dirndl. Anders ist es, wenn man aus einem fremden Land kommt, dann bleibt kein Schritt undokumentiert, mit Fotos, mit Videos, mit Postings im Internet: „Haben’s das gesehen, jetzt war schon wieder die Rettung bei der Unterkunft“ – „Haben’s das gehört, die sollen junge Frauen angegriffen haben“ – „Das sind ja alles Kriminelle, die sie da ins Land gelassen haben, die sollten besser in ihren Heimatländern im Osten bleiben, wo genug Platz ist, aber das versteht das linke Gsindel in Wien ja nicht, dass man da was dagegen tun muss, als guter Bürger, als Österreicher. Die passen nicht in unsere Kulturlandschaft, die Flüchtlinge.“ – „Die Wölfe, die passen nicht in unsere Kulturlandschaft. Da muss man ja was tun, als guter Jäger, als Österreicher. Aber das verstehen die Gutmenschen in Wien ja nicht, dass man da was dagegen tun muss, das sind wilde Raubtiere, die sie da ins Land gelassen haben, die sollten besser in ihren Heimatländern im Osten bleiben, wo sie genügend Platz haben.“ – „Haben’s das gehört, die sollen junge Kälber auf der Alm angegriffen haben“ – „Haben’s das gelesen, jetzt war schon wieder ein Wolfsriss in dem Wald“. Wenn man von einem fremden Land kommt, dann wird jeder Schritt verurteilt, nichts bleibt hier, nicht? Auch der Thomas ist nicht geblieben, er hat es nicht ausgehalten, deswegen ist er nach Wien gegangen.
Sie haben nicht darüber gesprochen, wie lange er bleiben kann, aber er hat seine Tasche mit und später, als sie sich hinlegen, schaut er einen Film, während es einschläft, genauso als hätten sie einen gemeinsamen Alltag. Und am nächsten Tag richtet es das Frühstück am Balkon, weil es warm genug ist. Der Thomas fragt das Dirndl, wie es das aushält, weil er könnte das nicht mehr. Und es meint, naja, es ginge schon. Unser Dirndl weiß schon, es müsste viel stärker widersprechen, wenn die Leute hier sagen, dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen sollten oder wenn sie witzeln, dass man nach #metoo ja nichts mehr sagen dürfe und dann einen sexistischen Schmäh nach dem anderen reißen. Am Anfang, da hatte es noch dagegengehalten und erklärt und dagegengehalten und erklärt. Aber seit es hier ist, verändert sich die Sprache schleichend, vergessene Wörter fluten vermehrt zurück in die Köpfe. Darin ertrinkenden Gehirnen ist es wieder möglich, laut zu sagen: „Meine Wohnung will ich aber nur an Inländer vermieten“, weil es ist ja auch möglich, laut zu sagen, dass man geflüchtete Menschen konzentriert halten wolle, nicht? Weil „dass ist ja schon so lange her, das hat ja nichts damit zu tun, da denkt doch keiner mehr dran, an diese Zeit, das haben doch schon alle vergessen, da wird man gewisse Wörter doch schon wieder sagen dürfen.“ Und geflüchtete Menschen, die werden schon nach wie vor untergebracht, aber am liebsten weit weg von den Ortskernen, abgelegen, sind ja gut um die sinkenden Bevölkerungszahlen aufzubessern, aber sichtbar wolle man sie nicht haben, vergessen wolle man, dass die da sind. Unser Dirndl hat längst damit aufgehört, den Mund aufzumachen, weil es zu mühsam ist, weil es ja doch nichts bringt, weil es dem Dirndl schon lange nur mehr ums eigene Überleben geht. „Manchmal hoffe ich, dass ich eines Tages laut schreien werde“, sagt es. Aber wir wissen alle, dass unser Dirndl keine Stimme hat dafür. Das Dirndl ist einfach keine Kämpferin, das Dirndl will das alle es mögen, das Dirndl ist schwach und ruhig und nett. Das Dirndl ist ja ein liebes Mäderl, „das viel zu gut ist für die Welt“. Immer will es allen gefallen, unser Dirndl, deswegen lässt es sich auch alles gefallen.
Er schaut in die Sonne,
während er unserem Dirndl zuhört, und dann fragt er es: „Was können wir tun, damit du nach Wien kommst, Lisa?“ Weil er weiß schon, dass das auch der Plan vom Dirndl war: seine Stadt. Und wir wissen noch immer nicht viel über ihr Verhältnis zueinander, aber wir wissen, dass er vorher zum Dirndl gesagt hat, „wenn du in Wien wärst, könnten wir jeden Tag miteinander verbringen, meine Liebe“, und wir wissen, dass das viel bedeutet. Unser Dirndl stellt sich diese Welt vor, in der es bei ihm ist, sieht sich mit ihm gemeinsam zur U-Bahn rennen und das Dirndl muss lächeln, weil es so schön wäre. Zugleich wissen wir, weiß es, das wird nicht geschehen, nur er weiß es in diesem Moment nicht und er weiß auch noch nicht, dass er es vergessen wird, so wie er seine Heimat vergessen will. Unser Dirndl wird so zum Vergessen sein, wie es diese Orte hier schon sind. Es gehört hier vielleicht nicht hin, aber es gehört eben auch nicht in seine Stadt, weil es eben nicht gehört und nicht gehört wird.
Auch Sie, geschätzte Lesende,
werden unser Dirndl wieder vergessen, Sie werden vergessen, dass Sie je von ihm wussten, Sie werden vergessen, weil es ja „zum Vergessen ist“ werden Sie sich sagen, „es ist zum Vergessen“. Hin und wieder werden sie ans Vergessen erinnert, weil es in Österreich ja zum guten Ton gehört, dass Journalistinnen und Autoren und Journalisten und Autorinnen in regelmäßigen Abständen in die Peripherie fahren, mit dem Auftrag, sie wollen verstehen, mit dem Auftrag, das müsse man zeigen, wie schlimm das alles noch immer sei, sonst könne man es ja nicht verändern. „So schlimm ist das, unfassbar ist das, wie das 2019 noch immer möglich sein kann“. demographische Abwanderung, Alkohol, Rechtsruck, Alkohol, Hass auf Ausländer, Alkohol, Leerstände, Alkohol, Volksfeste, und dann schreiben sie vielleicht eine Reportage, nicht? Über vergessene Dörfer und Städte, am besten über einen Ort mit einem sehr, sehr rechten Bürgermeister, einem Nazi, nicht? Oder über ein Dorf, an dem es die meisten Rechtswähler, also sehr viele Nazis auf einem Haufen, in Österreich, dem Naziland, gibt, nicht? Dann erscheinen diese Reportagen, anschaulich bebildert, in Hochglanzmagazinen und die Leute, die sich von den Dörfern, also den Nazihorten, entfernt haben, können das lesen und sich moralisch erhaben fühlen, über die ganzen Nazis, und der Journalist oder die Journalistin bekommt einen hübschen Preis dafür verliehen, für diese detailgetreue Beschreibung der Nazis, für diese authentische Schilderung der Nazis, weil da muss man ja mal ganz genau hinschauen, auf die Nazis, nicht? Genauso zum guten Ton gehören Romane, in denen man sein Herkunftsland, also das Naziland, basht, in denen man ganz subtil Keller, am besten Nazikeller, einflechtet in die Geschichte. Und Nazis, Nazis, Nazis, Nazis und die katholische Kirche, also die Nazikirche, vergleicht. Man muss THOMAS BERNHARD IN A NUTSHELL sein, man muss die beste Bernhard-Imitation ever abliefern, in Österreich, dem Nazireich, man muss auf Nazi-Österreich herabsehen, man muss Nazi-Österreich verachten, und dann bekommt man auch dafür vielleicht einen feschen Preis verliehen, am besten den GROSSEN nazi-österreichischen Staatspreis, nicht? Weil staatliche Preise und Förderungen nimmt man dann schon trotzdem an, ja, man sagt sich, man leistet ja was für Österreich, das Nazireich, und für die österreichische Kultur, die Nazikultur. Man sagt sich, man trägt ja zur Bildung der Nazis bei, man trägt ja dazu bei, dass die Leute, also die Nazis, nicht aufs Vergessen vergessen. Man sei ein Bildungsträger, und dadurch ändert sich vielleicht ja was, wenn man die Bildung nur oft genug trägt, wenn man Bildung nur immer weiter anhäuft, solange bis die Leute, also die Nazis, darunter begraben sind. Da hat die Literatur dann plötzlich großen Einfluss auf die Wirklichkeit, wenn’s grad ins Konzept passt, nicht? Aber was die Beschreibung von Frauen und Beziehungen angeht, na, da schreibt der österreichische Autor dann doch lieber sexistisch und a bisserl übergriffig, weil wissen’s eh, alles andere, über moderne Beziehungskonzepte, über einvernehmlichen Sex, das wollen Sie, verehrte Leser, wollen die Leute, also die Nazis, ja net lesen. und ist doch gut, ist doch gut, wenn’s da dann drüber lachen können, wenn Mann Frauen wie Dinge benutzt, ist ja nur ein Text, ist ja nur ein Text, das hat ja nichts mit der Realität zu tun, das hat ja keinerlei, nicht die geringsten Auswirkungen auf die Wirklichkeit, nicht?
Wir sollten nie vergessen,
dass wir für Geld alles tun würden, ich, du, wir, jeder einzelne in diesem Land. Wir sollten nie vergessen, dass wir für Geld alles schreiben würden, ich, du, wir, jeder einzelne in diesem Land. Wir sollten nie vergessen, aber vergessen ist das Einzige, was wir gelernt, das Einzige, was wir wollen.
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
freiTEXT | Julia Knaß
In Tagen wie Wahnsinn
in tagen wie wahnsinn liegen die toten am gang, ob ich die toten am gang sehen würde, wer die toten am gang denn seien, wer da schießen würde, wer da denn schießen würde, aber da sind längst keine toten mehr am gang, am gang hängen nur kinderfotos von mir und meinen schwestern und das hochzeitsfoto meiner eltern, am gang frisst die katze, am gang stehen die schuhe und der wlan-router und das telefon, aber da sind keine toten am gang, sage ich zu ihm, ich sage, er habe nur geträumt, das sei nur ein traum, das mit den toten, aber er beharrt darauf, er beharrt auf den toten, nach 100.000 bier und einem hausbau, einer karriere bei der gendarmerie, „herr inspektor!“, nach drei kindern und detaillierten fotografien in geordneten alben und noch akribischerem briefmarkensammeln, nach der produktion von honig, immer mehr honig, nach der beerdigung von seinem einzigen sohn, nach der leitung des ÖKB, nach dem zusammenbauen von puzzlespielen mit mehreren 10.000 teilen, ist da wirklich alles, was bleibt, die toten am gang, die toten am gang, die toten am gang, aber dann schläft er wieder ein und ich falle über alle leichen
in tagen wie wahnsinn zitieren wir gemeinsam mephistos faust „ich bin der geist der stets verneint“, über einem glas bier verneinen wir uns voreinander, sonst dürften wir uns nicht annähern, aber gemeinsam mephisto zitieren ist unser klopstock und später holt er mich mit dem motorrad ab und wir kurven durch die gegend, meine heimat, die ich nicht kennen will, und das plastik an meinen docmartins verschmort und meine füße werden heiß, während er mich hundert mal fragt, was ich von ihm wolle, wie ich mir das vorstelle, dass er mit jemanden wie mir nicht reden könne, dass er mit jemanden wie mir normalerweise gar nicht reden würde, dass ich mit jemanden wie ihm nicht reden dürfte, weiß ich auch, aber er isst schweinsbraten wie mein opa und er ist beim ÖKB wie mein opa und er vertritt ansichten wie mein opa, aber mit ihm kann ich streiten, ihm kann ich alles an den kopf werfen, ich sage ihm, dass es falsch ist, was er denkt, ich sage ihm, dass alles gefährlich ist, was er denkt, ich erkläre und rede und erkläre und rede, damit er endlich aufhören kann, weil „cui bono“ nützt niemanden, ich erkläre und rede und erkläre und rede, damit er endlich aufhört zu denken, ziehe ich mich aus
in tagen wie wahnsinn erzählt mir meine oma vom schafe hüten, von der theatergruppe, die sie in ihrer jugend geleitet hat, von den gelungenen aufführungen und wie schwierig es war, dafür alles zu organisieren, sie erzählt mir, dass sie aber keine jugend gehabt hat, weil die schönsten ihrer jahre waren krieg, und dass sie in die kirche gegangen sei, statt zu den treffen der nazis, dass die dort schon überlegt hätten, was sie mit ihr machen sollen und dass die bdm-führerin aber gemeint hätte „was wollt’s denn mit der? die tut doch keinem was“, dass sie in die kirche gegangen wäre anstelle und gott sei dank anstelle, dass sie schindlers liste gelesen habe, viel später, und dann zitiert sie mir die gedichte, die sie schreibt, weil sie andauernd schreibt, zuerst im kopf und dann schreibt sie die texte auf, das erste gedicht hat sie während des schafe hütens geschrieben, das kann sie auch noch, und früher habe sie mit meinem opa gemeinsam geschrieben, als er noch lustig war, meint sie, damals als er noch lustig war, später erzählt mir mein papa im auto, mehr über das schreiben meiner oma, später im auto will mir mein papa mehr erzählen von seinem früher, aber sein ganzes sprechen schweigen
in tagen wie wahnsinn lüge ich wie gedruckt auf papier, im internet, in umgangssprache, im dialekt, in standarddeutsch oder hochdeutsch, wie man umgangssprachlich sagt, ich umgehe alles, denke, dass ich doch verstehen können muss, entschuldige zu vieles oder sehe darüber hinweg, denke zu oft „ja, aber“, und sage weder das eine noch das andere, weil ich selbst eine einzige leerstelle bin, denn wer bin ich, wenn ich über feuerwehren, über botanikvereine, philatelie, über verkehrsunfälle, bienen, über faschingssitzungen, über die eröffnung von unterführungen und die hegeringschau schreibe und mir ein video anschaue von einem mann, der die geflüchteten gefilmt hat, wie sie durch die stadt gehen, weil „da muss man ja was tun dagegen“, wer bin ich, wenn überall gesagt wird, aber „auslända woll ma keine haben“, und ich nicht mehr dagegen halte, weil ich nicht stark genug bin, weil es mir nur ums eigene überleben geht, wer bin ich, wenn ich in meiner freizeit hannah arendt zitiere und verena stefans häutungen zehnmal lese und für das frauen*volksbegehren aufrufe, und wen macht man aus mir, wenn der einzige kommentar dazu ist „ist eh liab, was du denkst, ist eh liab“, vielleicht bin ich wirklich nur mehr eine liabe hülle, das fräulein, das fräulein redakteurin „a liabes diarndle, was wollt’s denn mit der? die tut eh keinem was“
Julia Knaß
freiTEXT ist wöchentliche Kurzprosa. Freitags gibts freiTEXT.
Du hast auch einen freiTEXT für uns? schreib@mosaikzeitschrift.at
<< mehr Prosa | mehr Lyrik >>
mosaik24 – Erlebniswelt Heizen
mosaik24 – Erlebniswelt Heizen
Intro
„Heiz ein und zieht euch warm an!“
„Wenn die Leute unsere Texte haben wollen, dann geben wir sie ihnen.“
Christine Haidegger spricht im Interview (S. 62) über die Gründung ihrer Literaturzeitschrift vor vierzig Jahren recht pragmatisch aus, was Beweggrund und Motivation für vieles sein kann: Die Nachfrage. Ein fehlendes Angebot. Ein Vakuum. Doch was, wenn es die Nachfrage nach etwas Bestimmten nicht gibt, nicht geben kann, da niemand weiß, dass etwas existiert, das man begehren kann. Ist das die Aufgabe von Kunst? Nachfragen zu befriedigen, die nie ausgesprochen worden sind?
Solche Fragen und ähnliche haben wir uns in den letzten Monaten regelmäßig gestellt – im Hinblick auf das bisher Erlebte, den status quo und die Ziele, die wir mit dem mosaik hatten und haben. Sind uns noch einmal klarer geworden, warum wir was wie machen. Haben an der einen oder anderen Schraube gedreht um zum Beispiel die Zeitschrift hoffentlich noch interessanter zu machen.
„Wir kleben. Wir lösen uns ab. Wir kleben. Alles, was von uns bleibt, sind unsichtbare Rückstände.“
Martin Peichl vergleicht den Zusammenhalt in einer Beziehung mit einem Post-It (S. 10). Und auch wir fragen uns nicht zum ersten Mal: Was bleibt von unserer Arbeit. Die physische Zeitschrift landet im Altpapier oder zerfällt langsam im Archiv – die achso bleibende und beständige Printpublikation bleibt bei einzelnen Autor*innen in einer Zeile im Lebenslauf bestehen: „Veröffentlichung in diversen Literaturzeitschriften.“
Es sind – wie so oft – nicht zuletzt die persönlichen Kontakte, die motivieren. Die Diskussionen mit Autor*innen und Rezipient*innen, die Unterhaltungen nach Lesungen, die Wertschätzung in den Mail-Konversationen. Ein Wort, das immer häufiger fällt: Dringlichkeit. Manche Texte werden nicht geschrieben, weil sie jemand lesen will, manche müssen einfach raus, auch wenn niemand auf sie wartet. Und bald kann man sich kaum noch vorstellen, wie man jemals ohne sie existieren konnte.
„dies ist kein gedicht über den zu kurz gedachten zusammenhang von sprache und denken. dies ist im besten fall: ein loch im papier, das groß genug ist, um durchzuwollen.“ – Xú Yìn / Lea Schneider (S. 42)
.
Inhalt
- Laurenz Rogi – Wie ich den Osorno bestiegen habe
- Kerstin Meixner – Die Geschichte meines Vaters, arabische Version
- Marianna Lanz – hasen
- Martin Peichl – Entdecker
- Julia Knaß – fixierungspunkte
- Safak Saricicek – humanspaghetti
- Chistian Lange-Hausstein – Wie eine Wespe
- Robin Krick – Der Schwerfällige
- Alexander Kerber – Im Hals klafft eine Wunde
- Nikola Huppertz – schuhe
- Sebastian Görtz – Industriekultur
- Slata Roschal – o.T.
- Illustrationen von Lisa Köstner
NEU: Kunststrecke von Daniela Kasperer
BABEL – Übersetzungen
- Krista Scözs – am paralizat/sunt un om al exceselor (Aus dem Rumänischen von Yevgeniy Breyger)
- Julia Grinberg – Paradisischer Fernblick | Zweimal über Phantome (Russisch und Deutsch)
- Anna Hetzer – Funkhaus Nalepastraße (Ins Italienische von Nicoletta Grillo)
- Kathrin Bach – Ocker (Ins Italienische von Nicoletta Grillo)
- Marco Mantello – Dopo l‘ultimo (Aus dem Italienischen von Tobias Roth)
- Agata Spinelli – Lungo il Freilichtmuseum (Aus dem Italienischen von Tobias Roth)
- Xú Yìn – 秋访金陵 (aus dem Chinesischen von Lea Schneider)
Kolumnen
- Peter.W. – Die Brille, Hanuschplatz #12
- Marko Dinic – Nachts, Lehengrad #4
Buchbesprechung
- Lisa-Viktoria Niederberger – Ein Ort in den Bergen. Rezension „Tau“ von Thomas Mulitzer (Kremayr & Scheriau)
Interview
- Papier erbetteln, Manuskripte schmuggeln. Josef Kirchner, Christian Lorenz Müller im Interview mit Christine Haidegger
Kreativraum mit Thomas Mulitzer
freiVERS | Julia Knaß
sein / stehen (eine irritation)
dieses Nichts zwischen uns scheint bedrohlich verschwommen : unumkehrbar schwimmen frei wie ?, während wir den staub der klassiker zwischen unseren zähnen zermahlen, lautet der current state of mind peripetie, das gefühl nahender finsternis verdrängen wir, indem wir über LEICHEN schreiben
sich mit tinder subkutan hyposensibilisieren : aber sie haben alle keine gesichter, sie haben alle keine gesichter! narrative miteinander, aber nie ineinander verweben – wie ein profi, du machst das schon wie ein profi!!! – seriell permutierend, „einzahl, mehrzahl, vielzahl, unzahl“ mit KÖRPERN nachspielen
unsere abgetreppten mauern schlussendlich doch bang hinuntersteigen : auf der suche nach etwas-zum-begehren; unter jeder unserer stufen befindet sich eine falltür und wir kippen hinein und kippen nach unten und kippen zurück hinauf und schließlich kippen wir nicht in-, sondern einander
Nichts steht
(mehr)
Nichts ist
(mehr)
zwischen uns
(mehr)
Julia Knaß
freiVERS ist unser Wort zum Sonntag.
Du hast auch einen freiVERS für uns?
schreib@mosaikzeitschrift.at