17 | Martin Peichl
Beim Wuzzeln sind wir dann eine Familie
Heimat ist dort, wo der Dialekt nah und frisch klingt, wo sich die Wörter wie Toastkäse auf deine Zunge legen, wo Gulasch ein Ersatz ist für Liebe, aber Liebe kein Ersatz für Gulasch.
Wo man dir mit LEGO beigebracht hat, wie leicht man Menschen zerlegen kann und sie trotzdem weiterlächeln. Dieses unheimliche Weiterlächeln der LEGO-Figuren, egal wohin man ihre Köpfe steckt!
Zerfranste Erinnerungen an gemeinsam Spieleabende. Die wichtige Regel: Uno und DKT gewinnt man, indem man nicht mitspielt.
Heimat ist dort, wo man am 25. Dezember die feine Balance finden muss zwischen den Vanillekipferln und Mini-Schaumrollen der Tante und den Bierflaschen, die dir dein Cousin hinstellt. Beim Wuzzeln sind wir dann eine Familie. Da werden sogar Eigentore verziehen.
Martin Peichl
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
16 | Iseult Grandjean
Bericht aus Babylon
Tag vierhunderteinunddreißig
Es ist so windig hier, dass ich manchmal das Gefühl habe, mir werden die Gedanken aus dem Gehirn gerissen. Dagegen kann man nichts tun, man kann sie ja nicht festhalten, so wie man Strafen nur abzahlen und Sehnsucht nicht ausbremsen kann, und deshalb warte ich dann. Ich warte und schlafe, ich mache ein paar Kniebeugen, um nicht den Kopf zu verlieren, und putze mein Gewehr. An windstillen Tagen laufe ich mit dem Gewehr im Arm durch die trockene Landschaft und streichle meine Waffe wie die Schultern einer alten Affäre. Am Anfang habe ich mich noch gewundert, wieso ich überhaupt ein Gewehr habe – aber dann habe ich getan, was jedem Menschen ein laufendes Leben gewährt und mich einfach daran gewöhnt. Das kalte Silber des Laufes fühlt sich an wie ein Fisch, der durch meine Finger gleitet; oder als schwömmen sie selbst, durch einen See aus flüssigem Metall. Was ist schon ein Ozean – und was eine machtlose Metapher? Inzwischen stelle ich keine Fragen mehr: Ich bin ein Soldat. Und ich berichte von der Front. Als ich meinen Job hier angefangen habe, hat mir keiner erklärt, worin meine Arbeit eigentlich besteht. Aufpassen sollte ich, dass nichts aus den Fugen gerät und „den Laden sauber halten“. Ich wusste nicht genau, was damit gemeint war, und deshalb reinige ich jetzt jeden Tag mein Gewehr, obwohl ich es in den vierhunderteinunddreißig Tagen meiner Amtszeit noch nie gebraucht habe. Ich arbeite allein; das macht die Tage oft lang, aber anscheinend ist es unerlässlich, dass ich keinen Partner an meiner Seite habe und mir niemand reinredet. Manchmal bin ich mir unsicher, ob sie überhaupt wissen, dass ich keine blasse Ahnung habe, was ich überhaupt sagen und in was mir dementsprechend reingeredet werden könnte, und dass ich den Großteil meiner Zeit damit verbringe, mit meinem Gewehr im Arm auf und ab zu laufen und auf die feine Linie zu starren, die einem Horizont gleicht, aber wahrscheinlich eher so etwas ist wie die Oberleitung einer weit entfernten Bahnstation. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der nicht dieser Krieg herrschte. Ich kenne die Welt nur so: der Horizont verleimt von Bahnhöfen, Plakaten, Schildern, bitte aussteigen, bitte trinken, bitte kaufen, bitte konsumieren, aber bitte – kein Müll. Abfall gilt hier als Teufel im System eines falschen Minimalismus (gegründet auf Exzess und seiner Überforderung), denn Plastik und Öl verstopfen heimlich Waldärme und verkleben die Wirtschaft. Als wäre alles nur eine Frage des Stoffs. Doch der eigentliche Unrat, der wirkliche Feind, ist unmöglich zu treffen, denn er ist überall, er liegt in der Luft, hängt in Gardinen und klebt an Wänden, klettert in Ritzen und wächst auf den Bäumen. Er verbreitet sich durch die Zeitung und das Fernsehen, gebiert auf Kaffeetischen und in Krankenhäusern, befruchtet Ehebetten. Wahlplakate, Slogans, Parolen, Hashtags, Nachrichten, Informationen, Fake News; Worte zum Erklären, zum Überzeugen, zum Verführen. Es wirbt um jeden, bietet sich allen an und dient doch keinem außer sich selbst. Es ist Schaf und Wolf in Einem, Bauer und König, Hure und Diktator. Ich kann mich nicht erinnern: an eine Zeit vor der Diktatur des Wortes. Es kommt Gott so nah wie niemand zuvor, fast kann es seinen strengen Atem riechen. Und vielleicht wird es eines Tages sogar sein Mörder.
Tag vierhunderteinunddreißig, später
Deshalb sitze ich jetzt hier also im Wind, seit vierhunderteinunddreißig Tagen, und kratze mich am Arm. Vom dauernden Kontakt mit dem Metall des Gewehres hat er sich an der Ellenbogenbeuge innen entzündet. Ich beobachte die schuppig nässende Haut der Wunde wie ein Wissenschaftler oder ein Archäologe, mit wachsendem Interesse und gleichzeitig zärtlicher Gleichgültigkeit. Seit Wochen habe ich keine Nachricht mehr aus der Zentrale bekommen, keine Anweisung, kein Wort, aber dafür umso mehr Zeit zum Nachdenken; die Stille ist ungewöhnlich, seit der Informationsfluss versiegte. Außer dem verdammten Zug, der durch diese Einöde jagt, der durch keine Bäume und keine Häuserwände aufgehalten wird und dem sich nichts entgegenstellt, ist der Raum, in dem ich arbeite, leer. Und so langsam bekomme ich das Gefühl, dass das auch genau so gewollt ist. Von oben. Wer ist dort oben? Eigentlich gibt es keine Obrigkeiten mehr, das war ja einst die züngelnde Verlockung: Demokratie durch das Wort. Kollektive Wahrheitsfindung und jeder darf mitreden, Silben als Währung, jeder kann sich bedienen, ist genug für alle da. Aber allmählich entwickelte sich aus dieser kommunistischen Utopie ein Kapitalismus der Rhetoriker, der Texter und Wortgewandten, der Lauten, und man versteht sich nicht mehr. Jetzt werfen wir uns die Sätze hin wie vergammeltes Fleisch und graben in den Ruinen von Babylon nach einer Wahrheit, die es so nie gegeben hat. Das Wort hat sich verselbstständigt, ist übermächtig geworden; inflationär. Es hat auf dem Weg zum Monopol all seine Macht verloren: Babel hat sich selbst zerstreut.
Tag vierhundertzweiunddreißig
Heute habe ich zum ersten Mal mein Gewehr fallen lassen. Ich hatte beschlossen, mein Gebiet näher zu untersuchen. Irgendwelche Ergebnisse müsste ich doch nach Hause bringen, dachte ich panisch beim Aufstehen. Ein paar Daten, eine Handvoll aussagekräftige Erde, zumindest einen Bericht, ein Körnchen Wahrheit? Es kommt mir seltsam genug vor, Soldat zu sein, direkt an der Front, und nie auf den Feind zu treffen. Nur Himmel und Erde strukturieren mein Feld, getrennt durch diese eine feine Linie, die immer den Anschein macht, als wäre es möglich, sie zu überschreiten. Außer dem Wind, der manchmal leise pfeift und mir sonst geräuschlos über den Körper fährt, höre ich nichts. Die Stille ist ohrenbetäubend. Ja, der große Knall, als meine Waffe auf die frostharte Erde stieß, war vielleicht das erste Geräusch seit Beginn meiner Dienstzeit. Als ich mich bückte, um es aufzuheben, fiel mir auf, dass der Boden unter mir von feinen Rissen durchzogen wurde, Linien, die mich an die Aufzeichnungen eines Seismographen oder eines EKG erinnerten. Erst dann wurde mir klar, wie symptomatisch diese Vergleiche für unseren Zustand sind, die wir am Wort kranken: Wie wir uns mit der Zeit angewöhnt haben, Ausdruck auf Ausdruck zu schichten und zu stapeln, Metaphern übereinander zu ziehen wie Kleidung an einem kalten Wintertag, als hätten wir Angst, ohne die schützende Speckschicht der Worte plötzlich allein im Wind zu stehen, zitternd und nackt. Ich sah mich um: Mich fror tatsächlich.
Tag vierhundertdreiunddreißig
Meine Felduntersuchung konnte also letzten Endes ziemlich schnell – und zugegeben recht stümperhaft – durchgeführt werden, und das lag nicht nur daran, dass mir immer kälter wurde und der silbrige Frost der Flinte meine Finger steif werden ließ, mein Blick wanderte von einem unbestimmten Punkt bis zum nächst denkbaren, irgendwo im Hintergrund meinte ich den Grundriss eines Baumes zu erkennen, ich notierte: Der Raum ist leer. Jetzt, wo ich es zum ersten Mal ausgesprochen habe, wird mir erst das Ausmaß dieses sprachlichen Hohlraums bewusst; überall lockte mich sonst immer etwas mit krummen Fingern, mal war es ein Schriftzug, mal eine Rede, manchmal auch nur ein einziger Satz, der ein Parteiprogramm oder das Patent einer Liebesfähigkeit beschwor, im Grunde ist jedes Wort, auch das private, nur noch Werbung, Reklame für die eigene Wahrheit in der Wahlurne eines anderen. Wir halten uns an Worten nicht mehr fest – wir hängen uns an ihnen auf. Davon ist in diesem Raum nichts mehr, nichts verhindert, dass sich mein Blick nach innen richtet. Ich blicke auf mein Gewehr, unbenutzt seit vierhunderteinunddreißig Tagen. Die kleine Öffnung im Lauf starrt schweigend zurück. Bin ich, in der Uniform eines Soldaten, endlich frei? Doch Freiheit, das merke ich ziemlich schnell, ist verunsichernd. Wir haben lieber falsche Wahrheiten als Ungenauigkeiten, lieber Fake News als sokratische Apologie. Diesen Krieg haben wir also selbst verschuldet, das Wort war immer nur Beihelfer: Es versucht Gefühle in Gedanken zu übersetzen, zwängt Vages in Gewissheiten, ja, es arbeitet ohne Skrupel – aber wir haben die Fäden in der Hand. Haben wir den Laut erst domestiziert, und dann vergewaltigt? So zogen wir damals der Musik den Strick der Sprache um die Kehle und seitdem verstopfen wir uns mit hohlen Phrasen den Hals. Man drückt den Menschen ein Instrument in die Hand, und für einen kurzen Moment fühlen sie sich frei; dann gehören sie ihrer Waffe. Ich stelle mir vor, dass die Welt vor dem Wort ähnlich dalag wie mein Gebiet: Weit und schweigsam, wie eine offene Wunde.
Tag vierhundertfünfunddreißig
Stattdessen dieser Krieg, und wir mittendrin. Sie holen mich jetzt zurück, gestern habe ich es erfahren. Anscheinend ist mein Job hier erledigt. Ich bin inzwischen überzeugt: Das war kein richtiger Einsatz. Vierhundertfünfunddreißig Tage und kein einziges Mal habe ich meine Waffe benutzt. Und doch war ich Soldat, direkt an der Front: Ich arbeitete als Späher und Steuer in der Stirn, stationiert am vorderen Ende der linken Großhirnhemisphäre eines so hungrigen wie maßlos übersättigten, eines freien und dabei unendlich verlorenen, kurz eines ganz gewöhnlichen Menschen. Ich sollte die Wahrheit ausmessen und in einem detaillierten Frontbericht aufschreiben. Was wollt ihr jetzt von mir hören? Ich habe nicht viel herausgefunden, außer dass man ein Gewehr am besten mit Öl und etwas lauwarmen Wasser wäscht und dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur unendlich viele Übersetzungen davon. Ich notiere einen letzten Satz in mein Notizbuch: Sprache ist ein Schlachtfeld. Dann setze ich mich hin und warte. Bald kommen sie mich holen. Es weht wieder wie am ersten Tag, mein Ausschlag ist noch nicht ganz verheilt und brennt im Wind. Ich atme in den Schmerz und vergesse mein Gewehr. Der Krieg wird wahrscheinlich weitergeführt, jedes Haupt an seiner eigenen Front, aber ich will dieses semantische Fressen nicht mehr, ich habe es satt und einen Beschluss gefasst, es ist ein Versprechen – und ich werde es halten: Das ist mein letztes Wort.
Iseult Grandjean
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
15 | Marlene Gölz
in den betten liegen kinder
in den kleidern vom vortag.
auf dem nachttisch
leere packungen medikamente.
ihre hände presst sie
gegen die schläfen
ihres verweinten,
zuckenden gesichts.
statt frühstück gibt es wasser.
die augen der kinder sind verklebt.
bevor der älteste den kindergarten betritt,
bleibt er stehen. streicht sich die haare glatt
und knöpft sein hemd bis oben hin zu.
Marlene Gölz
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
14 | Nils Langhans
Il Postino
Es war ungefähr 20 Uhr, ich aß eine in Küchenrolle gewickelte Salsiccia, einige grobe Fettstücke verfingen sich zwischen meinen Backenzähnen, es roch eigentümlicherweise nach Marzipan, und einen halben Meter neben mir starb eine Taube. Sie kauerte, ein Flügel stand schräg aus ihrem Gefieder heraus, gebrochen, ihr Kopf kreiste, kreiste immer langsamer. Es war windstill. Ich stieß auf. Unter ihrem Körper breiteten sich jetzt einige Tropfen Blut aus, kaum eine Lache, höchstens ein größerer Fleck, den spätestens der nächste Regen hinwegwaschen würde. Noch immer roch es nach Marzipan. Die Taube atmete schwer, Versuch eines Aufbäumens, doch keinen Zentimeter wollte die Schwerkraft weichen, der Körper längst zu schwach. Ich blieb bei ihr, biss in die Salsiccia, kaute und versuchte mit meiner Zunge, das Fett aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Die Taube gurrte, ich warf ihr das letzte Stück Wurst vor die Füße, keine Regung, noch zwei Atemzüge, und es war geschehen. Sie fiel geräuschlos in sich zusammen. Ich zündete eine Zigarette an und schaute auf das Meer, die See war ruhig, sie schimmerte preußenblau, kein Marzipan mehr in der Luft, stattdessen Kindergeschrei in der Ferne, ich blickte hinab und zu meinen Füßen setzen sich die ersten Fliegen auf die glasigen Augen der Taube.
Später am Abend saß ich in Annas und Viviannas Wohnung, kostete einige Schokoladenplätzchen und trank ein Peroni aus der Flasche. Viviannas Großeltern, die inzwischen zu uns gestoßen waren, empfahlen mir, Il Postino anzuschauen, den berühmten Film. Ich nickte. Vivianna war in etwa so alt wie ich, doch uns unterschied, dass sie schiefe Zähne hatte und ihr Zahnfleisch so künstlich, so gedunsen aussah, so als trüge sie eine Vollprothese, hellrosa, wie ein Babyschwein. Einmal sei sie in Miami gewesen, weil sie ein 6-Monats-Arbeitsvisum gewonnen hatte. Da habe sie in einem Geschäft Sonnenbrillen verkauft und Englisch gelernt. In Miami sei alles so groß gewesen, und erst recht in New York. Ich kaute und Vivianna bot mir weitere Kekse an. Ihre Mutter lugte unter ihrer Brille zu mir herüber, im Fernsehen lief ein Fußballspiel, die Großeltern saßen auf einem Sofa, starrten in den Fernseher und hielten einander die Hand, und ich dachte wie schön es wäre für immer hierzubleiben, Vivianna zu heiraten, zur Marine zu gehen, eines Tages würde ich ihr von meinem Lohn eine Zahnkorrektur spendieren, und in 50 Jahren würde ich auf Procida sterben und das Letzte, was ich hören würde, wäre die Kirchglocke schräg gegenüber, während ich in meinem Schaukelstuhl mit einem Glas Limoncello in der Hand einschlafe. Plötzlich sagte Vivianna, dass es morgen regnen solle. Kurz darauf verabschiedete ich mich.
Auf dem Balkon lockerte ich den Tabak in einer der starken American-Spirit-Filterzigaretten. Dem Tabakfachgeschäft waren die Lights ausgegangen, sodass ich unweigerlich die stärkeren American Spirit kaufen musste, deren hellblaue Kartonage mir jedoch ausgezeichnet gefiel. Die Kirchglocke läutete ein paar Mal. Nach dem sechsten Gong hörte ich auf mitzuzählen. Ein einzelner Wassertropfen fiel auf meine rechte Schulter. Morgen würde es regnen. Später ging ich noch einmal auf den Balkon, lockerte noch einmal den Tabak einer American-Spirit-Filterzigarette und entzündete ihn. Wieder läutete die Kirchglocke. Diesmal fing ich erst gar nicht an mitzuzählen. Ein weiterer Wassertropfen fiel auf meine Schulter. Es war so langweilig, dass es schon fast wieder langweilig war. In der Nacht versuchte ich Il Postino, den berühmten Film, auf einer Streamingseite anzuschauen, doch die Internetverbindung war außerordentlich schlecht. Ich schlief zu dem Standbild der Titelsequenz ein und träumte von frittiertem Brokkoli. Am nächsten Morgen fühlte ich mich äußerst ausgeschlafen.
„Als ich in deinem Alter war, Anfang der Achtziger war das, da bin ich einmal nach Stockholm geflogen, weil ich so verrückt nach Peter Weiss war“, erklärte mir der ältere Herr, der das Nachbarappartement bewohnte, während ich zum Frühstück ein Glas Orangensaft auf dem Balkon trank. Er verständigte sich in jenem Sprachgewirr aus Italienisch und Englisch, das entstand, wenn man einen Neapolitaner für ein halbes Leben in die klinische Sterilität Londons verpflanzte. Ich betrachtete seine fleischige Nase, die porige Haut, auf der die roten geplatzten Äderchen wie Wegmarken einer geheimnisvollen Schatzkarte erschienen, und er sagte, dass es damals ja noch kein Internet gegeben habe, damals, als er Peter Weiss in Stockholm gesucht hat.
„Aber ich wusste, dass er da wohnt. Das hatte ich rausgefunden. Und dann bin ich nach Stockholm geflogen und habe ihn fünf Tage lang gesucht. Fünf Tage, weißt du, fünf verdammte Tage. Peter Weiss war damals mein Gott, ich habe alles gelesen, wirklich alles, am besten war Marat/Sade, und ich wollte ihn unbedingt treffen. Fünf Tage habe ich ihn gesucht, fünf Tage, aber ich habe ihn einfach nicht gefunden.“ Sein weißes, kurzgeschorenes Haar gab ihm die Aura eines alternden Schneelöwen, der nach Ewigkeiten im Exil zum Lebensabend wieder in gewohntem Lande unter seinesgleichen ist, und ich hatte das Bedürfnis ihm mit meiner Hand über seine roten Wangen zu streichen und ihm ins Ohr zu flüstern, dass ich verstünde, dass es wohl eine Zeit gegeben hat, in der das Leben gut zu ihm war. Er pellte eine Orange und sagte mit vollem Mund, dass Warten auf Godot inzwischen sein Lieblingsstück sei. Seine Tochter rief aus dem Appartement in schaurigem Oxford-Englisch „Daaaaad?“, er häutete ungerührt eine zweite Orange, steckte sich ein Stück in den Mund und reagierte nicht, bis sie schließlich nach zwei weiteren Daaaaads herauskam und ihn nach der Sonnenmilch fragte. Er schob das Weiße der Orangen zu einem Haufen zusammen, sagte zusammenhangslos „Ach, Peter Weiss“, seufzte dann, seine Tochter kullerte mit den Augen und nasalierte „He’s always doing that“ in meine Richtung, bevor sie über die Balkontür wieder ins Appartement verschwand.
Es regnete den ganzen Tag über nicht. Nach dem Mittagessen ging ich zum Strand. Auf der Straße hinab zur Bucht spielten zwei Jungen mit Wasserpistolen. Dem Kleineren der beiden fehlte ein Schneidezahn. Im Strandcafé bestellte ich Espresso und hörte dem Kellner zu, der mir erklärte, dass genau hier Il Postino, der berühmte Film, gedreht worden sei, und dass es später regnen solle. Anschließend schlief ich für eine Stunde in der Sonne.
Unweit des Strands – ich war bereits auf dem Rückweg – hingen an einer Mauer einige Käfige mit Wellensittichen, daneben ein Preisschild: 35 Euro. Ich betrachtete die Vögel und hörte ihrem leisen Piepsen zu. Eine junge Frau kam aus dem Geschäft gegenüber und erkundigte sich, ob ich einen der Wellensittiche kaufen wolle. Ich nickte. Sie öffnete den mir nächsten Käfig, nahm meine Hand und bedeutete mir, den Vogel zu berühren. Ich zog die Hand zurück und raunte ihr ein strenges „No!“ entgegen. Sie zuckte mit den Schultern und fragte, ob ich zusätzlich noch einen Käfig benötige. Ich verneinte, sie verschwand wieder in das Geschäft auf der gegenüberliegenden Seite, eilte dann mit einem ReebokSchuhkarton in der Hand zurück, öffnete den Käfig, lockte den Wellensittich mit einem Brotkrumen in den Karton, verschloss ihn und drückte ihn mir in die Hand. Ich bezahlte 35 Euro. Die anderen Vögel piepsten jetzt etwas lauter. Ich bog mit dem Karton in eine Seitengasse ein, der Vogel klopfte gegen die Pappe, ich streichelte über das leicht exponierte ReebokEmblem an der Oberseite der Schachtel, öffnete den Deckel und ließ den Wellensittich wegfliegen. Den Karton schmiss ich auf die Straße.
Gegen Nachmittag saß ich wieder auf dem Balkon. Ich trug ein Leinenhemd von Valentino, die Sonne brannte auf meinen Unterarmen und Vivianna reichte mir ein gefrorenes Glas mit selbstgemachtem Lakritzlikör, der kotbraun schimmerte. Ich probierte einen Schluck, Vivianna lächelte, ging zurück in ihr Appartement und ich goss den restlichen Likör in einen Blumenkasten. Er versickerte äußerst langsam in der ausgetrockneten Erde. Die Rollläden des Nachbarappartements waren verschlossen. Auf dem Balkontisch lag noch immer der kleine Haufen mit dem Weißen der beiden Orangen. Ich ging in mein Appartement, legte mich bäuchlings auf mein Bett und schlief kurze Zeit später ein. Etwa zwei Stunden später wachte ich von den bittersüßen Lakritzablagerungen in meinem Zahnfleisch auf. Im Nebenzimmer lief SOS von ABBA und draußen vor der Tür schlug jemand mit einem Hammer monoton gegen eine Wand. Ich ging ins Bad und suchte in meiner Kosmetiktasche nach einer Tablette, nach irgendeiner Tablette.
Im Hafen von Marina Corricella las ich die Speisekarte eines Restaurants, das Il Postino sul Mare hieß, und der herbeieilende Kellner sagte zunächst, dass das Restaurant wegen des Films so heiße. Il Postino, der berühmte Film. Anschließend fragte er mich, ob ich etwas essen möchte. Ich nickte. Auf seinem T-Shirt stand Fashionman und ich bestellte Gnocchi alla Sorrentina. Am Nebentisch aß ein Ehepaar schweigend ein Dessert. Die Frau trug ihre Haare mit einer großen Haarklammer zusammengekniffen, vermutlich, um ihren Spliss zu kaschieren, und ihrem Mann fiel das dünne Haar über die Stirn hinweg aus. Ein buschiger Schnauzbart thronte als letzte Bastion einstigen Testosterons über seiner wurstigen Lippe. Er trug ein Trikot des 1.FC Nürnberg. Der Kellner mit dem Fashionman-T-Shirt verabschiedete sie kurz darauf mit Handschlag, blickte der Frau ganz tief durch ihre randlosen, nicht entspiegelten Brillengläser in die milchigen Augen und hauchte ihr ein „Signora, Grazie Mille“ entgegen. Sie lächelte unbeholfen, hakte sich bei ihrem Mann unter, er legte seine Hand auf ihren Po und sie entschwanden in eine Nacht, in der sie den deutschen Traum von Italien träumten. Sie und alle anderen glaubten die Geschichte der grün-weiß-roten Flaggen, des sonoren Singsangs, des überkandidelten Charmes, die Geschichte von Ferrari, Pizza und Pasta, sie glaubten so gerne, dass alles eins war, was blieb ihnen auch anderes übrig als zu glauben, zu glauben an die Illusion Italien, an den Kunststaat, der nie ein Staat sein wollte, an das Schelmenstück Garibaldis. Insbesondere in den Wintermonaten tröstete es die Deutschen, dass es Italien gab, und spät am Abend nach getaner Arbeit wälzten die Mitvierziger die Alltourskataloge, stießen mit einem Glas Chianti, den der Vater für 3,99 EUR bei den italienischen Wochen eines großen Discounters erstanden hatte, auf den anstehenden Sommerurlaub in der Toskana an, und später hatten sie noch drei oder vier Minuten Sex in der Missionarsstellung, das erste Mal seit drei Wochen. Danach glitten sie unter der Last ihrer zerborstenen Existenz in den Schlaf und träumten den deutschen Traum von Italien.
Inzwischen hatte es angefangen zu regnen. In der Ferne blitzte es und der Donner hallte einige Sekunden später über den Fischerhafen von Marina Corricella. Vivianna hatte Recht behalten. Das Wasser platschte vom Rand des Sonnenschirms in zapfengroßen Tropfen auf die weiße Tischdecke, schwemmte sie auf und der nasse Baumwollstoff glich einem adipösen Damenbauch, so wie er kleine, geschwulstartige Falten warf. Die Gäste rannten unter das Vordach, die Kellner sammelten eilig das Geschirr ein und zurrten die im Wind wankenden Schirme fest. Es blitzte taghell. Ich blieb sitzen und starrte in den Regen, der auf die Fischerboote prasselte. Die Lampe unter dem Sonnenschirm wog sich quietschend im Gewitterwind und ich trank einen Schluck Aperol Spritz, der inzwischen wässrig schmeckte. Ein Junge stellte sich in einem Verschlag rechts des Restaurants unter. Er hatte blaue Augen, daran erinnere ich mich genau. Schließlich ging ich in das Restaurant und ließ mir ein Tiramisu bringen. Es war kreisrund, mit Kakaopulver bestreut und leicht rechts der Mitte auf einem viereckigen Teller platziert. Es schmeckte unaufdringlich. An der Wand gegenüber hingen gedruckte Filmausschnitte von Il Postino in sargbraunen Rahmen. Il Postino, der berühmte Film.
In der Nacht stand ich draußen auf dem Balkon und rauchte. Die Kirchglocke läutete zwei Mal. Neben meinem Aschenbecher kopulierten zwei Nacktschnecken, die der Regen angelockt hatte. Die Wolken zogen in kleinen Häppchen am Mond vorbei und es sah aus als würden sie mir eine Fratze schneiden.
Nils Langhans
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
13 | Andreas Schumacher
Gotthilf Grünberger (1600-1668)
Ekstatische Erdung im himmlischen Ich.
Blasphemischer Gedanke in schwerer Zeit:
Dass man sich munter selbst behälfe,
nicht mehr nur, wie seit grauer Vorzeit,
altem Brauche folgend Hand anlegte –
den Mund vielmehr nähme, mitsamt der Zunge
(bifunktionales Organ, Geschmacks-
organ, Organ der Sprache)
im Zuge autonomer Bemühungen
(schwielig die Pranken, schmerzvoll aufgeplatzt
die Fingerkuppen vom Gebrauch der rauen Taue)
halbautomatisch eingesetzt zur Befriedung
kalendarisch aufstoßender Gelüste.
Inmitten von Glaubenskriegen, Hungersnöten,
allgemeiner Orientierungslosigkeit
welch konterkühnes Kunststück
unterm wachehaltenden Sternenzelt!
Gotthilf Grünberger : – o
Entdecker, Entwickler, Erfinder,
Namenspatron und Missionar
des einfachen Grünbergers;
geboren zu Speyer im Jahre des Herrn 1600
als Spross einer uralt verwurzelten Bauernfamilie;
Aussteiger, Frührentner, Selbstversorger;
Weltumsegler, Grenzgänger, Waghals,
Penispionier der ersten Stunde,
versuchte, was im feuchten Traume er gesehen,
auf zerstörten etruskischen Vasen
und pornobalkenbehandelten Höhlenmalereien –
sich ein Leben lang schon immer weiter,
immer höher hinaus vorgearbeitet habend
durch Fleiß und Schweiß,
Ausdauer und Stehvermögen,
Geschick in allen Lebenslagen;
gelenkig, sehnig, schwindelfrei,
allgemein gut ausgestattet,
gelang ihm in lauer himmelundmeerver-
schmelzender Frühsommernacht,
was mancher wohl
durchaus vor
ihm schon er-
strebte.
Umsichtiger Kaufmann, großer Generalvorsteher,
leitender Direktor eines Hamburger Handelskontors
mit weitreichenden Verbindungen tief runter ins Fuggerländle,
Junggeselle, Wunschschwiegersohn, Feierabendpoet –
alles hin-
& sich selbst in die Waagschale
geworfen,
ausgestiegen,
aufgebrochen,
drauflosgesegelt,
das Ei des Kolumbus gefunden
am neunundvierzigsten Tage
in Form zweier Eier und eines
schwellenden Schwanzes,
gelegen in einem Winkel
von einhundertundsechsundsiebzigkommazwei
Grad zwischen seinen unrasierten, nackten Schenkeln.
Von seinem eigenen Samen sich nährend,
blies er sich ostentativ durch die sieben Weltmeere,
bald weltberühmt durch simple Mund-zu-Mund-Propaganda,
eine sich selbst vorauseilende Legende der lasterhaften Leibeslust,
ein eigengliedkauendes Perpetuum Mobile onanistischer Dauerbespaßung.
Sein mit Abstand berühmtester Ausspruch
– Was brauch ich andre Menschen noch,
wenn mir mein Mund das beste Loch? –,
vom Philosophen Schopenhauer
in gehobener Weinstimmung immer wieder gern
bierselig ausgepackt an Frankfurter Kaschemmentischen –
steht niedergeschrieben
in seinem penibel dokumentierenden,
bahnbrechend schrankeneinreißenden Werk
Wie ich als erster Mensch der Weltgeschichte
mir unversehens erfolgreich selbst einen blies
und darob in allgemeinen Jubelchor ausbrach
Wer ihn jemals ohne Vorwarnung
in flagranti vorübergleiten sah,
sei’s am Kap Verde, bei Bali
oder auf dem Schwarzen Meer,
wird schwerlich ihn vergessen haben.
Selbst Seeräuber machte er gefügig
ließ er einhalten in ihrem gottlosen Tagwerk –
Säbelrasseln verstummte, wo er aufkreuzte
kollabierte der Kanonenkurs,
warfen gefürchetete Männer sich zu Boden,
einzuüben den gigantischen Grünberger,
friedfertig, experimentierfreudig, fickfanatisch.
Bald allerorts beliebt und willkommen,
wo nicht grade zufällig ausgesprochene Prüderie,
allgemeine Lust- und Sinnenfeindlichkeit
ihr harsches Zepter mürrisch schwangen,
autark, autofellatiös, out of step,
lebte er, von Küste zu Küste/Eiland zu Eiland ziehend,
von den Spenden seiner zahlreicher werdenden Anhänger,
gab er heillos überlaufene Gönn-Workshops
in aller Herren Länder.
Nicht sehr wählerisch
in Geschmacksfragen;
immer bodenständig,
ein Mann des Volkes geblieben,
starb er in sternklarer Nacht,
achtundsechzigjährig,
rückenleidend,
vor der Küste Dänemarks,
im felsenfesten Glauben,
dass alle Welt vom Streit abließe,
wenn jedermann sich selber bliese.
Ein oder zwei Tage
vor seinem Dahinscheiden verfasst
sein letzter Logbucheintrag
Ich lieg an Deck am Abend gerne
und schaue auf die Himmelssterne.
Das Ziel ist nicht mehr gar so ferne,
drum streng dich, Menschheit, an und lerne!
Andreas Schumacher
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
12 | Unda Maris
Tremendo furioso
oder Wie mir der Singsang einmal tief ins Hirn hinein blies
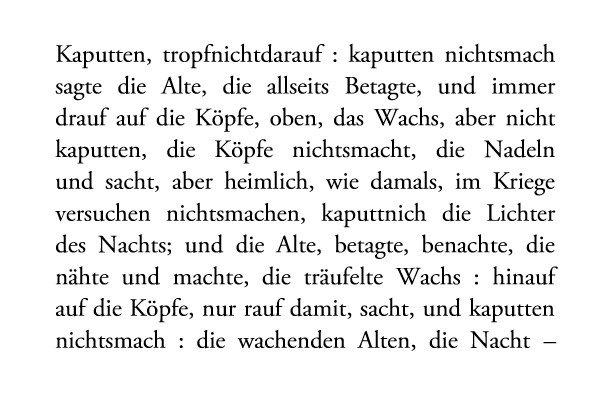
Unda Maris
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
11 | Verena Ullmann
FortuneTeller
Du glaubst nicht an Zufälle, du glaubst an das Schicksal. Er findet das lächerlich. Noch nicht einmal sein Horoskop darfst du ihm vorlesen. Natürlich bist du nicht so naiv, das alles wörtlich zu nehmen. Sonst hättest du, die Jungfrau, ihn, den Fisch gleich wieder abgewimmelt. Das wäre schade gewesen, denn inzwischen habt ihr es euch so schön eingerichtet in eurem Aquarium.
Klug wie du bist, liest du das Horoskop vielmehr wie einen Wetterbericht. Da die Wolken nun mal ihre Launen haben, geht es vor allem darum, draußen die Augen offen zu halten.
Heute schenkt dir der Chinese mit der Rechnung einen Glückskeks. Nicht rein zufällig, nein. Wie du an seinem Lächeln siehst und an dem kleinen Zwinkern des Schicksals in seinen Augen, ist dieser nur für dich bestimmt und verspricht dir – schwarz auf weiß – Reichtum.
Erst fragst du dich, ob du gleich beim Kiosk vorne einen Lottoschein ausfüllen sollst. Aber das wäre zu einfach und leichtsinnig unverschämt dieser rätselhaften Macht gegenüber. Als du aus dem Restaurant spazierst, verdunkelt sich plötzlich der Himmel und vertreibt die Freude aus deinem Gesicht. Was wenn du erbst? Wenn jemand stirbt? Oma? Dein Vater? Du wirfst den Streifen Papier mit deinen negativen Gedanken in den nächsten Mülleimer, bevor das Schicksal sie bemerkt.
An der Ecke vor der Bushaltestelle zieht schließlich etwas deinen Blick auf sich. Ein Pappkarton. Er ist schon aufgeweicht, der Krempel darin lieblos durchgewühlt und laut Zettel „zu verschenken“. Unter dem Plüschhund und dem Kabel eines wohl nicht mehr funktionstüchtigen Geräts schimmern Blümchen hervor. Sie tanzen im Kreis und spielen mit den Flocken, die gerade wieder anfangen vom Himmel zu fallen. Deine Augen hängen an den Goldrändern, aber du weißt, der Bus kommt gleich und außerdem beginnt der Schnee zu nerven. Du willst den Strauß pflücken und merkst dabei: darunter sind noch mehr davon, ein ganzer Stapel Kostbarkeiten! Darum ein Gummiband gewickelt, lächerlich instabil. Also gräbst du sie mitsamt den Wurzeln aus, um sie nicht zu trennen. Auf der Busfahrt scheppern sie ein leises „Danke“ und du erkennst, wie wunderschön sie sind.
Zuhause fragst du dich, wohin damit? Das Regal in der Küche ist voll mit Schlichtheit in Scheiben. Und dein Fisch wird dich sowieso fragen, was du da wieder für einen Kitsch angeschleppt hast. Also pflanzt du sie erst einmal auf den Esstisch, dort wo die Sonne Platz nimmt, wenn sie denn heute noch vorbeischaut, und fragst dich, was sie wohl wert sind. Auf der Unterseite des Tellerstapels steht in feiner Schrift „Versailles“ und innerlich triumphierst du schon, als wärst du rechtmäßige Erbin von Marie-Antoinettes Kuchenservice, so unwahrscheinlich dies auch sein mag.
Es hat aufgehört zu regnen und du trägst deinen neuen Schatz, bevor dein Fisch nach Hause kommt, zum Antiquar auf der anderen Straßenseite. Du hast dir extra fusselfreie Handschuhe angezogen und deine Hände darin zittern so vor Aufregung, dass du Angst hast, all die Blumenpracht auf den vier Metern Straße zu zerschmettern. Du setzt sie auf der Theke ab. Der
alte Mann mit der Brille macht nur leider all deine Vorsicht sofort zunichte: er grabscht sich das oberste Exemplar, lässt Licht darauf prallen und kratzt mit seinem Fingernagel sogar an der Oberfläche der Blütenblätter. Für die geheimnisvolle Inschrift hat er nur ein Stirnrunzeln übrig, dem ein abschätziges Lächeln folgt. Dann verschwindet er wortlos in den Nebenraum. Mit so einer Unverschämtheit hast du an deinem Glückstag nicht gerechnet. Deine Aufregung schlägt in Wut um und du bist kurz davor zu gehen, bevor du überhaupt seine Meinung gehört hast. Allein wie inkompetent er sie begutachtet hat! Wie soll er so ihren wahren Wert erkennen?
Da erblickst du, zwischen Theke und Tür, ein Glitzern. Die Sonne ist zurück und spielt auf der Klinge eines Dolches, der in einer offenen Schatulle ruht, als wolle sie dir ein Zeichen geben. Als der Mann zurückkommt, hast du den verzierten Griff schon fest in deiner rechten Hand hinter deinem Rücken. Wie erwartet erklärt er, dass er dir für den wertlosen Krempel kein Geld geben kann. Da musst du ihm natürlich widersprechen. Mit der Spitze des Dolches kratzt du an seiner Kehle und er legt dir, mit einer Behutsamkeit, die du ihm nicht zugetraut hast, den Kasseninhalt auf die Theke. Etwas über Zweihundert Euro sind es nur.
Unter Reichtum hast du dir etwas anderes vorgestellt, aber für Diskussionen bleibt keine Zeit und leider hast du keine Tasche bei dir, um weitere Kostbarkeiten einzupacken. Also greifst du das Geld mit deinen Handschuhen, lässt den Dolch fallen, die Teller stehen, rennst nach draußen und traust dich erst wieder in dein Aquarium zurück, als es erneut zu schneien beginnt. Dass zwischen dem dritten und dem vierten Teller, dem vierten und dem fünften, sowie dem fünften und dem sechsten weitere Geldscheine eingeklemmt waren, insgesamt weitaus mehr als zweihundert Euro, das wirst du erst von den Polizeibeamten erfahren, die – zusammen mit deinem zappeligen Fisch – schon am Esstisch auf dich warten.
Verena Ullmann
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
10 | Johanna Beck
Souterrain
Er hat seinen Keller recht gut vermieten können, sagt der Grubinger.
Ah geh, wirklich! Wir haben ja nicht mal die Ski mehr dort unten, die Stahlkanten sind bei der Feuchtigkeit doch immer verrostet.
Die scheinen nie auszugehen, diese Leut´, arbeiten wohl nichts, immer brennt eine Funsel. Aber man sieht ja nicht hinein, die zerbrochnen Scheiben haben sie mit Zeitungen ausgestopft und verklebt.
Nimm doch noch eine Wurst, Franz!
Die Frau ist schwanger, schon ganz zuletzt, sagt der Grubinger.
S´ist wohl schon da, die Hausbesorgerin hat gestern g´schimpft, dass sie zu Mittag nicht schlafen kann, weil es schreit so, das schwarze Kleine.
Magst nicht noch eine Wurst, Franz?
Johanna Beck
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
09 | Andrea Nagy
Fortschritt
Selbst ist die Bedienung
der Bedürfnisse wenn diese
schwach in der Wahrnehmung
hart in allen Devisen
versehen mit blinden Bandagen
aber ohne Diesel bitte
Das geht so nicht
das rechnet sich nicht
das geht sich nicht aus
nicht aus aus aus
Aber ohne Bedürfnisse sind wir
aber ohne Bedienung brauchen wir
aber wir haben doch
aber wir sind ja
doch immer
allein
Andrea Nagy
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
08 | Seitenstechen - Zwei Collagen
Je ein Satz aus jedem Beitrag der Literaturzeitschrift Seitenstechen #1 & Seitenstechen #2 – zufällig ausgewählt, sinnig aneinandergereiht, einen neuen Text ergebend:
#1: Seefahren macht besser
Madam kocht schlechtes Essen, Sami spielt Klavier, mit den Kavalieren tanzen wir, da an der Nordsee nicht viel passiert, haben wir drei Mal Sex am Tag. Blow, boys, blow … Knut schwingt den Fang an Bord. Auch er trägt einen Bart. Er schwenkte einen Bananensack in der Hand. Er rief seine Gefährten und zeigte nach dem Baum. Die Matrosen, klein wie Miniaturfiguren, laufen über die Hängebrücke an Land. Einige nackte Männer und Sonnenschein, ein Hundebellen, ein landendes Flugzeug. Der Mond geht auf und unter und an Deck pennt die Wache. Die Wehrmacht zog sich von der Küste zurück.
Danach segelten wir wieder auf das Kap der Guten Hoffnung zu, denn wir waren davongesegelt wohl tausend und vierhundert Meilen.
Wir sind doch unterwegs, es heißt »Wir«, schon richtig! Mein Kompass schlug aus. Die Nordsee vor mir wird lebendig. Im Licht der Ägäis versinkt die Britannic. Die Schreie des Sturms sind zu hören, sonst ist es still an Bord. Das Schweigen dauerte. Wenn der Kopf in den Korb fällt, ins blutgetränkte Stroh. Manchmal holt er das Boot aus dem Versteck: Wir steigen aus.
Und wie der stürmende Wind in die trockene Spreu auf der Tenne ungestüm fährt und im Wirbel sie hiehin und dorthin zerstreuet, also zerstreute die Flut ihm die Balken.
Da schlug uns der Wind wieder in die See, da rauft sich der Schiffsmann und schrie. Und mit einem krampfhaften Schauder und geschlossenen Augen hielt ich ihm endlich die verbleibenden Splitter hin. Aber er hat ja den Wind und der weht ihm lindernd ins wettergegerbte Gesicht. Diese Erkenntnis ließ sie wieder ein wenig die Fassung erlangen. Auch sie muss ich verlassen, denn es treibt mich, treibt mich weiter. Ein weiteres Fässchen im Fernrohr, und ich wäre gerettet!
Mit mächtigen Gliedern ein dämmriges Grün. Starr von Salz.
Mit: Akkordeon // Artmann // Burgholzer // Dürer // Fock // Glatz // Hartge // Heckmann // Heym // Hielscher // Homer // Jeschke // Jona // Kern // Klabund // Kramer // Krautwurst // Krömer // Patten // Poe // Rathenow // Ringelnatz // Roth // Rubey // Said // Schloyer // Schwandt // Springer // Tennyson // Wawerzinek // Wigfall
#2 Dunkle Energie
Was sollte ich denn erzählen? Der denkende Mensch dichtet sich die Zeilen zusammen.
Genießt das Hiersein in der einzig feuerfesten Zone. Verbrennt man ein Korn Weihrauch, so wird sich ein wenig Rauch bilden. Quanteneuphorie zerbirst zu Feuerwerken. Purpurnen Rauch, wir inhalierten ihn. Mir kam es vor, als hüllte uns eine Wolke ein, leuchtend, dicht, fest und glatt, fast wie Diamant, auf den die Sonne fällt. Sonne, von der alles herrührt.
Er begegnet Menschen, er spricht mit ihnen, er liebt sie. Zulassen wird es auch, dass etwas anderes in ihm ist oder geschieht. Alles von dir hergeben, nie fragen, das Monster sein, vor dem du jeden warntest. Das Ziehen des Hungers dehnt die Därme. Ein wechselvolles Schicksal hat er hinter sich, und man kann durchaus nicht sagen, dass er nun tot sei. Die Zombies, denen wir begegneten, grüßten freundlich, wie wir trugen sie weiße Helme.
Let us honour the atom, so lively, so wise and so small. Wenn nun aber schlechthin alles die Möglichkeit hat, nicht zu sein, so war auch einmal nichts. Daher nannten sie, in der Überzeugung, dass der erste Körper etwas anderes sei als Erde, Feuer, Luft und Wasser, den höchsten Ort »Äther«. Unsere Welt würde so als eine Welt verstanden werden, in der etwas wirklich passiert.
Geschehen und angesiebt nicht, dicht, dimmend, stark. Tiefer immer tiefer sprengt mich das Dunkel. Aus dem Rumpf eines Traumes jedoch strömt in langen Wellen das Licht erloschener Sonnen, ein Reflektieren bricht aus dem nachtschwarzen Käfig. Dennoch weiß ich nicht, wie sein in diesen Räumen erfüllt von Gegenlicht. Ziellos trieb die Erde durch die Galaxis.
In der ursprünglichen Einheit des ersten Dinges liegt die Ursache aller Dinge, mit der Anlage zu ihrer unvermeidlichen Vernichtung. Die Treppe bricht ab, alle fallen. Sie gingen ein wie Primeln. Kurz, verschont war niemand, when the fire alarm three blocks further ticked off that evening yet again. Haben wir also mit Recht von einem Himmel gesprochen oder war es richtiger, von vielen und unendlichen zu reden?
Existenz ist schon ein bedeutsamer Hut! Sie hat gründliche Arbeit geleistet, seht euch nur dieses zerknüllte Märchen an, das war unsere Geschichte. Wiederum hat Gott sich erübrigt.
Mit: Aquin // Aristoteles // Arnold // Brandt // Byron // Chobot // Dante // Draesner // Ecker // Einstein // Falberg // Frings // Galilei // Görlach // Grünbein // Hartge // Holbein // Jørgensen // Kappel // Kienitz // Kraft // Lemaître // Lukrez // Maxwell // Piekar // Platon // Poe // Schrott // Solaris // Stachler // Steigenberger // Trunschke // Woelk
>> Seitenstechen-Collagen-Doppelseite <<
Seitenstechen
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:










