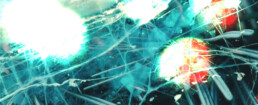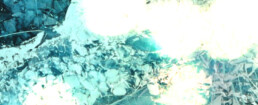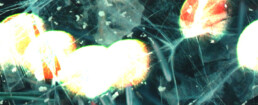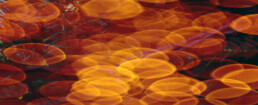16 | Suse Schröder
Deswegen
Die Ausflüge mit Vater kann ich an zwei Händen abzählen, die die ich genossen habe, an einer. Der, an den ich mich am deutlichsten erinnere, gehört zur einen Hand. Zu diesem trug Vater einen Anzug. Seit diesem vermeide ich Rummelplätze, obwohl sie zu meinem Familienerbe gehören und ich mich zu ihnen hingezogen fühlen sollte.
Vater war grob und groß. Hätte ich mich als Sechsjährige auf Mutters Schultern gestellt, hätte er mich auf die Stirn küssen können.
Er wollte eine wilde Tochter, eine Starke, die zupackte, Dinge weiß und klarkommt. So konnte ich mit fünf Jahren einen Reifen flicken, eine Schubkarre voller Mist zum Kompost fahren und auf die höchsten Bäume klettern. Aber vor Achterbahnfahrten graute mir und das wusste er. Das wollte er nicht akzeptieren, dass es etwas gab, wovor ich Angst hatte.
An einem Winternachmittag nahm er meine Hand in seine, zog mich zum Auto und fuhr mit mir zur Festwiese. Von Weitem grüßte uns das Riesenrad.
Ich seufzte glücklich, als Vater sagte: „Wir machen alles, was du willst, aber am Ende fahren wir Achterbahn.“ Ich schluckte, hörte aber schon den Losbudenbesitzer plärren und sah die Liebesäpfel glitzern. Vom Autoscooter schallte Haddaways What is Love? Und mir zuckten die Beine. Ich biss mir kurz und kraftvoll in den Handrücken, bevor ich fragte: „Alles was ich will?“
„Ja“, sagte Vater ohne zu überlegen und da willigte ich ein. Vom Bratwurststand aus verschafften wir uns einen Überblick. Fett tropfte vor uns auf den dürren, ausgetretenen Rasen. „Dann los!“, sagte ich mit vollen Backen und wir schlenderten zum Kettenkarussell. Danach mit Lebkuchenherz vor der Brust zum Autoscooter, wo wir uns ein wildes Duell lieferten und das „Bitte keine Frontalzusammenstöße“ aus dem Lautsprecher überm Kassenhäuschen überhörten. Mehrmals knackte mein Nacken beim Zusammenstoß, die ganzen zwei Minuten über kicherte ich, dass mir der Bauch schmerzte. Am Süßigkeitenstand ordneten wir unsere Glieder und ließen unser Lachen verebben. In Vaters Bart verfing sich Zuckerwatte unterm Kondenswasser, mir klebte Liebesapfelrot am Kinn, als ich ihn zur Ponymanege zog. „Nein“, entfuhr es Vater, „bitte nicht.“
„Du hast es versprochen“, sagte ich siegesgewiss und zwinkerte der Ponyfrau zu.
„Außerdem… bin ich zu schwer.“
Da trat die Frau mit einem struppigen, gescheckten Pony an seine Seite: „Rudi schafft das“, sagte sie und übergab Vater das Pony. Aus seinen Nüstern stob weißer Dampf gegen die Kälte an. Ich schwang mich auf den Rücken von Lena und wir drehten unsere Runden im Oval. Andere Mädchen schleppten ihre Eltern zum Gatter, baten und bettelten ihre Väter an auch eine Runde mit ihnen zu drehen, als die Ponyfrau Rudi einen Klaps auf den Hintern gab und er einen Sprint hinlegte, bei dem es Vater fast aus dem Sattel warf. Mit zerzausten Haaren und einem Entsetzen im Gesicht warf er sich seitwärts ab und landete auf den Knien. Ich lachte scheppernd. Die Ponyfrau hingegen half Vater auf: „Sie haben sich wacker geschlagen!“
Er richtete sich auf, klopfte den Matsch in seiner Anzughose fest und deutete auf mich: „Heute bestimmt sie, aber am Ende fahren wir Achterbahn.“
Ich schluckte und hielt Ausschau nach einem weiteren Fahrgeschäft, einer weiteren Leckerei. Die Rummelplatzbahn, die sich durch die Stände und Fahrgeschäfte schlängelte, fiel mir noch ein. Als wir die Strecke abfuhren, wurden die Lichterketten und Lampions angeknipst. Verwunschen leuchteten die Plastikgeschenke, Losbudenpreise, Karusselle.
„Schießbude“, sagte ich nach dem Ausstieg, aber der Besitzer schüttelte den Kopf. „Erst ab acht, Mädchen ab zehn.“ Wütend tippte ich mir an die Stirn. Vater schlug Entenangeln vor, aber es gab nur Aale zu greifen. Tatsächlich gelang es mir, zwei glitschige Aale aus dem Becken zu werfen. Wie ein Rosenbouquet muss ich sie im Arm getragen haben, so stelle ich mir das heute vor. Danach drehte ich mich einmal langsam im Kreis herum, wollte das Ende hinauszögern. Vater zündete sich eine Zigarette an: „Komm“, sagte er. Er hatte ja recht. Ich kniff die Augen zusammen und hielt die Luft an als er zum Kassenhäuschen trat. „Ich kann nicht“, sagte ich und presste mir meinen Unterarm in den Bauch, im anderen Arm die zappelnden Aale. „Komm, versprochen ist versprochen.“
„Und Angst ist Angst“, schluchzte ich lauter. Vater motzte und meckerte, löste dann einen Jeton für sich und bretterte die Strecke mit Loopings und Schrauben entlang. Begeistert, mit roten Wangen und einem breiten Grinsen entstieg er seinem Waggon. Danach erst erfuhr ich, dass mein Großvater zum fahrenden Volk gehört hatte. „Bei einer Testfahrt, sie hatten es bis nach Budapest geschafft, ist er mit seinem Waggon aus den Schienen gerasselt. Er verstarb noch im Krankenwagen. Deswegen!“, sagte Vater und wischte sich das Grinsen aus dem Gesicht. Schweigend fuhren wir hinter beschlagenen Scheiben zurück in die eigenen vier Wände. Seitdem stelle ich weiterhin unbeantwortete Fragen zu jeder Familienfeier, den Geburtstagen und beim Weihnachtsschmaus und bleibe Dauergästin in Archiven. Von einem Achterbahnunfall in Budapest lässt sich nichts finden.
.
Suse Schröder
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
13 | Avy Gdańsk
Landflucht
Ich hatte das Schlimmste befürchtet: den Sommer. An Land war es zu trocken, trockener noch als im Vorjahr, die Erde ein schuppiges Reptil. Ich suchte in überfüllten Schwimmbädern, unbeaufsichtigten Badeseen, felsigen Buchten – in meinem Kopf lächelten schon die Krokodile. Die Suche fast wie unsere Kindheitsspiele, nur todernst. Erst am Ende der Woche verriet mir Cepha verschämt, dass sie zuletzt in der Anlage gewesen waren, wo ich Konve endlich fand – nackt, nass und erzählbedürftig. Ich hörte zu.
„Am Tag vor der Schließung feierten wir Erans 19. Geburtstag im Camp Brium, der alten Zeiten zuliebe. Wir waren die letzten Gäste. Für zwei Stunden als Tier eine Schnitzeljagd im Team machen – damals ist das eine Weltneuheit gewesen. Sie haben ihren Standard nie erweitert, du kennst das ja noch: Man kann sich nichts aussuchen. Vermutlich lief das Geschäft darum eher schlecht. Es gibt nur sechs Tiere, jedem wird eins zugewiesen. Du wolltest immer ein Rauhfußhuhn sein, Thyst, und jedes Mal musste ich dir erklären, dass keins dabei war. Kein Haselhuhn, kein Birkhuhn und kein Auerhuhn. Die waren damals schon fast ausgestorben. Doch daran dachten wir nicht. Wir hatten nur unsere eigenen Probleme vor Augen und welche Tiere wir gerne wären. Aus mir machten sie den Trilobiten. Ausgerechnet.
Wir suchten uns in den Regalen unsere Utensilien zusammen – sie führten auch Erwachsenengrößen – und ich fand den Panzer nicht. Fühlte mich wieder wie in der Schule, die wir erst abgeschlossen hatten. Nervöses Fingerkuppenreiben, Herztrommeln, Angstschweiß. Ich fragte mich, wie ich als Trilobit all die Aufgaben lösen konnte. Warum ich nicht ein Flugtier oder eins mit Krallen und Zähnen hätte sein können, so hätte ich mich sicherer gefühlt. Aber mir blieb nur das Exoskelett, dass ich dann auch aus der letzten Reihe hervorzog, schon ganz abgenutzt von zig vorigen Geburtstagen. Stromlinienförmig. Wer das wohl schon getragen hatte. Egal. Ich musste hineinschlüpfen und das Spiel begann.
Für zwei Stunden verloren wir jede Sprache, sodass ich die Ereignisse nur rückblickend aus Menschensicht widergeben kann. Meine Erinnerung besteht aus Sinneseindrücken und Intuition. Im ersten Moment gab es noch Erleichterung. Ich musste die subtilen Gemeinheiten der Gruppe nicht ertragen, in deren Rangordnung ich am niedrigsten war. Ich ließ die Blicke von Sagitt, Cepha, Versal, Eran und Robe an meinem Panzer abprallen, doch ihre Tieraugen hatten den Spott ohnehin verlernt, ihre Lippen das hämische Grinsen. Ein Marder, ein Chamäleon, eine Elster, eine Vogelspinne und ein Gürteltier standen auf einer Urwaldlichtung. Ihre echten Namen hatte ich schon vergessen. Wir stellten uns einer neuen Unfreiheit. Dann hieß es losziehen.
Tapire preschten aus dem Gebüsch. Die Spur der Rüssel unser erster Hinweis. Wir krabbelten, flogen, kletterten hinterher. Ich als Schlusslicht. Kannte das Spiel schon, hatte aber vergessen, was als Nächstes kam. War ja Trilobit. Doch ich sag dir was: Selbst Trilobiten können sich unnütz fühlen. Merken, wenn sie überflüssig sind.
Die Elster schrie, der Marder keifte und die Spinne stridulierte. Sie hatten etwas entdeckt, während wir Übrigen mit unserer Stimmlosigkeit haderten. Damit hatten die anderen zwei mehr zu kämpfen als ich.
Etwas steckte im Boden, gehalten von der Erde, die einfach nichts loslassen mag. Das besitzergreifendste Element. Wir machten uns daran, ihr das Objekt zu entringen: Das Chamäleon hielt es fest, der Marder fing an zu graben und sogar Elster, Vogelspinne und Gürteltier scharrten mit. Nur ich – kein Tunnelgräberexemplar – konnte nicht mithelfen. Niemand warf es mir vor. Sie vergaßen mich einfach.
Die Einsamkeit der Urzeittiere ist schön, weil schnell verflogen. Ehe sie ernst wird, überfällt einen der Überlebenskampf und schenkt einem gnädigen Tod oder gnädige Ablenkung. Ein treuer Begleiter in der Natur, der auch mich nicht im Stich ließ, denn schon fiel mich etwas anderes als Trübsal an.
Ein Maul. Feuchte Atemfluten. Und ich schreiunfähig. Angstapparat. Die fünf grabenden Tiere schauten auf. Eingezwängt zwischen Blicken und Zähnen stellte ich fest, dass niemand mir feind war: Das Primitive kennt keine Boshaftigkeit, nur Hunger. Warf mich voll Futtervorfreude hoch – und verlor. Denn ich landete im Wasser,
In den Zellen dumpfes Ich, kannte das Wasser, war sein Wesen, urvertraut. Plötzlich war ich leicht und beweglich – war ganz in meinem Element. Das Element, das der Erde ständig abrang, was sie besaß, und es ihr als Zerriebenes wieder zuführte. Die Wellen ahnten es an mir. Und ich, Thyst, brauchte kein Wofür, ich schwamm einfach und war bereit, es mit dem Tod aufzunehmen, als Spiel und Ziel zugleich. Du meinst, Zweck kann keinen Sinn ersetzen? Denk an die Spiele im Camp Brium, an den Rausch, wenn man sich gerettet hatte. Der Spaß der Aufgabenlösung. Gefahr oder Vergnügen reichen vollkommen aus, ein Leben zu füllen.
Die Gruppe war verschwunden, als ich auftauchte. Auch das Beutetier hatte sich verzogen. Nach Ablauf der zwei Stunden fühlte ich den Druck des Menschseins und musste ihm nachgeben, schlüpfte aus dem Panzer. Ich ließ mich in den Farn fallen wie angespült.
Erst hing ich noch dem Wassergefühl nach, dann kamen die Worte. Belegten meine Erfahrung, als hätten sie die Plätze reserviert – bestuhlte Wildnis: Zivilisation. Das brachte mich auf den Gedanken, wo die anderen blieben. Ob sie Erans Geburtstag wie früher am Steg ausklingen ließen, am Weiher, lachend wie Krokodile. Ich musste feststellen, dass ich auch ihrem Sinn entglitten war, als sie mich aus den Augen gelassen hatten.
Du kannst dir vorstellen, wie wütend ich war – doch als sie drei Stunden später auftauchten, um nach mir zu suchen, sah ich ein, was mich notwendig machte: Ohne mich geriet die Dynamik durcheinander, ohne mich schwand ihr Zusammenhalt. Konnten sie nicht mich angreifen, taten sie es gegenseitig. Ich hatte es aber satt, zum Zweck ihrer Sättigung zu existieren. Darum beschloss ich, unangenehm zu werden: Ich starb aus. Jedenfalls war meine Unauffindbarkeit für sie damit gleichbedeutend.
Ich wusste, so entstünde bei ihnen keine neue Weltordnung – sie würden sich jemand anderen suchen. Aber ich konnte hier am Gewässer in der verlassenen Anlage etwas Neues werden. Ausschwemmen, was mir nicht bekam. Den Panzer behielt ich, doch eine Rückverwandlung war nicht mehr möglich – die muss am Eingang durch die Betreiber autorisiert werden. Die hatten schon Feierabend gemacht und überließen mich meiner Evolution.
Ich musste viel an dich denken, Thyst. Habe viel Zeit im Wasser verbracht, um mich mit ihm zu verbrüdern. Habe mir gesagt, wenn ich schon nicht die Rauhfußhühner für dich hab retten können, dann rette ich wenigstens uns. Das Meer rückt nah an uns heran, sein Ellenbogen stößt uns in die Seite. Weg von der kokelnden Erde. Ich war in dieser Woche lang im Wasser, und schau, schon werde ich weich, schon werde ich weniger kalt. Meine Hände: Abschiedsflossen. Es führt ein Weg zurück.“
Konve nahm mich mit schwammigen Fingern und zog mich zum Rand. Ich bewegte mich einfach. Folgte dem Wort. Wasser war Gesang, ich war Körper – ein Ballsaal für Schwingung. Angezogen von der Melodie. Spielsüchtig. „Tauch ein. Geh unter.“ Ich verfiel meinen Sinnen.
Badeanzug aus Kaulquappen und weiches Algenhaar. Augen treiben wie Flöße über den Weiher und Haut ist Strand, an den die Wellen schlagen. Die Kussgeräusche der Kois versteckt hinter Barteln. Wasser ist Wollen. Körper bedeckt von Begierde bis über die Ohren. Ein wässriges Röcheln das Rinnsal hinunter zum Rand, schilfskolbdurchstochene Enden. Hier ist das Wasser festgenagelt, mit diesen langen Röhren, hier wandelt es sich in Morast. Tauchgang der Worte zum Grund, ein Mundvoll von schwappender Zunge. Das Wasser trägt den Himmel auf den Flächen, die Luft kippt aus den Zweigen in den Pfuhl.
Die Kuppen der Finger streicheln mal Wind und mal Nässe, am Morgen feuchte Reigen aus Gespenstern, am Abend einen Wattegeisterzug. Landunterlippen lesen Kreise aus dem Wasserläufertanz: sprunghaftes Ballett. Wünsche werden Blasen, die ans Oben denken, wo die Sonne sie mit Nadelstrahl zersticht. Die Steine tragen grünes Fell und Halskrausen aus Froschlaich. Blätter geistern wie Barken zum anderen Ufer.
„Spürst du die Urtümlichkeit, die es braucht? Nur, was es schon gab, bleibt bestehen. Wenn alles gut geht, verstehst du mich bald nicht mehr.“
Fleischbad. Moosleib. Das Grün brennt die Beine hinauf. Gliederkerzen. Arme glühen im Dunkeln. Weite Geste gestern noch. Lösen sich nun aus der Form. Wachsfigur. Quallenmensch. Quellentier. Es geht zurück.
Konve spricht. Ich verstehe.
.
Avy Gdańsk
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
11 | Christina König
Finderlohn
hast du schon mal kaiserschmarrn mit eierlikör gegessen
hey es ist das beste
am weihnachtsmarkt gibts da so einen stand
da haben sie so was
ich könnt mich dort fett fressen
beim nächsten mal gehen wir da hin
ich bekehr dich schon
Schlumpfblaue Augen tanzen durch den Raum, vom pseudo-antiken Kronleuchter über Salz und Zucker bis zu mir. Überschminkte Sommersprossen sprenkeln ihre Stirn, drei Muttermale wandern über ihre Wangenknochen wie Orions Gürtel und unter ihr Ohr ist eine Taube tätowiert. Hinter den geschlossenen Fenstern präsentieren die Schneeflocken ihr russisches Ballett und sie streckt ihnen die Zunge heraus: Sie hasse den Winter, immer sei es so kalt, sie wolle endlich wieder Sommer; ich schiebe ihr meinen Cappuccino hin, sie trinkt dort, wo vorher meine Lippen die Tasse berührt haben, und draußen rauscht ein Rettungswagen mit Blaulicht vorbei. Hinter ihr schält sich die türkisblaue Tapete ab. Dunkle Wandfarbe mit seltsamen Mustern kommt darunter zum Vorschein.
und dann sagt der ernsthaft zu mir
na dann müssen sie halt länger bleiben
das kann ja wohl nicht das problem sein
hallo gehts noch
soll ich meiner tochter sagen sie soll im kindergarten übernachten oder was
und ihr papa
also mein ex
der ist so nutzlos
den brauch ich wegen abholen gar nicht fragen
das nervt mich alles schon so
Das Kunststück aus Schokolade, Creme und Erdbeeren landet auf dem Imitat eines japanischen Tellers neben ihrem Ellbogen. Ihre Gabel taucht hinein, gräbt die erste Erdbeere aus wie ein Bagger und fliegt zu ihrem Mund. Das zweite Stück überlässt sie mir, ein Klecks Creme bleibt an meiner Unterlippe hängen und sie tupft ihn mit dem Daumen ab, betrachtet die Fingerkuppe und leckt sie ab. Eine Zitronenscheibe sprudelt im Sodawasser, Blasen steigen an die Oberfläche und rosa Lippenstiftfasern hängen am Glasrand. Goldringe blitzen auf, sie dreht meine Handfläche nach oben und liest meine Zukunft heraus; sie bescheinigt mir zahlreiche Liebschaften und ich sage nichts. Manchmal berührt ihr Fuß mein Bein.
der letzte
o gott
der war eine katastrophe
na in einer beziehung sind wir doch nicht
warum ist das nicht wurscht wenn ich lieber pornos schau als dass ich mit dir schlaf
und wehe du verlangst dass ich mal nicht zu spät komm
emotionally unavailable
ich schwörs dir
Ihre Hand dreht die Schneewittchenhaare um die Finger wie eine Spindel, Kerzenlicht verfängt sich darin, der Kleeblatt-Anhänger an ihrer Halskette oxidiert und ich lächle. Sie weiß von nichts. Denkt immer noch, wir hätten uns zufällig kennengelernt. Als hätte ich einfach so ihre Geldtasche gefunden und zurückgegeben. Ihren Retter aus der Finanzkrise hat sie mich genannt, mir ein fast volles Säckchen Trüffelpralinen überreicht, das sie aus einer Büroschublade geklaut hat, und die Geschichte unter dem Hashtag #weihnachtswunder auf Instagram gepostet. Alle ihre Freundinnen haben kommentiert, wie viel Glück sie gehabt habe, sie redet von Schicksal und Karma, unsere Teller sind leer, die Rechnung flattert auf die Tischplatte und sie greift nach ihrer Tasche, Finderlohn, sagt sie, und ich lege meine Hand auf ihre; ich mach schon. Ihre Ringe und neongelben Nägel verschwinden unter meiner Hand, ich drücke kurz und sie lächelt. Ihre Stiefel klackern auf dem Marmorboden, ihre Hüfte streift mich und wir treten hinaus in den wirr verschneiten Winterabend.
.
Christina König
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
9 | Enno Ahrens
Uhr-ige Weihnachten
Mutters hölzerne Tischuhr, die ihren Platz auf dem Wohnzimmerschrank gehabt hatte, war kurz vor Weihnachten stehengeblieben und zwar just in dem Augenblick, als ein Löffelverbieger, eine Art Uri-Geller-Verschnitt, im Fernsehen experimentierte.
Nun war unsere Verwandtschaft heftig am Diskutieren, ob es sich um einen Zufall gehandelt hatte oder ob es tatsächlich diesem mysteriösen Medium zuzuschreiben sei. Das Uhrwerk zu reparieren lohnte sich jedenfalls nicht mehr.
Heiligabend waren Opa, Tante Adele und ich dann bei Vater und Mutter eingeladen. Ich brauchte noch ein Weihnachtsgeschenk für Mutter. Es lag auf der Hand, mich für eine Uhr zu entscheiden. Aber was würden Opa und Tante Adele tun? Ich besann mich darauf, als Einziger der Runde Schachspieler zu sein, und die denken ja bekanntlich weiter. Die anderen würden vielleicht überlegen, eine Uhr zu wählen, dann aber sicher darauf verzichten, um der Peinlichkeit aus dem Wege zu gehen, ein zweiter oder gar dritter könnte gleiches tun. Also würde ich gerade deswegen eine Uhr schenken. Ein Schachspieler denkt eben weiter.
Exklusiv im Privatfernsehen wurde eine Porzellantischuhr angeboten, mit puttenähnlichen Figuren und feinem Goldrand verziert. Das gute Stück war originalgetreu einer berühmten Uhr aus dem siebzehnten Jahrhundert nachgebildet und in einer limitierten Auflage erhältlich. Ich war begeistert. Das musste genau das Richtige für Mutter sein. Ältere Leute mögen so etwas.
Heiligabend, wir sangen ein paar Weihnachtslieder, dann öffneten wir die Geschenkpakete. Vor Mutter standen drei Pakete gleicher Abmessungen, eins von Opa, eins von Tante Adele und eins von mir. Mutter packte eine Uhr nach der anderen aus, jede mit denselben wundervollen puttenähnlichen Verzierungen.
Zuerst schauten wir uns untereinander ziemlich betreten an. Aber als Vater anfing schallend zu lachen, trugen wir es mit Humor. Und ich gelangte zu der Erkenntnis, dass auch Nicht-Schachspieler weiterdenken können.
Wir trösteten Mutter, falls ein Uhrwerk nicht mehr exakt funktionieren sollte, hätte sie ja Ersatz. Die Uhr von mir wurde eingelagert, die von Adele bekam ihren Platz auf dem Flur und die von Opa auf dem Wohnzimmerschrank, wo die alte Tischuhr gestanden hatte.
Nach einem halben Jahr gestand Mutter mir, dass sie Porzellanuhren mit Putten kitschig fände, außerdem passten sie nicht zu ihren Möbeln. Sie verbannte sie an unscheinbare Orte in Bügelzimmer und Speisekammer. Nur wenn Opa oder Tante Adele ihren Besuch ankündigten, wanderten die Uhren geschwind auf ihre auserwählten Plätze. Ich fragte Mutter, ob ich die ungeliebten Uhren nicht auf dem Flohmarkt veräußern solle. Das lehnte sie entschieden ab, denn man dürfe keine Geschenke verhökern. Außerdem wären Opa und Tante Adele untröstlich gewesen.
Ungefähr drei Jahre gingen ins Land und die Uhrwerke der Porzellanuhren funktionierten nach wie vor mit beängstigender Präzision. Mutter befürchtete, sie würden ewig halten. Auf mein Drängen hin brachte Mutter die unverwüstlichen Zeitmesser endlich zum Trödler in die Geibelstraße. Der Verwandtschaft schwindelten wir vor, Mutter hätte die Uhren mit einem Spezialpflegemittel gereinigt und auf den Terrassentisch zum Trocknen gestellt. Dummerweise hätte ich an eines der Tischbeine meinen bulligen Rottweiler Bonzo angebunden, der bei der spontanen Verfolgung des Briefträgers den kleinen Tisch mitgerissen habe. So seien die Uhren jäh auf den Fliesen zerschellt.
Opa und Tante Adele meinten, so ein Missgeschick könne auch nur mir passieren mit meiner mangelnden Umsicht. Aber ich ertrug geduldig ihren Spott, hatte ich doch Mutter eine große Bürde genommen.
Heiligabend stand abermals vor der Tür. Diesmal kamen nur Opa und ich auf Besuch bei Vater und Mutter. Tante Adele musste mit ihrer Familie feiern. Ich wollte den leeren Platz auf dem Wohnzimmerschrank ausfüllen. Mutter zeigte mir eine Holzuhr in einem Katalog, die ihr gefiel und in deren Stil ich ihr eine schenken sollte. Opa war an jenem Heiligabend bereits morgens eingetroffen und begleitete mich in die Stadt, um ebenfalls noch ein Geschenk zu besorgen. Wir trennten uns bald im gegenseitigen Einvernehmen. Keiner sollte sehen, was der andere für Geschenke erwarb. Wir legten Wert auf Überraschungen.
Vater ließ abends den Tannenbaum im Lichterglanz erstrahlen. Wir sangen dazu, wie jedes Mal. Dann öffneten wir die Präsente. Mein Geschenk, eine schöne hölzerne Tischuhr, packte meine Mutter als erstes aus. Sie bekam sofort den zentralen Platz auf dem Wohnzimmerschrank. Opas drei Geschenke mit mir vage vertrauten Abmessungen, packte Mutter als nächstes aus. Im Nu standen drei gleiche Uhren aus Porzellan mit Putten vor ihr auf dem Gabentisch, die einmal in limitierter Auflage im Privatfernsehen offeriert worden waren. Opa triumphierte stolz. Er hätte möglicherweise die drei letzten Exemplare, die es auf dem ganzen Globus noch käuflich zu erwerben gegeben hätte, erstanden, und der Trödler in der Geibelstraße hätte ihm nicht gerade einen billigen Preis gemacht. Aber für Mutter sei ihm kein Opfer zu groß, und ich solle mich tunlichst von diesen Wertanlagen fernhalten.
Mutter machte indes ein Gesicht, als ob sie sich nicht schlüssig war, ob sie vor Verzweiflung lachen oder weinen sollte. Seitdem stand immer eine jener Porzellanuhren in der Glasvitrine im Esszimmer und ich hatte zuweilen das Gefühl, als grinsten die Putten mich hämisch an.
.
Enno Ahrens
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
8 | Alina Lindermuth
Vom Kleinsein
„Der Berg fordert gar nichts von uns. Nicht unsere Hingabe und auch nicht unseren Tod.“ [1]
Schneebedeckte Gipfel im Morgenrot, Blumenwiesen vor Kuhglocken-Orchestern, zerstäubende Wasserfälle im Zeitraffer.
Ich klappe den Laptop zu, schalte das Licht aus. Im Dunkeln sehe ich noch immer scharfkantig die Umrisse von Gebirgsketten an der Leinwand meiner geschlossenen Augenlider. Rieche taunasse Bergwiesen und spüre das Kratzen von heißem, trockenem Heu auf meiner Haut.
Am nächsten Morgen die übliche Intensität. Der Wecker zu schrill und zu laut, aber eigentlich nur zu früh. Eine Bluse aus dem Schrank ziehen und in die Business-Hose von gestern schlüpfen. Strümpfe nicht vergessen. Der Kaffee verbrennt meine Lippen und seine Bitterkeit trägt wenig zu Stimmung bei. Ich hätte früher schlafen gehen, die Dokumentation nicht bis zum Ende ansehen sollen.
Dazu schmiere ich mir ein Honigbrot wie jeden Morgen. Aber heute ist die Butter aus. Und ihre Abwesenheit nimmt dem Frühstück seine ganze Seele. Egal, die Zeit läuft, das erste Meeting ist für acht Uhr angesetzt und ich bin noch immer dabei, die Honigreste mit trockener Zunge von meinen Fingerspitzen zu lecken. Im Bad ziehe ich mir die Augen nach und am Weg zur die Tür hinaus den Blazer über die Schultern. Es ist Zeit!
Die Stimmen des Ö1-Morgenjournal vermischen sich mit dem U-Bahngemurmel. Ein weiteres innenpolitisches Fiasko zum Fremdschämen jagt ebenso pausenlose weltpolitische Unruhen zum Kopfschütteln. Aber: Grünes Licht zur Einführung einer globalen Mindeststeuer für Großkonzerne. Und vor allem: Es wurde eine neue Paradies-Vogelart entdeckt.
Im Büro herrscht die typische, erwartungsvolle Spannung. Fast so, als würde heute, morgen oder spätestens nächsten Mittwoch wieder etwas ganz GROßES passieren. Oder erreicht werden. Oder eher: Erreicht werden müssen.
Am hochgestellten Schreibtisch beim Fenster, wahlweise mit Blick auf Stephansdom oder Kahlenberg, verbinde ich meinen Laptop mit den Bildschirmen und stelle mich breitbeinig und gut geerdet hin. Mein Postfach ist schon hochaktiv und lässt die neuen E-Mails herein. Erst eins, zwei, drei… dann immer mehr. Wie kleine unbeabsichtigt losgetretene Steinchen, die sich zusammenschließen und als große Masse ins Tal rauschen. Aber ich stehe geerdet wie ein Murenbrecher vor dem Tisch und konsolidiere das Tal der Gesamtsituation mit schneller Reaktion. Das ist übrigens Teil der Job Description. Nur ohne Muren-Metapher.
Der erste Schwall von E-Mails ist nun zumindest kategorisiert, es ist acht Uhr und Zeit für das Meeting. Zwei Kollegen sitzen schon im Glasraum. Wir holen Kaffee und starten ein gemeinsames Brainstorming für den neuen Kunden, der eine Strategie für die Zeit nach Corona braucht. Eventuell auch ohne Corona gebraucht hätte.
Wir diskutieren, recherchieren und skizzieren Ideen am Whiteboard. Es prickelt unter der Kopfhaut und in den Fingerspitzen. Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit, Ergebnisse zu liefern: Bis zum Abend muss ein Konzept stehen. Und beim ersten Blick auf die Uhr ist es schon weit nach Mittag.
Später stehe ich wieder am Schreibtisch und spüre, dass die Spannung steigt wie der Luftdruck in einem am Herd vergessenen Kelomat. Sie korreliert exakt mit dem Vergehen der Zeit. Aber: Wir schaffen das schon. Wir können das schließlich. Wir sind ja auch hier, weil wir das können. Und darum: Müssen wir das schaffen. Eine Alternative ist nicht angedacht.
Nach zwei anderen Meetings, einem weiteren Kaffee und Stunden sitzend und stehend am Schreibtisch ist das Konzeptpapier fertig. Es ist nicht schlecht, aber auch noch nicht so gut, dass ich es der Chefin schicken könnte. Die meisten anderen sind entweder schon zu Hause oder still an ihren Arbeitsplätzen. Draußen stockfinster, beim Blick hinaus gibt es um diese Uhrzeit keine Auswahl mehr.
Irgendwann übersteigt die Müdigkeit den Drang nach Perfektion und ich sende den ersten Entwurf ab. Dann bin ich schon draußen in der Nacht und warte auf die U-Bahn, drei Minuten bis der nächste Zug kommt. Ich schließe die Augen und öffne sie gleich wieder, denn an den Augenliderleinwänden sehe ich ein wildes Gewitter aus Zahlen, Wörtern, Diagrammen. Und ich fühle mich dabei wie im Hochgebirge. Mit Business-Outfit. Ohne Biwak. Gefährlich weit oben.
Zu Hause durchlaufe ich die gleichen Schritte wie am Morgen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Blazer ablegen. Kleidung abstreifen. Ins Bad. Beim Essen piept mein Handy mit einer Erinnerung: „Morgen, Samstag, Abfahrt um 7:32“
Das Bergfest! Morgen? Nein, erst nächsten Samstag! Morgen? Ich durchforste meine Mails, die Nachrichtenverläufe in der WhatsApp-Gruppe, meinen Kalender. Und tatsächlich. Ich habe mich in der Woche geirrt. Dabei brauche ich den Vormittag für das Konzept. Schnell packe ich einen Rucksack und überlege dabei, wie viel Zeit mir im Zug noch bleiben wird. Im Bett schlafe ich augenblicklich ein, endlich ist die Leinwand finster.
Still gleitet Österreich an mir vorüber. Zuerst noch Stadt. Dann Vorstadt. Dann endlich Land. So ruhig ist es im Zug um diese Uhrzeit. Hügel. Fluss. Dorf. Kleinstadt. Hügel. Ausläufer von etwas Großem.
Eine gute Atmosphäre, um zu Arbeiten. Wie erwartet hat mir die Chefin ihre Kommentare geschickt. Wann sie das gemacht hat, bleibt fraglich. Ich arbeite konzentriert, es bereichert, wenn man beim Überlegen weit in die vorüberziehende Ferne schauen kann.
Kurz vor der Ankunft blinkt das Akkusymbol am Laptop auf. Beim Griff in den Rucksack finde ich kein Kabel. Zehn Minuten später ist der Bildschirm schwarz aber das Konzept unfertig zurückgeschickt. Und draußen der Himmel tiefblau.
Ich fahre weiter mit dem Bus. Dann werde ich abgeholt. Von alten Freunden. Wie jedes Jahr. Noch vor dem Umarmen ist alles wieder so wie in der Volksschulzeit. Die meisten von ihnen sind hier geblieben. Wir sehen uns wenig. Aber eben mindestens einmal im Jahr.
Die letzten paar Hundert Meter steigen wir zu Fuß auf. In den Händen Taschen voll Essen und Kisten voll Bier. Und dann sind wir oben, die Hütte ist schon eingeheizt, ein paar sind vorausgegangen und haben alles aufgebaut.
Ich schmeiße meinen Rucksack ins Bettenlager und schaue auf mein Firmenhandy. Keine neuen Nachrichten. Die anderen verdrehen die Augen, ich schalte das Handy schnell aus und schiebe es zum Laptop ganz unten in den Rucksack.
Und dann sprudelt der Nachmittag über mich hinweg, erfrischend wie eine klare Bergquelle. Nasses Gras unter den Fußsohlen, ein Glas Bier in der Hand, vertraute Stimmen im Ohr. Und all die alten Geschichten im Kopf, die wir uns jedes Jahr wieder erzählen, ausgeschmückt oder verkürzt, je nachdem, von wem sie gerade erzählt werden. Einer spielt Gitarre und die meisten singen mit, obwohl niemand wirklich singen kann. Die Hitze der Sonne brennt auf der Haut. Ich helfe beim Grillen und wende das Fleisch vom Bauern aus unserem Dorf.
Beim Schälen der Erdäpfel sitzen wir in kleinerer Runde und sprechen über das, was uns zur Zeit bewegt. Und als ich erzähle, habe ich das Gefühl, es bleiben mit jedem Satz mehr Fragezeichen zwischen den Erdäpfel-Schalen liegen. Die „Wies“ zu beantworten ist noch am leichtesten, die „Warums“ schon wesentlich schwerer. Und bei den „Wozus“ gehen mir schließlich die Antworten aus.
Aber dann plätschert der Tag weiter und der Erdäpfelsalat muss nur noch durchziehen. Wir sitzen zusammen und klauben mit den Zehenspitzen Alpenblumen von der abschüssigen Wiese. Ich lasse mich treiben, durch diesen Nachmittag, durchwegs vor der Kulisse meiner Berge.
Frühmorgens erwache ich im Bettenlager, um mich herum schlafende alte Freunde, schwaches Dämmerlicht fällt durch das winzige Fenster unter dem Giebel. Obwohl ich so müde bin, als hätte ich Wochen nicht geschlafen, steige ich aus den warmen Decken und schleiche auf leise knarrenden Brettern zur Tür. Alles noch ruhig, keiner ist aufgewacht.
Ich nehme eine fremde Jacke, finde meine Schuhe und trete vor die Hütte hinaus. Noch keine Sonnenstrahlen über der Welt. Rund um die Hütte ein paar Flaschen, ein paar Teller, das meiste schon ordentlich zusammengeräumt. Dazwischen einige von der Bergnacht nasse Seiten Papier, auf denen ausgedruckte Liedertexte verrinnen.
Ich gehe um die Hütte und steige langsam den schmalen Pfad dahinter hinauf. Müde. Schritt für Schritt. Und schwer. Aber dann komme ich auf den kleinen Platz unter den steil aufragenden Felswänden, mit einem phänomenalen Blick über das Tal.
Ich setze mich auf einen Stein und warte mit meinen Augen am Horizont auf die Sonne. Ich lege den Kopf in den Nacken und blicke die senkrechte Wand hinauf. Spüre den kleinen kalten Stein unter mir, der wohl vor langer Zeit Teil dieser Wand gewesen ist.
Rundherum so viel Weite. Keine neue Weite. Ich kenne sie seit Kindertagen. Und trotzdem: Sie fühlt sich jedes Mal wieder an wie eine neue Perspektive.
Und plötzlich bin ich bin so unglaublich klein. So klein.
In Anbetracht dessen, was um mich ist.
Und dann, mein Blick noch immer am Horizont, fällt der erste Sonnenstrahl auf diesen Tag, fällt über das Tal, über die Gipfel und über die Felsen. Fällt auf mein Gesicht, meine Pupillen, fällt durch mich hindurch bis auf die Netzhaut. Ich schließe die Augen und sehe das, was wirklich ist, durch meine Augenliederleinwände hindurch. Nämlich das, was wirklich GROß ist.
[1] aus der Dokumentation „Mountain“ von Jennifer Peedom, 2017.
.
Alina Lindermuth
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
7 | Tom Tautorus
Wenn life…
Die Erinnerung kam an einem Tag, an dem ich ein neues Tagebuch begann. Als Erinnerung an die Unmöglichkeit einer clean slate, einer blank page, einer Tabula Rasa, breitete sie sich aus. Mit ihr kam die Angst und das manische Bestreben, das Weiß zu füllen, das zuzuschütten, zu übermalen und zuzukleben, was das Weiß nicht gut verbergen konnte. Manches blutet durch.
Erster Tag. Gelb-Grüner Tag.
[Verhangenes]
Così affettuoso, delicato, caro, egli era / So zärtlich, sanft und liebenswert, hatte er
riuscito ad avvolgersi davanti ai miei / es geschafft, sich vor meinen Augen in einen
occhi di un velo di innocenza così / so dichten Schleier der Unschuld zu hüllen, dass
fitta che mai avrei osato turbarlo. / ich es nie gewagt hätte, diesen zu zerstören. [1]
[Vergangenes]
Ich erinnere mich nicht daran, wie ich gebetet hatte, es möge weggehen, als du nicht genug Unschuld in mir sahst, um mich in Frieden zu lassen. Als ich nicht genug Unschuld hatte. Als dir offenbar wurde, dass meine Unschuld nur aufgemalt war, als das Wasser, voll Chlor und Kinderpisse sie abwusch. Vielleicht war ein Teil der Pisse meine eigene.
[Vergehen]
Der durch Memes überlieferte nicht unwahre Internetmythos über den Grönlandhai
(oder Pee Shark) besagt, dass sein Körper voller Urin ist. Damit ist der Hai giftig
und wird mehrere hundert Jahre alt. Dennoch haben die Isländer*innen, ergo Wikinger,
ergo starke Männer, eine Methode entwickelt ihn zuzubereiten und zu verspeisen.
[Vergeben]
Du schaust über die Kiesgrube hinweg, in der wir baden, und hast mehr Gedanken als wir alle zusammen. Du schaust den Rücken von einem der anderen Bauernjungen an. Einem der älteren, der schon eine Freundin hat, der seinem Vater auf dem Feld hilft und denkst, so ein starker Rücken. Es muss toll sein, seinen Kopf darauf abzulegen und ich frage mich, warum ich nicht so einen starken Rücken habe und merke nicht, dass du auch nicht so einen starken Rücken hast. Du schleppst deine Alibibücher mit, die dir helfen, an nackte Bauernjungen Flügel und Heiligenscheine zu malen und wenn du sie für Freunde hältst auch Teufelshörner, während sie nur einen Teufel kennen und das ist Hitler.
Ich laufe durch den Rosengarten und weine. Hier sind viele Menschen, die weinen, hinter jeder Rose einer und die Dornen der Rosen schmerzen mehr als deine Poesie und Sünde ist nicht nur ein Wort so wie „Freundschaft“ es für dich ist. Also reißen wir uns die Finger an den Rosenkränzen auf, zu denen du uns verdammst, und schlafen auch nach der Hochzeitnacht noch manchmal mit einer Frau.
Ich versuche zu erzählen, was ich heute gemacht habe und merke, dass ich als ich in dieser Erzählung eigentlich keine Stimme und keine Erlebnisse habe, wenn ich nicht du sage, als sei schwule Literatur der 40er Jahre auch nicht die Lösung, also gehe ich weiter und suche mir das nächste Arschloch.
getippt in die Handynotizen
Zweiter Tag. Kirschroter (cherry lips) Tag.
1. Ich esse einen Eisbergsalat. Blatt für Blatt. Über der Spüle. Auf dem Kopf, um der Unordnung Herr zu werden, ein Piratenkopftuch. Ich google deinen Namen. Ein Schritt, den ich immer für falsch und peinlich hielt, bis meine Therapeutin mir dazu geraten hat. Ich finde Artikel irgendeiner Regionalzeitung. Du leitest jetzt einen Jugendtreff, organisierst Sachen. Ob die Kinder wissen, dass ich nicht älter war als sie, als du dich hast verführen lassen? Ich scrolle nach unten. Kontakt.
2. Ich trage kirschroten Lippenstift, eine schwarze Kapuze. Will ich dich zu Fall bringen? Lokalprominenz in einer Stadt werden, in der ich noch nie war? Kamerablitze, die aus allen Ecken leuchten. Gerichtsprozesse, in denen du dir eine Akte vors Gesicht hältst. Genugtuung mittelbraun vertäfelt, wenn ich mich nur entschließen würde. Doch jetzt stehe ich noch in der schwach beleuchteten Küche. Ich reiße ein Blatt des Eisbergsalates nach dem anderen heraus. Ich ficke dich. Ich ficke dich nicht. Ich ficke dich. Ich ficke dich nicht. Natürlich nur metaphorisch.
3. Meine Augen sind verbunden. Ich muss abwägen. Szenario A. Ich sage nichts, ziehe mich aus der Verantwortung. Szenario B. Ich stelle dich und mache den Zeitungsleser*innen Angst vor schwulen Kinderfickern.
4. Ich bin dir böse. Wärest du schöner, berühmter, mächtiger; würde sich das ganze Drama nicht nur auf der Onlineseite einer unbedeutenden Lokalzeitung abspielen. Es gäbe Abgründe, Fallhöhe. Es gäbe öffentliches Interesse. Es gäbe irgendetwas. So gibt es nur jemanden, der im Dunkeln Salat über einer Spüle ist. Duschen sollte er auch einmal.
5. Meine Eifersucht auf Lolita-.
5.-10. Liebes Tagebuch,
heute habe ich diesen Text geschrieben. Danach habe ich mich übergeben.
Das hier ist so schlecht und ich kann es doch nicht lassen, noch mehr daran zu schreiben. Als könne man es irgendwie retten. Ich habe extra Kerzen angezündet.
Light of my life. Fire of my loins. [2]
Wenn man genauer hinhört sind ein großer Teil der Songtexte von Lana del Rey nicht kenntlich gemachte Zitate aus Lolita. Was macht diese Geschichte zum Mythos unserer Jugend?
Ich kehre zurück in meinen Handybildschirm. Ich erkenne deine Hässlichkeit und ich sah, dass es
gut war.
getippt in die Handynotizen
Ich mag es, wenn in Pornos nach dem Sex beide Darsteller über ihre Erfahrung, ihre liebsten und unangenehmsten Momente des Drehs sprechen. Gerne würde ich mir Compilations nur von diesen postkoitalen Gesprächen ansehen.
getippt in die Handynotizen
Vierter Tag. Hellblauer Tag.
Meine schmalen weißen Handgelenke.
Meine schmalen weißen Handgelenke lassen dich glauben.
Meine schmalen weißen Handgelenke lassen dich glauben, dass…
Die Popmusik [3] hat unrecht, wenn sie sagt, der*die unglücklich Liebende wäre eingesperrt, festgehalten, müsse frei gelassen werden. Er*sie*ich lässt*lasse nicht los. Ich schmiede dich ein, will dich starr machen, damit ich weich sein darf, dich einhüllen kann ohne Kontamination, doch du zerspringst in tausend klebrige Stücke.
Something in her demanded victimization and terror, so she corrupted my dreams,
led me into dark places, I had no wish to explore. It was no longer clear to me which of
us was the victim. Perhaps we were victims of one another [4]
Bullshit!
In historischen Weltuntergangsszenarien friert die Welt zumeist ein. Zu viele Rußpartikel in der Atmosphäre lassen nicht genug Sonnenstrahlen durch und die Welt erkaltet. Meine schmalen weißen Handgelenke, mein silbernes Haar.
The cold has never bothered me anyway. [5] Ich weiß nicht, mit der Erderwärmung umzugehen. Sie ist unästhetisch. Alles zerläuft. Meine Poren weiten sich und meine Ausdünstungen und Körperflüssigkeiten verschwimmen mit denen anderer Menschen, sodass wir beginnen sollten, Abstände und das Bedecken von Körperöffnungen neu zu regeln. Es gibt keine Machtfrage mehr. Kein Opfer. Keinen Täter. Kein Who’s screwing who?6 Denn wir verlieren unsere körperlichen Grenzen. Das Patriarchat fickt uns alle und eine Natur, die weiblich ist. Brauche ich Narration, um diesen Punkt zu machen? Figuren, Orte, Handlung? Vielleicht kann ich euch ein wenig Schweiß senden.
geschrieben ins Tagebuch
[1] Pier Paolo Pasolini in Amado Mio preceduto da Atti Impuri.
[2] Lana del Rey: Off to the Races
[3] Vgl. Kim Wilde: You keep me hanging on und Miley Cyrus: Prisoner (feat. Dua Lipa)
[4] „Bullshit!“ würde ich schreien, wenn du so etwas sagen würdest. Jetzt schreibe ich es ab. Anna Kavan in
Ice.
[5] Elsa in Frozen: Let it go
[6] Janelle Monáe: Screwed (feat. Zoë Kravitz)
.
Tom Tautorus
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
5 | Sofie Morin
Erster Advent
Der Advent ist unser Refugium. Die kerzenwarmen Grüße hat selbst das Löschpapier nicht verhärmt. Die Karten baumelnd an der Leine über dem Kamin, rotbebändert wie verknotete Zuversicht. Gesammelte Trophäen der Mitmenschlichkeit, saugen sie sich voll mit mistelumkränzten Blicken. Wie tief die Hoffnungen auch hängen mögen, wachsende Vorratshaltung der Wünsche. Sie gehen uns nie aus.
In der Küche wohnt das Leben selbst. Mutters Teig beatmet unsere Sehnsucht. Ihre Zuneigung flüssiges Metall. Insgeheim schlinge ich die Kekse noch warm hinunter. So gehen sie in mir auf wie kein Same je, und mein Körper wird zur Stadt. Ähnlich der, die unweit im Tal flackert. Uns lockt sie nicht. Wir bleiben im Territorium unserer Weiblichkeit.
Großmutter klopft ans Fenster und hat heute den Schnee dabei, den der Wolf sich aus dem Fell geschüttelt hat. Lässt ihn unterm Gejohle der Schwestern zu unseren Füßen auf den Küchenboden rieseln. Ein tiefes Gurren aus nahenden Raunächten kommt mit ihm ins Haus.
Ihr leichtes Gepäck hat sie dabei nicht verraten, sie trug die alte Mär gewandt in der Kraxn. Auf dem Steingut schmelzen die Schneekristalle passend zum Aggregatszustand meiner Sinne. Kein Geruch enthüllt die wilde Natur. Ich sehe mich um und bemerke keine Veränderung. Mutter wischt den See mit ihrer Nachsicht auf. Dieses Augenzwinkern haben wir an ihr noch nie gesehen. Gewiss hat sie im Fell der Nacht die Habergeiß gewittert.
Im oberen Stock die Tante in emsiger Bettstatt zugange. Wir hören sie gut und singen altbekannte Lieder darüber hinweg. Kein Mann habe ihre Lust entstellt. Und uns hat die Mutter vor den Perchten gewarnt!
Um den Küchentisch scharen wir Stoßgebete wie Kinderreime, während das Verlangen unaufhaltsam in uns tropft. Übers Stiegengeländer flocken Sporen der Leidenschaft zu uns herunter, vermischen sich schlierig mit dem Duft aus Großmutters Kaffeemühle. So unschuldig wie möglich sehen wir uns um, ob alles beim Alten geblieben wäre.
Zwiebelmuster aufs Porzellan gemalt und das Begehren an die Wand. Wir lösen einander das Haar. Der Zirbenkranz in der Tischmitte flicht unser Wissen zu einem einzigen Zopf. Lodernd
brennt darauf die erste Kerze.
Zweiter Advent
Tagesanbruch. Wir benennen nicht, was aus den Wäldern steigt. Wie Nebel, die Reste des vorangegangenen Tages und die Hütten halten darunter die Luft an. Aus unserem Schornstein aber steigt Rauch, dessen Schatten uns der Mond auf die Schneedecke legt. Zögerlich hebt sich die Nacht vom ermatteten Firn. Tief die Spuren johlender Schritte darin. Ihr Kettengerassel klingt uns noch in den Ohren, das schwere Klopfen an die Holztür, vom Verlangen, das Einlass begehrt. Glücklich haben die sorgsam geflochtenen Zöpfe uns davor nicht bewahrt.
Wir Schwestern wollen alles sehen. Sowie wir unsere Nasen an die Scheiben pressen, schmelzen die Eiskristalle. Draußen lichten sich unsere Sehnsüchte über dem Tal.
Dunstschwaden ziehen am alten Flusslauf entlang. Erinnerungsfetzen der Geschöpfe, die mit uns leben. Jäh ruft der Eichelhäher, wenn unsere Blicke die Baumgrenze überschreiten. Der Föhnwind hat die Perchten über die Bergrücken getrieben, heute kommt der Nikolo. Ich will über die Alm sehen, bis dahin, wo ich jüngst Haselruten geschnitten, ihr Mark mit meinem Monatsblut gefüllt. Zwischen Wurzelwerk ersteht die Stiefmutter aus Alraunen auf. Ihr Rauchwerk ist handverlesen. Sie betont jedes Wort wie ihr letztes: Alles, was uns wahrhaft gehört, ist geborgt von einem höheren Stern.
Das Mühlrad am Haus dreht sich und dreht uns. Ein leiser Windhauch durch Fensterritzen lässt uns wissen, worin wir geborgen sind. Du irrst dich, klagt die Schwester, nicht Mutterns
Nachsicht war es, ich habe den Schnee vom Küchenboden aufgeleckt!
Horch, Stiegenholzknarren. Herab steigt die Tante in neuem Gewand. Kein Ring an ihrem Finger weist sie aus. Staunend befühlen wir das niegekannte Stickwerk auf ihrer Walkjacke. Fäden aus vielen Jahren gesponnen. Voll Zuversicht bürstet sie sich die Vergangenheit aus dem Haar. Alles Brauchtum ist sinnlich, sagt sie. Wie auf ein Stichwort unter der Hörschwelle holt die Mutter das Kletzenbrot aus dem Ofen. Ob wir rauskönnen, fragen wir, nun, da die Nächte nicht mehr rau sind. Mutter und Tante sehen sich an und brechen in unbändiges Gelächter aus, das die Stube durchsprüht. Wie Wunderkerzen, flüstert die Jüngste und klatscht in die Hände. Ich verstehe den Mond nicht mehr, sagt die andere und schnäuzt sich in ihre Schürze. Wir Schwestern haben uns allzu lange nicht an den Händen gehalten, denke ich und tue es beidseits. Die Hoffnung reicht bis zum Esstisch. Und als läge uns nichts näher, zünden wir darauf die zweite Kerze an.
Dritter Advent
Das Feuer im Ofen ist fast heruntergebrannt. In den welligen Scheiben der Holzveranda brandet das Morgenrot. Tunkt das Haus in einen neuen Tag, noch bevor es verlischt. Ich lege drei Scheite nach, für jede Generation eines. Du hast die Urli vergessen, schimpft meine Schwester, und ich blase beschämt in die Glut. Zahllose Ahninnen, so viele Scheite hast du nicht, sagt die Großmutter und ihre Stimme war nie heller. Unter ihren kundigen Handgriffen wacht die Küche auf. Die Teekanne wiegt beinahe nichts. Nicht in ihren Händen, die einst Tag um Tag Gewänder über die Wäschehobel geschrubbt, weitab des Flussbetts.
Die Sonnenwende naht und der Schnee ist vor der Zeit getaut. Mir gefällt nicht alles, was darunter zum Vorschein kommt, doch ich weine ihm nicht nach. Großmutter kleidet sich in die Farben des Waldes. Eines Tages wird sie nicht zurückkommen. Wimpernumrandet ihr letzter Gruß und ihre Sanftmut bleibt. Käferbrut wird sich von uns nähren, lacht sie unlängst.
Meine Schwester meint, ihre Bluse müsse wohl sauber geworden sein. Atemwolken begleiten sie in die Waschküche. Ihre Herzhaut weicht nicht zurück. Sie trägt meine Bewunderung wie eine Zierde zum Festtag. Ich atme tief durch und gehe hinaus, Feuerholz holen, bevor der Stoß kippt. Kein Knirschen mehr unter den Schuhen. Die Erde ist scheinbar wieder näher gerückt. Stein und Stein schichte ich auf den bemoosten Baumstumpf. Opfergaben an die Treulosigkeit meiner Trauer. Darunter liegt das Tier begraben. Unser Streit darum ist beigelegt. Die Nachsicht hat der Mutter eine Kette um den Nacken gelegt, die alles andere ist als ein Hundehalsband. Der Großmutter hätte das Funkeln gefallen. Gib es nur immer weiter, sagt die Mutter und streicht der Ältesten übers Haar. Die Entbehrungen des Jahres sind über den Blutmond vergessen. Noch ein Viertel, sagt die Mutter. Und wir sehen zu, wie der Germteig beim Ofen aufgeht, wo die Katze am liebsten liegt. Wir haben genug, sagt sie und schlägt den Striezel ins Tuch. Im Tal raufen die Buben um den Sterz, weiß sie und wir mit ihr: Entfesselte Kräfte rauben unseren Mut nicht! Morgen zieht sie ihre Schuhbänder fest.
Der Bach, sonst ein Rinnsal, ist von der Schneeschmelze angeschwollen. Die Holzschaufeln des Mühlrads trinken sich gurgelnd satt und die Jüngste schlürft auf Mutters Schoß Zuversicht aus ihrem Becher. Ich schließe die Holztür mit dem Winterwind hinter mir. Ein Luftzug, der wie meine Großmutter heißt, ist mit mir gekommen und hat einen Docht ausgeblasen. Nicht die erste Kerze, nicht die dritte, frisch angezündete. Die zweite ist es. Die Zeit tut, als wäre nichts geschehen – bald schon, bald! – und lässt uns lichter auflodern.
Vierter Advent
Das ist die letzte lange Nacht. Wir alle vollziehen die uns verbliebenen Rituale der Dunkelheit. Atemluft zwischen Handflächen gewärmt, schüren wir eine Glut, die sich tags vor uns verbergen mag, winden Bänder um entflohene Mythen. Auf dem Fensterbrett die Stille in Milchschalen gegossen, die letzte Anrufung, um die wir sicher wissen. Wenn auch die Großmutter gegangen sein wird, so bleiben wir ruchbar im Schwesternuniversum. Und jede unserer Gesten sei angetan, die Wiederkehr der erstarkenden Sonne zu bezeugen.
Morgen gleichen sich Tag und Nacht. Lockend ziehen Schwaden neuen Glücks dicht an der Hauswand vorbei. Nichts hat uns darauf vorbereitet. Vogelpaare streiten in der Dämmerung lautstark um den Nachwuchs, der ausbleibt. Wartet noch, wartet, will ich sie trösten, die lichte Zeit kommt bald zurück! Sie glauben nicht mir, sondern allein der Witterung der Zeit selbst. Ahnen nicht, dass mich nichts sonst derart verwirrt, wie ihr steter Verlauf.
Was wissen wir schon? Meist sehen wir die Welt durch unser Fenster, schicken unseren Blick hinaus, tags mehr als nachts. Aus Scheiben, das Werk alter Hände, spiegelnd aus Quarzsand getaucht. Heften Zwirnfäden an unsere Bestimmung, verlassen uns auf die Saligen. Dass sie von den Gletschern herabsteigen, uns innewohnen, sobald die Welt aus dem Nebel fällt.
Ich wage einen Schritt vor die Tür. Jetzt ist da ein Glitzern von tanzenden Schneeflocken rund um mich. Tränen kristallisieren auf meinen Wangen. Ich gehe bis zur Grenze. Dort treffe ich sie. Sie bietet mir Obst an, das ich zunächst nicht annehmen will. Einen glasierten Apfel, glänzend und ahnungsvoll süß knackend. Sie lacht, beißt selbst hinein. Die Apfelhaut rotglühend in ihrem Mund wie das Schwesternzahnfleisch. Sie bückt sich, die Haare fallen ihr über die Schultern nach vorn, ich glaube es sind meine, formt mit bloßen Händen aus der Erde neues Leben. Reicht es mir. Das und die Bitte, es unterm Gaumendach zu verwahren.
Zurück in der Stube sehe ich meine Schwestern verändert an. Die Mutter birgt ihr Gesicht in Kinderhaut weich. Am Tisch ist mein Platz frei. Die Karten liegen über ihn verstreut, wie kleine Zündflammen, schmelzen die Schatten der Schriftzeichen, über Jahre ins Holz gekerbt. Ihr Abdruck ist weithin nahbar. Wir wissen, was diese Umarmung bedeutet und behängen die Äste. Das Christkind zählt drei Tage von der Sonnenwende hinauf. Verlässliches Uhrwerk meiner Geborgenheit. Die baumelnden Schokokugeln in weißes Fransenpapier geschlagen, sind ihre Zahnräder. Vier Kerzen zitieren uns die Himmelsrichtungen. Morgen gleichen sich Tag und Nacht. Die Feuer werden die Hänge hell erleuchten. Alles hat uns darauf vorbereitet.
.
Sofie Morin
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
3 | Angela Ahlborn
Spurensuche
Jost atmet tief durch. Jetzt nur nichts sagen, es hat keinen Sinn, es würde die Situation nur verschlimmern. Er meidet den Blick seiner Mutter; zu oft hat er sie in dieser resignierten Abwehrhaltung gesehen, tapfer ausharrend, mit Tränen in den Augen. Die Stimme seines Vaters schwillt an, jedes ausgespieene Wort ist ein Treffer. Wo lauert die unbändige Wut, die unberechenbar wie aus dem Nichts immer wieder aufflackert? Hatte sie stets in seinem Vater gebrodelt, nur gedeckelt und gut versteckt? Die Wesensveränderung sei der Krankheit geschuldet, beteuern die Ärzte. Jost will das glauben, bei jedem einzelnen Zornesausbruch seines Vaters gibt er sich größte Mühe.
Ihn quält wie so häufig die Frage, ob man hätte achtsamer sein müssen. Als sein Vater begann zu verschwinden, hatte es kaum jemand bemerkt, im Rückblick erscheinen ihm die Vorboten schmerzhaft deutlich. Vor Jahren schon verstand sein Vater bei einem Weihnachtsfestessen den bei solchen Gelegenheiten ständig erzählten Familienwitz nicht mehr. Mit merkwürdig großen Augen erklärte er Josts Schwester, ihn noch nie gehört zu haben. Er sorgte mit dieser Aussage für ein kurzes erschrecktes Innehalten der fröhlichen Gesellschaft. Josts Mutter lachte die Beklommenheit weg. Einige Wochen später fand Jost beschmutzte Unterwäsche seines Vaters, versteckt an den unmöglichsten Stellen. Seine Mutter schmunzelte auch darüber und riet ihm, sich nicht zu sorgen, der Vater sei nun auch nicht mehr der Jüngste, da passiere so etwas und es sei ihm sicherlich peinlich.
Mit den Jahren ließ das Lachen in Josts Elternhaus nach. Sämtliche Versuche, die Mutter auf den Zustand des Vaters anzusprechen, wurden von ihr boykottiert. Die zunehmende Vergesslichkeit ihres Mannes sowie seine sich plötzlich entwickelnden Eifersuchtsanfälle entschuldigte sie mit seinem Alter. Josts Vorstoß, einen Neurologen zu konsultieren, wurde mit groben Unflätigkeiten kommentiert; nie zuvor hatte er seinen Vater solche Worte sagen hören. Wie ein Tuch legte sich die Sorge vor drohendem Unheil auf die Familie, Frohsinn und Unbekümmertheit wurden herausgefiltert.
Demenz. Der Zustand des Vaters hatte jetzt einen Namen. Kompromisslos und nicht diskutierbar. Erstmalig ausgesprochen und als weitere Diagnose in den Entlassungspapieren schriftlich festgehalten. Sein Vater hatte mehrere Tage wegen einer Niereninsuffizienz im Krankenhaus verbracht. Der Damm war gebrochen, Josts Mutter konnte sich alles von der Seele reden, sie war befreit vom Druck, die Situation zu verharmlosen. Gleichzeitig zwang sie der Befund, sich von der Illusion einer normalen Alterserscheinung zu verabschieden. Jost konnte das Ausmaß ihrer Einsamkeit nur erahnen. Der Vater war von allem unberührt. Niemand traute sich, das Thema anzusprechen, zu groß war die Furcht vor einem erneuten Wutausbruch, den letztlich seine Mutter mehrere Tage auszubaden hätte.
Die Krankheit war launisch; es gab hellere Tage, in denen man sich der Hoffnung hingeben konnte, der Verlauf wäre eventuell zu stoppen oder würde sich gar bessern. Als die Diagnose endlich feststand, kam fast so etwas wie Euphorie bei Jost auf. Er hoffte, nun könne man handeln, Ärzte um Medikamente und Therapien bitten, Ratschläge von Betroffenen einholen, einen Pflegedienst hinzuziehen. Die Erkenntnis über die Unheilbarkeit einer Demenz traf ihn schwer. Auch der Rat, das Wohlbefinden des Betroffenen zu fördern, stellte keine Entlastung dar; sein Vater wehrte sich gegen jede noch so kleine Hilfeleistung, da er keine Krankheitseinsicht empfand.
Jost vermisste seinen Vater schmerzlich. Die ausführlichen Gespräche zwischen ihnen gehörten der Vergangenheit an, jedwede Logik erreichte den Vater nicht mehr. Von dem ehemals klugen und belesenen Feingeist schien nur noch die optische Hülle existent zu sein. Immer wieder suchte Jost seinen Vater in dem so vertrauten, doch meist ausdruckslosen Gesicht. Tatsächlich fand er ihn manchmal ganz weit in der Vergangenheit; dort waren sie beide sicher, es war fast wie früher, die Rollen klar definiert, Vater und Sohn. Viele Ereignisse aus der Kindheit und Jugend waren noch abrufbar und belebten die sonst so leere Miene des alten Mannes. Jost hatte noch nie zuvor den Wunsch verspürt, etwas schriftlich festzuhalten, aber jetzt gab er dem Bedürfnis nach, jedes Detail ihrer Beziehung aufzuschreiben, bevor sein Vater sich gänzlich in sich zurückziehen würde.
Ihm war die Sinnlosigkeit der Frage bewusst, ob die Veränderung des Vaters ausschließlich auf die Demenz zurückzuführen war oder die damit verbundene fehlende Impulskontrolle seinen wahren Charakter zum Vorschein brachte. Jost hatte sich schon immer an der Dominanz und Selbstgerechtigkeit seines Vaters gerieben, jedoch gingen diese Eigenarten vor der Krankheit nie über ein erträgliches Maß hinaus. Etwas in ihm flehte danach, den Vater aus der Verantwortung zu ziehen, wenn dieser wieder einmal seine Mutter mit wüsten Beschimpfungen und haltlosen Eifersuchtstiraden quälte. In diesen immer häufiger vorkommenden Situationen besaß Jost nicht den Abstand, die verbalen Gewaltexzesse seines Vaters mit dem dementiellen Syndrom zu entschuldigen, sondern sah einen bösartigen Menschen, der eine nicht auszuhaltende Belastung für seine Mutter darstellte. Im Anschluss empfand er Scham und versuchte, sein Verhältnis zum Vater neu zu definieren, was ihm jedoch nicht wirklich gelang. Hatte er früher seine Bindung zu ihm ohne Zögern mit Liebe und Zuneigung assoziiert, war da jetzt ein verwirrendes Vakuum, das er gerne mit mehr als pflichtbewusster Sorge befüllt hätte. Und er fürchtete sich vor der Erinnerung an seinen Vater: Würde er ihn später nur noch als den Menschen sehen, der er in seinen letzten Jahren gewesen war?
Jost schreckt auf, ein klirrendes Geräusch unterbricht die zornigen Beschimpfungen. Sein Vater hat eine Tasse nach seiner Mutter geworfen. Er unterstellt ihr einen zu freundlichen Umgang mit dem Pflegehelfer. Die Mutter weint leise, der Vater erhebt sich, Jost steht bereit, sich schützend vor die Mutter zu stellen, doch sein Vater geht stumm in den Garten. Hilflos nimmt Jost seine Mutter in den Arm, versucht zu trösten. Noch als er die Scherben auffegt, ist er von Wut erfüllt.
„Kannst du nach ihm schauen, Jost?“, bittet seine Mutter. „Ist wohl besser, wenn du das tust.“
Mit dem Gefühl, der Situation nicht mehr gewachsen zu sein, geht Jost auf den Rücken seines Vaters zu. In Erwartung einer wie immer sinnlosen Auseinandersetzung setzt er sich neben ihn auf die Gartenbank. Ohne ihn anzuschauen greift der alte Mann nach seiner Hand.
„Ich weiß nicht, was los ist, Junge, irgendwas stimmt nicht in meinem Kopf“, weint er leise. Fest umschließt Jost die Hand seines Vaters.
.
Angela Ahlborn
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
2 | Marc Späni
Zielorte
Im Homeoffice habe ich die praktische Philosophie entdeckt.
Wann immer es die Arbeit zulässt – und das ist eigentlich immer –, gehe ich zur S-Bahn-Station und helfe den Leuten, ihren Weg zu finden.
Ich bin aber keiner von denen, die Bibeln verteilen oder mit Kreide den ganzen Asphalt vollschreiben, Gott ist der Weg. Jesus rettet dich. Das Gebet wirkt.
Das Zentrum meines Wirkens ist der Billettautomat, dieser stählerne rot-blaue Altarblock, das Kontrollzentrum der Station, ihr Gehirn.
Zehn, fünfzehn Minuten bevor der Zug fährt, stehe ich da.
Ich helfe auch denjenigen, die mit dem Automaten nicht klarkommen, wie man ein 24-Stunden-Anschlussbillett für drei Zonen löst oder ein halbes nach Olten 1.Klasse. Meine eigentliche Zielgruppe sind aber diejenigen, die nicht wissen, wohin sie eigentlich wollen. Ihnen mache ich Vorschläge. Mittlerweile sehe ich es den Leuten nämlich immer besser an, wo ihre Bestimmung liegt. Schwierig sind diejenigen, die behaupten zu wissen, wo sie hinwollen, und sich nicht von ihrem Irrtum abbringen lassen. Erst einmal ist es mir gelungen, einem solchen gegen seinen Willen das Ticket zu seiner richtigen Bestimmung zu lösen und es ihm im letzten Augenblick in die Hand zu drücken, als sich die Zugstüren schon schlossen. Man muss diese Leute zu ihrer Bestimmung zwingen. Schwierig sind auch diejenigen, die den Automaten für sich in Anspruch nehmen, da kommt es schon mal zu kleineren Rangeleien, vor allem zu Stosszeiten.
Selten ist niemand da. Meistens wenigstens Oberholzer, mit seinem karierten Hemd und der verschlissenen Manchesterjacke.
Ihm brauche ich nicht zu helfen, er kennt seine Bestimmung: Er will nirgendwo hin.
Mit Oberholzer erörtere ich philosophische Fragen: Wer sind all die Leute, die ein- und aussteigen? Wer sind wir? Worauf warten wir eigentlich? Was sollen wir sonst noch tun? Am Automaten komponieren wir immer ausgeklügeltere Tickets: Mit einer Mehrfahrtenkarte erster Klasse von Goppensteig nach Ganterswil via Le Locle, Arosa und Brunnen SZ haben wir neulich die Marke von 17'000 Franken gesprengt. Natürlich kann man solche Billette am Ende nicht am Automaten kaufen. Es sind Gedankenexperimente, Denkspiele.
Immer freitags kauft Oberholzer ein Ticket, nach Amriswil, Puntrutt, Höri oder sonst wo hin, faltet es, steckt es sorgfältig in sein Portemonnaie und geht nach Hause. Er muss schon eine große Sammlung haben.
Wenn ich ihn frage, warum er nie fährt, schüttelt er den Kopf. «Der Zug fährt genau dahin, wo die Schiene hinführt, egal was du dir für ein Billett kaufst.» Seit einiger Zeit ist er auch überzeugt, dass Orte wie La Tine, Tinglev, Tinizong oder Tincques nur Erfindungen eines verrückten Programmierers sind.
Und langsam gelange ich zur Überzeugung, dass er recht haben könnte.
.
Marc Späni
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen:
advent.mosaikzeitschrift.at
1 | Tara Meister
richtung mittel
Socken
Mike hob den Karton hoch über das zerlegte Bettgestell und seine Muskeln glänzten, deltoideus, trapezius, biceps, das volle Programm.
Mia seufzte, schon den ganzen Vormittag. „In ein paar Tagen habe ich vergessen, wie es ausgesehen hat.“
Ihre nackten Füße ragten über den Couchtisch, dahinter stapelte sich beinahe alles, nur das Regal stand noch.
In der Küche wickelte Ben Gläser in Zeitungspapier ein, Wassergläser und Weingläser, die ein bisschen klebrig waren. Dass sie nicht zerbrachen, auf den 47 Kilometern zwischen hier und dort.
Aus der Musikbox kam Big Thief, regelmäßig unterbrochen von dem Akku-leer-Geräusch.
Ob er in der neuen Wohnung noch den 2 Euro 80 Wein trinken würde, überlegte Ben, oder nicht mehr, bei 2,3 brutto.
Mia kam in die Küche, drehte die Musikbox leiser. „Es geht mir zu schnell“, sagte sie und: „Kann ich deinen Duschvorleger haben?“
„Ja.“
Zerbrechliches
Ben stapelte ein eingepacktes Glas nach dem anderen in den Karton.
„Da steh ich dann nackt drauf und nass, wenn ich aus der Dusche komme und denk an dich“, sagte Mia, „voller Mitleid.“
Sie griff nach den restlichen Weintrauben in der Obstschale.
„Danke“, antwortete Ben.
Junger Mann fällt mit Fahrrad in den Donaukanal hieß es auf der Doppelseite, in die er die Zuckerdose einwickelte.
„Wer als nächstes, frag ich mich“, Mia ließ eine Traube zwischen ihren Zähnen platzen, „hat bei dir auch niemand kommen sehen, dass du eines Tages arbeiten gehen würdest.“
Sie trug ihren fliederfarbenen Pullover, mit Absicht, vermutete Ben. Den, den er an einem Abend ein wenig angesengt hatte. Wenn sie ihm den Rücken zuwandte, sah er das dunkle Brandloch.
„Ich bau das Regal jetzt ab!“, rief Mike aus dem anderen Zimmer.
„Passt!“, rief Ben zurück.
„Willst du alle Bücher behalten?“
„Ja!“
„Alle, alle?“
„Ja!“, brüllte Ben über das einsetzende Geräusch der Bohrmaschine.
„Wer liest denn Bücher zweimal?“
Sonstiges
Ben stand zwischen den Kisten, nippte an seiner Bierflasche, seine Augen waren ein bisschen feucht. Mia bemerkte es erst, als sie ihre Zigarette fertig geraucht hatte.
„Schon gut“, sagte sie und zwickte ihm in die Wange, „irgendwann wären wir sowieso hässlich geworden. Sogar Mike, das glaubt er mir nur nicht.“
Später war der Flur vollgeräumt und die Wohnung leer.
Zu dritt setzten sie sich vor die Zimmertüre auf den Boden und begannen die Sticker von dem Milchglas zu kletzeln. Es dauerte lange und unter jeder Schicht kam eine neue. Politische Parolen, Veranstaltungen, Musikbands, klebrige weiße Fussel sammelten sich unter ihren Fingernägeln.
.
Tara Meister
.
Das Advent-mosaik, dein literarischer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Täglich darfst du ein neues Türchen aufmachen: